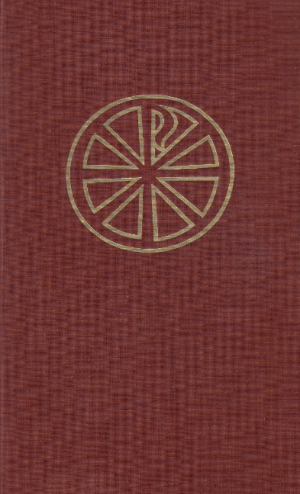Columba Marmion: Christus, das Ideal des Priesters
Christus, das Ideal des Priesters
Quelle: Abt D. Columba Marmion OSB, Christus, das Ideal des Priesters, aus dem französischen übertragen von E. Nikrin, Editions de Maredsous, Belgien 1952, Paulusverlag Freiburg/Schweiz 1954 (1. Auflage, 567 Seiten, Imprimatur Friburgi Helv. die 16. martii 1954, R. Pittet, vic. gen.). Das Buch richtet sich besonders an Priester. Bearbeitet durch Benutzer:Oswald: Die lateinischen Bibelstellen sind oft übersetzt. Deshalb wurden sie weggelassen. Andere Bibelstellen, die nicht übersetzt waren, sind oft in der Version der Einheitsübersetzung wiedergegeben. Weitere lateinische Wörter oder Sätze sind übersetzt, einige jedoch beibehalten. Auslassungen sind durch Punkte " … " gekennzeichnet, wie auch auch in der verwendeten Quelle. Am Ende des Buches sind verschiedene Aufzeichnungen aus dem priesterlichen Leben Dom Marmions bruchstückhaft wiedergegeben. Sie wurden weggelassen. → Vorlage:Columba Marmion Opera
Inhaltsverzeichnis
- 1 Auszug aus einem Schreiben vom Staatssekretariat Seiner Heiligkeit Papst Pius XII. an den hochw. Abt von Maredsous
- 2 VORWORT
- 3 ERSTER TEIL: CHRISTUS, DER URHEBER UNSERES PRIESTERTUMS UND UNSERER HEILIGKEIT
- 3.1 I. DAS PRIESTERTUM CHRISTI
- 3.2 II. CHRISTUS, VORBILD UND URSPRUNG PRIESTERLICHER HEILIGKEIT
- 3.2.1 1. Das Übernatürliche
- 3.2.2 2. Die Gedanken Gottes über unsere Heiligung
- 3.2.3 3. Dem Bild des Gottessohnes gleichförmig werden
- 3.2.4 4. In der Gleichförmigkeit mit Christus spiegelt der Priester die Heiligkeit des Vaters wider
- 3.2.5 5. Christus, der lebendige Quell der Heiligkeit Christus ist das überragende und dennoch nachahmbare Vorbild der Heiligkeit, und durch seine allmächtige Gnade verleiht er uns aktive Teilnahme an seiner Heiligkeit
- 3.3 III. DER PRIESTER, EIN ANDERER CHRISTUS
- 4 ZWEITER TEIL: PRIESTERLICHES HEILIGKElTSSTREBEN
- 4.1 A. DIE TUGENDEN DES PRIESTERS
- 4.1.1 IV. Lebt aus dem Glauben
- 4.1.1.1 1. Der Glaube, Lebensraum des Priesters
- 4.1.1.2 2. Die Bedeutung des Glaubens
- 4.1.1.3 3. Der Begriff des Glaubens
- 4.1.1.4 4. Das Vorrecht des Glaubens: er ist Beginn der beseligenden Gottesschau
- 4.1.1.5 5. Der Glaube an Christus, den menschgewordenen Logos
- 4.1.1.6 6. Drei Eigenschaften des priesterlichen Glaubens
- 4.1.2 V. «DER SÜNDE STERBEN»
- 4.1.3 VI. DAS SAKRAMENT DER BUSSE UND DER GEIST DER ZERKNIRSCHUNG
- 4.1.4 VII. ER ERNIEDRIGTE SICH UND WARD GEHORSAM
- 4.1.5 VIII. DIE TUGEND DER GOTTESVEREHRUNG
- 4.1.6 IX. DAS HAUPTGEBOT
- 4.1.7 X. DAS IST MEIN GEBOT
- 4.1.1 IV. Lebt aus dem Glauben
- 4.2 B. BESTELLT FÜR DIE ANGELEGENHEITEN DER MENSCHEN BEI GOTT
- 4.2.1 XI. «TUT DIES ZU MEINEM ANDENKEN ...»
- 4.2.2 XII. SANCTA SANCTE TRACTANDA
- 4.2.3 XIII. DAS EUCHARISTISCHE MAHL
- 4.2.4 XIV: DAS STUNDENGEBET
- 4.2.5 XV. DER PRIESTER, EIN MANN DES GEBETES
- 4.2.6 XVI: PRIESTER UND HEILIGER GEIST
- 4.2.6.1 1. Der Heilige Geist belebt die Kirche
- 4.2.6.2 2. Es ist notwendig, den Beistand des Heiligen Geistes zu erflehen
- 4.2.6.3 3. Wie sollen wir den Heiligen Geist anrufen?
- 4.2.6.4 4. Die Gaben des Heiligen Geistes beim Zelebrieren der Messe. Die Gaben der Furcht, der Frömmigkeit, der Stärke
- 4.2.6.5 5. Die Gaben der Wissenschaft, des Verstandes und des Rates
- 4.2.6.6 6. Die Gabe der Weisheit
- 4.2.7 XVII: HEILIGUNG DURCH DEN ALLTAG
- 4.2.8 XVIII: MARIA UND DER PRIESTER
- 4.3 XIX: VERKLÄRUNG
- 4.1 A. DIE TUGENDEN DES PRIESTERS
- 5 Literatur
Auszug aus einem Schreiben vom Staatssekretariat Seiner Heiligkeit Papst Pius XII. an den hochw. Abt von Maredsous
Dom Columba Marmion nimmt im zeitgenössischen religiösen Schrifttum eine so hervorragende Stellung ein, dass jedes seiner Werke vom Heiligen Vater freudig begrüßt wird. Seine Heiligkeit fühlt sich gedrängt, alle jene herzlich zu beglückwünschen, die die Veröffentlichung des Buches «Christus, das Ideal des Priesters» ermöglicht haben. Es ist sein väterlicher Wunsch, dass durch diese Arbeit der segensreiche Einfluss, den Dom Marmion, dieser hervorragende Lehrer des geistlichen Lebens, bei seinen Lebzeiten ausübte, sich in den weitesten Kreisen auswirke, vor allem im Klerus (Schutzumschlag hinten).
VORWORT
Am 6. März 1918, wenige Monate nach dem Erscheinen des Buches «Christus, das Leben der Seele», das einen so starken Widerhall wecken sollte, kündete Dom Marmion in einem Brief an, sein Werk werde vier Bände umfassen: «Christus unser Leben», «Christus in seinen Geheimnissen», «Benediktinische Aszese» und «Sacerdos alter Christus» (Siehe den Text dieses Briefes S. 440).
Am 25. September des gleichen Jahres schrieb er: «Ich habe den vierten Band für die Priester begonnen. Der Arbeit liegt folgender Plan zugrunde: 1. Ewiges Priestertum. - 2. Priesterliche Berufung. - 3. Die Heilige Messe. - 4. Lobopfer. - 5. Dankopfer. - 6. Sühnopfer. - 7. Bittopfer.
«Christus in seinen Geheimnissen» erschien 1919. Bald nach der Veröffentlichung (September 1922) von «Christus, unser Ideal» ging der Abt von Maredsous in die ewige Heimat ein (30. Januar 1923). Der Trilogie fehlte die Krönung, der inhaltlich bedeutendste Teil nach «Christus, das Leben der Seele», nämlich jener, den Dom Marmion den Priestern gewidmet hatte. Pendent opera interrupta.
Diese «Unterbrechung» zog sich jahrelang hin. Der Unterzeichnete, der die Verantwortung dafür trägt, schuldet dem Leser eine Erklärung dafür.
Dom Marmion hat bekanntlich niemals eine Niederschrift gemacht, die zur Veröffentlichung bestimmt war. Die drei ersten Bände des Christus-Werkes wurden von einem seiner Mönche herausgegeben, der dazu die Aufzeichnungen verwendete, die Zuhörer von Dom Marmions Vorträgen gemacht hatten. Aus diesen zahlreichen Skripten konnte der Herausgeber doktrinelle und aszetische Darlegungen von innerer Einheitlichkeit zusammenstellen.
Dom Marmion ermutigte den Herausgeber bei dieser schwierigen Arbeit, leitete und kontrollierte sie. Er sah jede Seite durch, oft mit Feder oder Bleistift in der Hand, korrigierte da und dort, fügte Zitate aus der Heiligen Schrift, den Vätern oder der Liturgie hinzu, die den dargelegten Gedanken unterstreichen.
Diese gründliche Durchsicht bot nicht nur dem Herausgeber volle Sicherheit, sondern ermöglichte es Dom Marmion, seinem Werk voll und ganz das Siegel seiner Persönlichkeit aufzudrücken.
Nach seinem Tod wurden viele handschriftliche Aufzeichnungen über das Priestertum und die Heiligkeit des Priesters gefunden, die ihm zur Vorbereitung seiner geistlichen Vorträge gedient hatten.
Es bestand kein Zweifel, dass diese Skripten, die sich im Lauf von etwa dreißig Jahren angesammelt hatten, Material zu einem geordneten und dem Inhalt nach einheitlichen Werk boten. Doch leider war es nicht mehr möglich, diese Arbeit dem Autor zur Prüfung vorzulegen; keine Durchsicht, keine Gutheißung konnte für das Gelingen bürgen.
Diese Erwägung beunruhigte den Herausgeber so sehr, dass jeder Versuch, das Werk zusammenzustellen, bis vor kurzem daran scheiterte.
Erst in letzter Zeit bot sich eine unverhoffte Gelegenheit, die Arbeit unter den günstigsten Vorbedingungen in Angriff zu nehmen. Ein ehemaliger Schüler von Dom Marmion, Dom Ryelandt, der viele Jahre den Vorträgen des Meisters beigewohnt hatte, wurde von wichtigen und aufreibenden Aufgaben entlastet. In liebenswürdigster Weise erklärte er sich bereit, uns auf Grund seiner gründlichen Kenntnis der Lehren Dom Marmions behilflich zu sein. Eine wohldurchdachte, längere Zusammenarbeit hat es ermöglicht, der Öffentlichkeit mit größtmöglicher Genauigkeit eine Zusammenfassung seiner Lehre über das Priestertum zu bieten. Wir hoffen, dass sie unseres gemeinsamen Lehrers würdig ist.
Es dürfte den Leser interessieren, Einzelheiten über das Wirken Dom Marmions beim Klerus zu erfahren.
Diese Form des Apostolates lag ihm besonders am Herzen, weil er sich da an die «Freunde» Jesu wandte, die am Erlösungswerk des göttlichen Meisters teilnehmen. Von diesen Vorträgen pflegte er zu sagen, sie erreichten jene, die seine Gedankengänge weitertragen würden.
Die Vorsehung hatte ihn für diese hohe Aufgabe vorbereitet. Dom Marmion kannte genau das Leben im Priesterseminar von Dublin, wie auch im Collegio Irlandese in Rom, wo er seine theologische Ausbildung abschloss. Nachdem er 1881 in der Ewigen Stadt zum Priester geweiht worden war, kehrte er nach Irland zurück und wurde dort zum Vikar von Dundrum, in der Bannmeile der Hauptstadt, ernannt. Ein Jahr lang arbeitete er sich in die verschiedenen Aufgaben der Pfarrseelsorge ein. Sodann berief ihn sein Erzbischof auf den Lehrstuhl der Philosophie am Seminar von Cloncliffe; er hatte ihn vier Jahre lang inne. Während dieser Zeit vertrauten ihm viele Priesteramtskandidaten die Führung ihrer Seele an. Zu seinem Pflichtenkreis gehörte die Betreuung zweier Frauenklöster; außerdem widmete er sich den männlichen und weiblichen Sträflingen der Gefängnisse von Dublin.
Durch den ausgedehnten Verkehr mit Seelen verschiedenster Art, mit den ärmsten und den edelsten, gewann Dom Marmion allmählich Einblick in die verborgensten Tiefen des menschlichen Gewissens.
Er war 28 Jahre alt und besaß schon reiche priesterliche Erfahrung, als er endlich seinem Verlangen nach dem Ordensleben folgen und in die Abtei Maredsous eintreten konnte.
Nach Ablegung der Profess trat er in Verbindung mit den Pfarreien in der Umgebung der Abtei. Bald war sein Eifer bei den Pfarrern dieser Orte bekannt; sie entdeckten in ihm einen geborenen Prediger, der zwar ein fehlerhaftes Französisch sprach, aber dennoch in seiner originellen Art die Herzen ergriff. Sein Ruf verbreitete sich allmählich. Es dauerte nicht lange, da begann er in Dinant sur Meuse sein eigentliches Apostolat bei den Priestern durch eine Reihe von monatlichen Rekollektionstagen, die er in den Jahren 1897-1898 für den Klerus der Stadt hielt.
Doch erst in Löwen, wohin er 1899 gesandt wurde und wo er zehn Jahre blieb, konnte er sich ganz dieser Aufgabe widmen. Im Heilig-Geist-Kolleg, das Professoren der theologischen Fakultät und junge Priester beherbergt, die sich auf akademische Grade vorbereiten, wie auch im Seminar Leo' XIII. und dem Amerikanischen Kolleg, hielt er zahlreiche Exerzitien und Vorträge. Die dogmatische Fundierung seiner Vorträge und die warme Überzeugungskraft, mit der sie vorgetragen wurden, machten tiefen Eindruck auf diese Universitätskreise. Dom Marmion erwarb sich bald die Hochachtung dieser Priester; mehrere von ihnen wählten ihn zum Seelenführer, darunter Msgr. Mercier, der später Berühmtheit erlangen sollte. Als Msgr. Mercier Erzbischof von Mecheln und Kardinal geworden war, beauftragte er Dom Marmion, den achtzig Priestern, die in den Pfarreien und Kollegien von Brüssel wirkten, geistliche Instruktionen zu geben (1907-1908). Doch schon war eine Berufung nach England an ihn ergangen. Kardinal Bourne, Erzbischof von Westminster, und Msgr. Amigo, Bischof von Southwark, baten mehrmals um seinen Einsatz bei ihrem Klerus.
Dieses Apostolat, das überaus reiche Frucht brachte, übte er bis zu seinem Tod. Die Priesterseminarien von Tournai und Nottingham (August und September 1922) sind die letzten, die das Glück hatten, diese zugleich so übernatürlichen und doch so menschlichen Lehren aufzunehmen.
Wie gesagt, hinterließ Dom Marmion sehr viele handschriftliche Aufzeichnungen, die ihm zur Vorbereitung auf diese Predigten dienten (Bei der Predigt selbst benützte Dom Marmion niemals seine Notizen. Immer, auch bei Exerzitien, in denen er eine große Anzahl von Vorträgen hielt, sprach er aus der Fülle seines Herzens, ohne sich an den Buchstaben der Aufzeichnungen zu halten, die er vorbereitet hatte.). Zuweilen wurde die Disposition wenigstens flüchtig skizziert; die meisten sind jedoch fragmentarisch, wenig geordnet, unvollständig, currente calamo oder mit Bleistift geschrieben, oder sie bestehen in wenigen Zeilen, die rasch auf ein Blatt des Taschenkalenders gekritzelt wurden. Dennoch sind alle inhaltlich sehr wertvoll. Sie bilden den Grundstock unseres Materials, den authentischsten Teil. Wir benützten hauptsächlich die Notizen von Löwen (1899-1908), die von wahrer Meisterschaft zeugen.
Von 1909 an sind die Skripten weniger zahlreich; damals wurde Dom Marmion zum Abt von Maredsous gewählt, und seine Amtspflichten nahmen ihn immer mehr in Anspruch. In dieser Zeit stand er in der vollen Reife seiner Persönlichkeit und im Vollbesitz seines Wissens. Er besaß ein gutes Gedächtnis und vermochte aus der Fülle seiner Erfahrung zu schöpfen. Für diesen letzten Lebensabschnitt haben wir eine andere Materialquelle: die Niederschriften der Hörer seiner geistlichen Konferenzen. Unter diesen befindet sich der Text von zwei vollständigen Exerzitienkursen, einem von 1919, den Dom Marmion aus dem Krieg zurückgekehrten Ordensleuten hielt; und einem, den er den Seminaristen von Tournai gab. Beide zeugen von hohem Gedankenflug und außerordentlich großer Erfahrung.
Aus diesen zahlreichen, verschiedenartigen Skripten, die sich über einen längeren Zeitraum verteilen und von ungleichem Wert sind, und in denen unvermeidliche Wiederholungen vorkommen, sollte nun durch sorgfältige Auswahl ein zusammenhängendes und vollständiges Orginalwerk geschaffen werden.
Der Plan, den Dom Marmion in seinem Brief vom 25. September 1918 entworfen hatte, war zu summarisch, als dass er mehr als eine allgemeine Idee von dem Buch hätte vermitteln können, obgleich die Stellung, die er dem Messopfer einräumt, charakteristisch für seine Auffassung ist.
Die große Anzahl von Dokumenten und der Wunsch, nichts von diesem Schatz verlorengehen zu lassen, veranlasste uns, die ganze Doktrin in einen einfachen, logischen Rahmen einzuordnen, der die ganze Weite des priesterlichen Lebens berücksichtigt. Jede andere Anordnung hätte es uns unmöglich gemacht, die Gesamtheit des wertvollen Materials, das Dom Marmion uns hinterlassen hat, zu einer einheitlichen Synthese zusammenzufassen. Er selbst hätte dieses Vorgehen sicher gutgeheißen, denn es entspricht dem, das er bei der Herausgabe von «Christus, das Leben der Seele» und «Christus, das Ideal des Mönches», selbst gebilligt hatte. Das ständige Ziel unserer gemeinsamen Bemühungen war, die Substanz der Lehre Dom Marmions rein und vollständig in ihrer wesentlichen Einheit und der Vielfalt ihrer Aspekte darzubieten.
Wir wollen nun die charakteristischen Züge der Lehre Dom Marmions herausstellen. Nach seiner Auffassung, die mit der des hl. Paulus übereinstimmt, ist das Leben des Priesters wie das des Christen überhaupt ganz von Christus beherrscht, vollzieht sich in ständiger Abhängigkeit von seinen Verdiensten, seiner Gnade, seinem Wirken. Aus dieser Perspektive muss die Würde des Priesters und seine Heiligung verstanden werden. Der Priester empfängt seine übernatürlichen Vollmachten von einem Priestertum, das hoch über ihm steht: vom Priestertum des menschgewordenen Wortes selbst. Und diese Vollmachten kann er nur in völliger Unterordnung unter den ewigen Hohenpriester ausüben. Deshalb sind die dem Priester eigentümlichen Tugenden eine Darstellung jener des göttlichen Vorbildes; sie sind für die Menschen ein Widerschein der Tugenden Jesu. Der Priester ist in allen seinen Handlungen - bei den Kultakten, bei der Verwaltung der Sakramente, in seinem apostolischen Eifer, in seiner privaten Frömmigkeit, bei seinen täglichen Beschäftigungen - der Diener des Erlösers, ein Alter Christus.
Darum gilt für ihn noch mehr als für den einfachen Christen, dass seine Heiligung nur ein Ausfluss der Heiligkeit Christi sein kann; Christus muss alles für ihn sein, das Alpha und das Omega.
Bei der Ausführung der vorliegenden Arbeit sind wir mit der größten Ehrfurcht vor den tiefen und klaren Gedankengängen des verehrten Abtes, des Gelehrten und Seelenführers, vorgegangen. Es wurde Wert darauf gelegt, seinen Stil beizubehalten, die einfache und klare Form, die persönliche und familiäre Ausdrucksweise bis zur Verwendung der Worte, die er besonders bevorzugte.
Leser, denen die Lehre Dom Marmions schon bekannt ist, werden hier Gegenstände wieder finden, die bereits in früheren Werken behandelt wurden: Christus als Vorbild und Quelle der Heiligkeit; der Glaube; die Liebe; das Messopfer; das Gebet. Hätten wir in diesem Buch solche Gegenstände übergehen und auf frühere Schriften verweisen sollen? Das hätte nicht nur zerstreuend gewirkt, sondern wäre auch eine Entstellung der Lehre des Meisters gewesen. Die Heiligung des Priesters kann sich tatsächlich nicht ohne die Verbindung mit Christus und seiner Gnade vollziehen, nicht ohne die Tugenden, vor allem die christlichen Tugenden: Glauben, Demut, Eifer, nicht ohne das eucharistische Opfer und das Gebet. Deshalb schien uns eine Wiederholung dieser Gegenstände gerechtfertigt; doch sollten sie hier unter dem Gesichtspunkt des Priestertums behandelt werden. Wir gaben uns Rechenschaft, dass es einerseits unerlässlich sei, die Grundbegriffe zu wiederholen, dass aber andererseits von ausführlichen Darlegungen abgesehen werden sollte, die sich bereits in früheren Schriften finden. Diese Lösung, durch die zugleich die Fülle der Doktrin des verehrten Meisters und die Einheitlichkeit des Buches gewahrt wird, drängte sich als die einzig mögliche auf. Wir sind sicher, dass auch die Leser dieses Vorgehen billigen werden.
Wenn Dom Marmion Priesterexerzitien hielt, ging es ihm nicht darum, besondere theologische Meinungen vorzutragen oder eine Reihe von Weisungen für die Seelsorge zu geben oder zu einer ins einzelne gehenden Gewissenserforschung anzuleiten; er suchte vielmehr - nicht ausschließlich, aber doch vor allem - seine Hörer in die Atmosphäre lebendigen, erleuchteten, durch die Betrachtung genährten Glaubens einzuführen, in der seine eigene Seele lebte. Durch die Glut seiner Überzeugung und seinen mitreißenden Eifer vermochte er den Priestern eine größere Gewissheit der unsichtbaren Wirklichkeiten zu geben, in deren Bereich sich ihre Tätigkeit entfaltet. Er vermittelte ihnen jenen geistigen Schwung, der von allem rein Gewohnheitsmäßigen und aller Mittelmäßigkeit befreit. Er weckte in ihnen die hochherzige Bereitschaft, sich immer enger an Christus anzuschließen und in ihrem ganzen Tagewerk dem inneren Leben den Vorrang einzuräumen. Hier geht er - wie überall auf das Wesentliche; und auf dieses Wesentliche hat unser Oberhirte, Seine Heiligkeit Pius XII., mehrmals, besonders aber in seiner Mahnung vom 23. September 1950, Mentt nostrae, eindringlich hingewiesen.
«Christus, das Ideal des Priesters» setzt dieses Apostolat nur fort. Jedes Kapitel möchte den Leser in diese übernatürliche Atmosphäre führen, ihn besser die Bedeutung eines Lebens erkennen lassen, das durch Christus mit Gott verbunden ist.
Man wird auf diesen Seiten den ganzen Dom Marmion wieder finden: seine gründlichen dogmatischen Kenntnisse, die Klarheit seiner Lehre - «die reine Lehre der Kirche». sagte Papst Benedikt XV. von ihr -, seine gründliche Kenntnis der Heiligen Schrift, besonders die häufige Verwendung von Johannes und Paulus, seine große Seelenkenntnis, die wohltuende Wärme und Weihe seiner Sprache. Ein echt priesterliches Herz, eine große Christusliebe will sich da mitteilen.
Deshalb, vor allem aber wegen der Gedankenfülle und der Eigenart der bisher unveröffentlichten Skizzen, wird dieser Band unweigerlich seinen Platz neben den vorhergegangenen einnehmen; er wird sie vervollständigen und krönen. Mit ihnen zusammen wird er das vollständige corpus asceticum von Dom Marmion bilden, dessen Mittelpunkt Christus ist. Von nun an wird die so lebensvolle Botschaft dieses Meisters des geistlichen Lebens in ihrer Gesamtheit zugänglich sein.
Viele Seelen widmen sich in der Verborgenheit des Klosters durch ein Leben des Gebetes und des schweigenden Opfers der Heiligung der Priester. Dieses Buch möchte ihnen die Erhabenheit des Priestertums und die hohen Forderungen priesterlicher Heiligkeit vor Augen stellen und ihnen so helfen, ihre Aufgabe zu vollbringen - ein ganz verborgenes, aber überaus fruchtbares Wirken im Dienste der Kirche Christi.
Wir möchten dieses Vorwort abschließen mit einem Zitat, dem schon auf Grund der Würde seines Autors, des Kardinals Suhard, besonderer Wert zukommt.
Der Erzbischof von Paris, dessen Hinscheiden allgemein betrauert wurde, hat bekanntlich auf die Gegenwartsnöte der Seelen - der Priester und der Gläubigen - hingewiesen. Seine Schrift «Le prêtre dans la Cité» ist noch in allgemeiner Erinnerung.
Kardinal Suhard war ein großer Verehrer von Dom Marmion und wünschte dringend die Veröffentlichung des nun vorliegenden Bandes; er war überzeugt, dass dadurch viel Nutzen gestiftet werden würde. Anlässlich des 25. Todestages des ehemaligen Abtes von Maredsous (1947) richtete der Kirchenfürst an den Unterzeichneten die Worte: «Die geistliche Lehre Dom Marmions bietet eine katholische Synthese, tief menschlich und übernatürlich zugleich, den Bedürfnissen unserer Zeit und der gegenwärtigen Richtung der katholischen Frömmigkeit völlig entsprechend ... Doch Dom Marmion hat sein irdisches Werk nicht beendet, oder vielmehr, er hat es beendet, doch es ist noch nicht der Allgemeinheit zugänglich. Von Ihnen erwarten wir das Werk «Christus, das Ideal des Priesters» ... Wenn Sie den Priestern, an die wir denken, diese Reichtümer, die der verehrte Dahingeschiedene der benediktinischen Familie hinterlassen hat, allgemein zugänglich machen wollten, würden alle Hirten der Kirche, angefangen vom Erzbischof von Paris, den Abt von Maredsous dazu beglückwünschen und sich im Hinblick auf ihren Klerus glücklich schätzen.»
Nun überreichen wir das Buch, das der hervorragende Prälat so sehr wünschte, vertrauensvoll den Dienern Christi. Möge seine Lektüre die Priester anspornen, tagtäglich nach der Heiligkeit zu streben, die ihre erhabene Berufung fordert.
Abtei Maredsous, den 16. Juni 1951,
Alle Fußnoten, sowohl die bibliographischen wie auch jene, die den Gedankengang Dom Marmions unterstreichen wollen, stammen von uns. - Dom Marmion zitierte bei Priesterkonferenzen die Heilige Schrift fast immer lateinisch; zuweilen griff er auf den griechischen Text zurück. Um den Lesern, die der lateinischen Sprache nicht mächtig sind, die Lektüre zu erleichtern, haben wir entweder anstelle des lateinischen Textes einfach die Übersetzung geboten, oder nach Anführung des lateinischen Zitates mit seinem charakteristischen Wortlaut den Sinn wiedergegeben. - Zu den allgemein bekannten Texten aus dem Ordo missae haben wir keine Erläuterung gegeben.
Es drängt uns, allen jenen zu danken, die an den technischen Vorbereitungen dieser Veröffentlichung mitgearbeitet haben. Auch sie haben ihren Teil zu den segensreichen Wirkungen beigetragen, die von dem Buch ausgehen werden.
ERSTER TEIL: CHRISTUS, DER URHEBER UNSERES PRIESTERTUMS UND UNSERER HEILIGKEIT
I. DAS PRIESTERTUM CHRISTI
1. Die Verherrlichung Gottes
Paulus betont, dass die völlige Abhängigkeit des Geschöpfes vom souveränen Gott den Menschen verpflichtet, die göttliche Majestät zu verherrlichen: «Aus ihm und durch ihn und für ihn ist alles. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen» (Röm 11,36).
Gott bereitet sich selbst einen unendlich vollkommenen Lobpreis. Der Lobgesang der Engel und des Universums kann dem nichts hinzufügen.
Doch Gott verlangt, dass seine Geschöpfe an der Verherrlichung teilnehmen, die sich in seinem Innern vollzieht. Die Ehre, die der Mensch dem Herrn erweisen soll, übersteigt nach den Absichten Gottes die Möglichkeiten der Naturreligion; sie erhebt sich bis zur allerheiligsten Dreifaltigkeit durch das Priestertum Jesu Christi, des einzigen Mittlers zwischen Himmel und Erde.
Es ist das herrliche Vorrecht des Priesteramtes Christi und seiner Priester, dem dreifaltigen Gott im Namen der Menschheit und des Universums eine würdige Huldigung darzubringen. Die Bedeutung dieses Priestertums liegt darin, dass es die Heimkehr der gesamten Schöpfung zu dem Herrn aller Dinge im wesentlichen sichert.
Betrachten wir nun mit der Ehrfurcht, die ein lebendiger Glaube einflößt, das Geheimnis dieser Verherrlichung im Innern des Dreifaltigen: wie Gott selbst ist sie ohne Anfang und ohne Ende, «wie im Anfang so auch jetzt und allezeit». Sie ist das vollkommene Vorbild für den Lobpreis der Menschen und der Engel. Wir sind dazu berufen, auf der Erde und im Himmel daran teilzunehmen. Das ist unsere erhabene Aufgabe.
Worin besteht aber die Verherrlichung, die die göttlichen Personen einander erweisen ?
Gott ist seinem Wesen nach nicht nur groß, sondern auch «Gegenstand allen Lobpreises» (Ps 48,1). Es ist eine innere Notwendigkeit, dass er die Ehrung empfängt, die seiner Majestät entspricht; es geziemt sich, dass er in sich selbst verherrlicht sei durch einen Lobpreis, der unendlich ist wie seine Macht, seine Weisheit und seine Liebe. Gott hätte den Schöpfungsakt unterlassen können; er hätte ohne uns in der unaussprechlich seligen Vereinigung des Lichtes und der Liebe bleiben können, in der die göttlichen Personen einander angehören.
Der Vater zeugt von Ewigkeit her den Sohn und verleiht ihm das höchste aller Güter: das Leben und die Vollkommenheit der Gottheit; er teilt ihm alles mit, was in ihm ist, ausgenommen die ihm allein eigene Vaterschaft.
Als vollkommenes, wesenhaftes Bild des Vaters ist das Göttliche Wort «der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters» (Hebr 1,3). Aus dem Quell des Lichtes hervorgegangen, ist es selbst Licht; sein Wesen ist ein unaufhörlicher Lobpreis dessen, aus dem es hervorgeht: «Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein» (Joh 17, 10).
Auf Grund der natürlichen Hinordnung des Sohnes auf den Vater lässt er alles zum Vater zurückfluten, was er von ihm empfängt.
In diesem gegenseitigen Schenken geht der Heilige Geist, der die Liebe ist, aus der Liebe des Vaters und des Sohnes als seinem einzigen Ursprung hervor. Dieses Einswerden der drei Personen in unendlicher Liebe vollendet die ewige Lebensverbindung im Schoß der Dreieinigkeit.
Kann man in dieser unendlichen Verherrlichung einen priesterlichen Akt sehen? Nein.
Vater, Sohn und Heiliger Geist sind gleich an Macht, an Ewigkeit, an Majestät. Es kann keine Unterordnung, keinen Gradunterschied bei ihnen geben. Im Begriff des Priestertums aber liegt der Gedanke des Gradunterschiedes: der Priester demütigt sich, wenn er Gott eine Huldigung darbringt; gerade dadurch, dass er sich Gott unterwirft, kann er die Aufgabe eines Mittlers zwischen Gott und den Menschen erfüllen. Da aber die göttlichen Personen völlig wesensgleich sind, kann nicht die eine der andern Verehrung erweisen. In der innergöttlichen Verherrlichung der Trinität ist keine priesterliche Handlung denkbar. Deshalb kommt das Priestertum Christi nicht dem Ewigen Wort zu, sondern seiner heiligen Menschheit. Das Wort ist nur auf Grund seiner Menschwerdung Priester; sein Priestertum ist ein Vorrecht seiner Menschheit.
2. Die Priesterweihe Christi
Worin besteht das Wesen des Priestertums?
Der Hebräerbrief charakterisiert es mit folgenden Worten: «Jeder Hohepriester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen in ihren Angelegenheiten bei Gott bestellt. Er soll Gaben und Opfer für ihre Sünden darbringen» (Hebr 5, 1).
Der Priester ist der Mittler, der Gott im Namen des Volkes Gaben und Opfer darbringt. Gott hingegen erwählt ihn, um den Menschen seine Gaben mitzuteilen: Gnade, Barmherzigkeit, Verzeihung. Die besondere Erhabenheit des Priestertums hat ihren Grund in dieser Vermittlung.
Woher empfängt Christus sein Priestertum? Paulus antwortet darauf, das Priestertum besitze einen solchen Adel dass niemand, nicht einmal Christus in seiner Menschheit diese Würde an sich reißen durfte. «Und keiner nimmt sich eigenmächtig diese Würde, sondern er wird von Gott berufen ... So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde eines Hohenpriesters verliehen.» Dann fährt er fort «Der Vater selbst hat seinen Sohn zum ewigen Priester eingesetzt; er sprach zu ihm: Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt ... Du bist Priester auf ewig» (Hebr 5, 4-6)
So ist das Priestertum ein Geschenk des Vaters an die Menschheit Jesu. Seit das Wort Fleisch geworden ist, betrachtet der ewige Vater seinen Sohn mit unendlichem Wohlgefallen. Er sieht in ihm den einzigen Mittler zwischen Himmel und Erde, den ewigen Hohenpriester.
Als Gottmensch besitzt Christus das Vorrecht, die ganze Menschheit in sich zu vereinigen, um sie zu läutern, zu heiligen und in den Schoß der Gottheit zu führen. Dadurch erweist er dem Herrn in der Zeit und in der Ewigkeit eint vollkommene Verherrlichung.
Schon im Augenblick der Menschwerdung wurde der Sohn Gottes zum Mittler und Hohenpriester eingesetzt. Er bedurfte nicht wie die andern Priester einer äußeren Salbung zu seiner Weihe. Der Seele Jesu wurde nicht das «unauslöschliche Merkmal des Priestertums» eingeprägt wie uns am Tag unserer Priesterweihe. Warum? Hier rühren wir an das Innerste des Geheimnisses. Durch die hypostatische Union durchdringt und besitzt das Ewige Wort die Seele und den Leib Jesu, heiligt sie. Als der Sohn Gottes Fleisch annahm, hat er sich völlig dieser Menschheit bemächtigt. Die Priesterweihe Jesu erfolgte im Augenblick seiner Menschwerdung; damals wurde Jesus für immer und ewig zum einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen eingesetzt. «Dein Gott hat dich mit Freudenöl gesalbt» (Hebr 1,9), sagt Paulus von ihm, denn das Ewige Wort selbst war diese unendlich heilige Salbung.
Jesus ist der Priester. «So sollte unser Hoherpriester beschaffen sein: heilig, schuldlos, rein . .. über die Himmel erhoben» (Hebr 7, 26). Bis ans Ende der Zeiten werden die Priester hienieden keine Vollmacht zum Mittleramt empfangen, die nicht ein Teil der seinen ist; er ist der einzige Ursprung allen Priestertums, das Gott verherrlicht, so wie er es verlangt.
Um noch tiefer in das Geheimnis dieser wunderbaren Priesterweihe einzudringen, betrachten wir die Erscheinung des Engels in Nazareth.
Maria betet; sie ist voll der Gnade. Der Engel, der als Abgesandter zu ihr kommt, überbringt ihr die Botschaft, das Ewige Wort habe ihren Schoß zum Brautgemach erwählt, in dem es sich mit der Menschheit vermählen wolle: «Der Heilige Geist wird über dich kommen.» Und Maria antwortet: «Mir geschehe nach deinem Wort» (Lk 1, 35.38). In diesem Augenblick wurde der erste Priester geweiht und der Vater im Himmel spricht zu ihm: «Du bist Priester ewiglich nach der Ordnung des Melchisedech» (Ps 109, 4).
Damals wurde Maria wirklich das goldene Haus, die Arche des Bundes, das Zelt, in dem sich die menschliche Natur mit dem Ewigen Wort vereinigte; und durch eben diese Vereinigung wurde Jesus für immer die Mission des Mittlers übertragen.
3. Das einzigartige Vorrecht des Priestertums Christi : Priester und Opfergabe
Wie wir wissen, unterschied man im Alten Bund den Opferpriester und die Opfergabe. Im Sühnopfer z. B. tötete der Opferpriester ein Lebewesen, das als Stellvertreter des Volkes betrachtet wurde; er breitete seine Hände über die Opfergabe aus und belud sie durch diese Geste mit den Sünden aller. Ein anderer war der Priester, ein anderes war das Opfer, das Gott dargebracht wurde.
Im Opfer Jesu ist es nicht so.
Sein Priestertum besitzt ein wunderbares Vorrecht: sein Opfer auf Kalvaria wie auf unseren Altären ist göttlich sowohl durch die Würde des Priesters als auch durch die Erhabenheit der Opfergabe. Opferpriester und Opfergabe sind in derselben Person vereint, und dieses Opfer ist die vollkommenste Huldigung, durch die Gott verherrlicht wird; sie stimmt den Herrn gnädig gegen die Menschen und erlangt für sie die Gnade des ewigen Lebens.
Das «Es ist vollbracht», das Christus sterbend sprach, ist zugleich der letzte Ausdruck der Liebe des Opfers, das volle Sühne leistete, und die feierliche Bestätigung des Priesters, der den höchsten Akt seines Priesteramtes vollbracht hat.
Betrachten wir die Gesinnung, von der Jesus als Opferpriester und als Opfergabe beseelt war.
Die Haltung Christi, des Priesterkönigs, war tiefste Ehrfurcht und Anbetung. Der Ursprung dieser Haltung war die Schau, die Jesus von der unvergleichlichen Majestät seines Vaters besaß, «Vater unermesslicher Majestät» (Hymnus «Te Deum»). Er kannte den Vater, wie kein Geschöpf ihn jemals zu erkennen vermag: «Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt» (Joh 17,25).
Die Tiefen der göttlichen Vollkommenheit lagen offen vor seinem Blick: die absolute Heiligkeit des Vaters, seine Gerechtigkeit, seine unendliche Güte. Diese Schau erfüllte ihn mit jener tiefen Ehrfurcht und Frömmigkeit, die Wesenszüge des Opferpriesters sein sollen.
Welches war die Grundeinstellung in Jesus, der Opfergabe? Auch hier war es die Anbetung, aber sie bekundet sich in der Annahme der Vernichtung und des Todes. Jesus wusste, dass er dazu ausersehen war, am Kreuz den Nachlass der Weltschuld zu erwirken. Er stand vor der göttlichen Gerechtigkeit, beladen mit der erdrückenden Last aller Sünden. Und er willigte voll und ganz ein, Schlachtopfer zu sein. Er empfand nicht Reue wie ein Sünder, der seine eigene Schuld beweint. Doch oft kam eine unendliche Traurigkeit über ihn im Wissen um die Last der Sünden, die ihm auferlegt war. So ist auch sein Wort am Ölberg zu verstehen: «Meine Seele ist zu Tode betrübt.»
Die Besinnung des, Schlachtopfers steht im Einklang mit der des Priesters.
Wir dürfen die Pläne des Ewigen nicht mit unserer menschlichen Kurzsichtigkeit beurteilen; betrachten wir sie so, wie Gott sie entwarf und offenbarte. Forschen wir nicht, was Gott in seiner Allmacht hätte vollbringen können; halten wir uns vielmehr an das, was er tatsächlich tun wollte. Er hätte die Sünden vergeben können, ohne eine Sühneleistung zu fordern, die mit der Größe der Beleidigung im rechten Verhältnis stand; doch seine Weisheit bestimmte, dass das Heil der Welt durch das Sterben Christi gewirkt werde. Ohne Vergießen des Blutes Jesu gibt es für uns keine Vergebung. «ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung» (Hebr 9, 22).
So nahm der Sohn Gottes bei seinem Eintritt in diese Welt den «Leib eines Schlachtopfers» an, der leidensfähig und sterblich war. Er gehörte wirklich zu unserm Geschlecht, wurde uns gleich; und im Namen seiner Brüder brachte er sich als Sühnopfer dar, um sie mit dem Vater im Himmel zu versöhnen.
Tertullian schrieb das Wort: «Niemand ist so sehr Vater wie Gott, keine Güte ist der seinen zu vergleichen» (De poenitentia, 8. P. L. I. Sp. 1353). Wir können auch sagen: «Niemand ist so sehr Bruder wie Jesus.» Wie Paulus sagt, ist Christus nach ewiger Vorherbestimmung «der Erstgeborene unter vielen Brüdern» (Röm 8, 29); «darum schämt er sich auch nicht, sie (die Menschen) Brüder zu nennen» (Hebr 2, 11). Wie sagte doch
Christus nach seiner Auferstehung zu Magdalena? «Geh zu meinen Brüdern und künde ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater» (Joh 20,17). Und welch ein Bruder war Christus! Ein Gott will unsere Schwachheiten teilen, unsere Traurigkeit und unsere Schmerzen fühlen. Aus eigener Erfahrung lernte er, Mitgefühl mit unsern Leiden zu haben. «Wir haben keinen Hohenpriester, der unsere Schwachheiten nicht mitempfinden könnte, sondern einen, der in allem ebenso geprüft worden ist wie wir, die Sünde ausgenommen» (Hebr 4, 15).
4. Die priesterlichen Handlungen Jesu
A. Ecce venio
Das ganze Leben Jesu war als das des höchsten Priesters der Verherrlichung Gottes und dem Heil der Menschen geweiht. Dieses Priestertum erreichte seinen Höhepunkt im Abendmahlssaal und auf Kalvaria. Doch das ganze Leben des Erlösers hat priesterlichen Charakter.
Die erste Regung seiner heiligen Seele im Augenblick der Menschwerdung war ein erhabener Akt der Gottesverehrung. Die Evangelisten haben uns das Geheimnis dieser priesterlichen Aufopferung nicht enthüllt; doch der hl. Paulus, der Künder der Geheimnisse Gottes und Christi, wusste darum: «Bei seinem Eintritt in die Welt spricht er: Schlacht- und Speiseopfer willst du nicht, einen Leib aber hast du mir geschaffen. An Brand- und Sühnopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu erfüllen, o Gott, wie in der Buchrolle von mir geschrieben steht» (Hebr 10, 5-7). Um die absolute Oberherrschaft seines Vaters anzuerkennen, hat Christus sich ihm vorbehaltlos aufgeopfert. Diese Hinopferung war seine Antwort auf die unvergleichliche Gnade der hypostatischen Union; sie war ein priesterlicher Akt, ein Vorspiel des Erlösungsopfers und aller Akte seines Priesteramtes im Himmel. Niemals können wir uns genug in diesen Text versenken, der uns Einblick in das priesterliche Innenleben Jesu gibt.
«Bei seinem Eintritt in die Welt» betrachtete seine Seele, im Licht des Ewigen Wortes stehend, die Gottheit; und in dieser erhabenen Schau erfasste sie die unendliche Majestät des Vaters. Gleichzeitig sah Jesus die furchtbaren Beleidigungen, die Gott durch die Sünde zugefügt werden, und die Unzulänglichkeit aller Opfergaben, die ihm bis dahin dargebracht worden waren. Er erkannte, dass Gott, als er ihm seine Menschheit gab, diese dazu bestimmte, ihm als Sühnopfer dargebracht zu werden, und dass er selbst der Opferpriester sei.
Und in unaussprechlicher Liebe übergab er sich dem Vater rückhaltlos, dass er nach seinem Wohlgefallen über ihn verfüge.
In diesem Augenblick hielt wohl der ganze Himmel gleichsam den Atem an, da er die erstmalige Hingabe der Menschheit Jesu betrachtete.
Obwohl die Menschheit Jesu makellos war, gehörte sie doch dem Geschlecht der Sünder an : «in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht» (Röm 8, 3); und da der Erlöser einwilligte, die Sünden der Welt zu tragen, nahm er zugleich die Art der Hinopferung an. Deshalb spricht er: «Vater, die mosaischen Schlachtopfer waren in sich deiner unwürdig». «Siehe, ich komme. Nimm mich hin als Schlachtopfer. Du hast mir einen Leib gegeben, durch den ich mich hinopfern kann. Zermalme ihn, zerbrich ihn, überhäufe ihn mit Leiden, kreuzige ihn; ich nehme alles an: Ich komme, deinen Willen zu erfüllen.»
Beachten wir die Worte: «Du hast mir einen Leib gegeben.» Christus weist damit darauf hin, dass sein Leib nicht verherrlicht und leidensunfähig war wie nach seiner Auferstehung, nicht einmal verklärt wie auf dem Tabor. Er hatte vom Vater einen Leib angenommen, der der Müdigkeit, dem Schmerz, dem Tod unterworfen war, wie der unsere fähig, jede Misshandlung und jedes Leiden zu ertragen. «Vater, ich nehme diesen Leib so an, wie du ihn für mich ausgewählt hast.»
Jesus weiß, dass «am Anfang seines Lebensbuches für ihn eine Verfügung Gottes eingeschrieben stand, die seine Hinopferung forderte». Er überlässt sich ihr ohne Vorbehalt: «Ja, ich komme - so steht es über mich in der Schriftrolle -, um deinen Willen, Gott, zu tun» (Hebr 10, 7).
Dieser Wille, den Vater zu verherrlichen, seiner Gerechtigkeit Genugtuung zu leisten und sich für unser Heil hinzugeben, war unerschütterlich; er war stets die Grundhaltung seines Herzens. Das ganze Leben Jesu - angefangen von diesem Augenblick bis zu der Stunde, da er sich am Kreuz als Sühnopfer darbrachte - war eine ständige Offenbarung dieser Gesinnung. Der Schatten des Kreuzes lag über seinem ganzen Leben. Schon im voraus erlebte er alle Einzelheiten des großen Dramas: die Undankbarkeit des Judas, den Spott des Herodes, die Feigheit des Pilatus, die Geißelung, die Schmach der Kreuzigung.
Als der Erlöser einmal nach Jerusalem wanderte, unterhielt er sich mit seinen Jüngern über den Menschensohn. Und was sagte er von ihm? «Er wird den Heiden ausgeliefert, verspottet, misshandelt und angespien werden» (Lk 18,32).
Ähnlich am Tabor. Christus zeigt sich seinen staunenden Jüngern in der Herrlichkeit seiner heiligen Menschheit, vom Lichtglanz der Gottheit verklärt. «Und zwei Männer redeten mit ihm: Moses und Elias.» Und worüber sprachen sie? Lukas berichtet es uns. Sie sprachen von dem Leiden, das ihm in Jerusalem bevorstand (Lk 9, 31). Im Erdenleben Jesu bildet eben das Leiden den Höhepunkt.
In seinem Sterben war Jesus der Vertreter der ganzen Menschheit, und in dem einmaligen Kreuzesopfer, das er freiwillig auf sich genommen - im Augenblick der Menschwerdung schon -, hat er uns alle gerettet und geheiligt. Dies ist der Sinn des Wortes, das Paulus dem bereits zitierten Text anfügt: « Kraft dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt» (Hebr 10, 10).
B. Das Abendmahl
Die Hinopferung, die Jesus vollzog, als er sein «Siehe, ich komme» sprach, war ohne Zweifel unwiderruflich und ist bewunderungswürdig; doch erst im Abendmahlssaal und am Kreuz vollbrachte der Erlöser die eigentliche priesterliche Handlung. Hier, wo er dem Vater sein Opfer darbietet, zeigt er sich uns in der ganzen Majestät und Macht seines Hohenpriestertums.
Wohnen wir im Geist am Abend des Gründonnerstags dem Abschiedsmahl, dem Liebesmahl im Abendmahlssaal bei, wo Jesus Brot und Wein weiht. Vor seinem Leiden opfert er in einem neuen Ritus, der ein Bild der nahen Opferhingabe ist, seinen Leib und sein Blut. Die Worte, die er dabei über Brot und Wein spricht, lassen keinen Zweifel am Sinn dieses Aktes. Es handelt sich um »seinen eigenen Leib, der dahin gegeben wird», um »sein Blut, das Blut des Neuen Bundes, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden». Dieses Opfer wurde dem Vater dargebracht. Das [Konzil von Trient]] erklärt: »Beim letzten Abendmahl bezeichnet er sich selbst als Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedech, indem er dem Vater seinen Leib und sein Blut unter den Gestalten des Brotes und Weines opfert (Sess. XXII, c. 1.).»
Auf unsern Altären ist Christus ebenso wie im Abendmahlssaal Priester und Opfergabe; er gibt noch immer sich selbst zur Nahrung; doch bei der Heiligen Messe bedient Christus sich der Vermittlung seiner Priester, während er beim letzten Abendmahl keines Menschen Dienst in Anspruch nimmt. Als höchster Priester stiftet er aus eigener Machtvollkommenheit drei wunderbare übernatürliche Institutionen und hinterlässt sie seiner Kirche: das Messopfer, das allerheiligste Sakrament des Altares, das in engster Verbindung mit dem Messopfer steht, und unser Priestertum, das seinen Ursprung in dem seinen hat und bestimmt ist, bis ans Ende der Zeiten das Werk seiner Allmacht und seines Erbarmens fortzusetzen.
Die Messliturgie entspringt also unmittelbar dem Herzen Christi. Als er Brot und Wein in seine Hände nahm, sagte er seinem Vater Dank (Mt 26, 27). Die Danksagung gehörte sicher zum Ritus des Passahmahles; aber dürfen wir nicht mit Recht annehmen, Jesus habe in diesem feierlichen Augenblick dem Vater nicht nur für alle die Wohltaten gedankt, die er in der Vergangenheit dem auserwählten Volk erwiesen, sondern auch für alle jene, die er im Neuen Bund spenden würde? Er sah die unzählbaren Scharen der Christen, die sich dem Tisch des Herrn nahen, die sein anbetungswürdiges Fleisch essen und sein kostbares Blut trinken würden. Er dankte dem Vater für alle Hilfe, die er seinen Gliedern, und vor allem seinen Priestern, bis ans Ende der Zeiten gewähren wollte. Vergessen wir nicht, dass es der Vater ist, von dem wir durch Jesus alle Gaben empfangen: »jede gute Gabe … kommt von oben, vom Vater der Gestirne« (Jak 1, 17). So dankt Jesus insbesondere für das kostbare Geschenk des Priestertums und der Eucharistie.
Dieser Akt der Dankbarkeit, den der Erlöser in seinem Namen und im Namen aller seiner Glieder vollzieht, erweist dem Vater eine unendliche Verherrlichung.
C. Das Kreuzesopfer
Steigen wir hinauf nach Kalvaria und betrachten wir das blutige Opfer Jesu.
Was sehen wir? Jesus ist da, umringt von einer großen Menschenmenge: gleichgültige Soldaten, lästernde Pharisäer, hasserfüllte Henker, und schließlich die kleine Gruppe der Getreuen um Maria. «Lasst uns aufschauen zu Jesus, dem Anführer und Vollender des Glaubens» (Hebr 12, 2). Dieser Gekreuzigte ist der wahre Gott, unser Gott.
Die Grundlage unseres geistlichen Lebens ist der Glaube an die Gottheit Jesu Christi: «Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben» (Joh 3, 36). Der Mensch, der mit Nägeln an das Holz des Kreuzes geheftet ist, ist das Ebenbild des Vaters. «Gleichen Wesens mit dem Vater ... Licht vom Licht.» Doch da er unsere Menschennatur annahm, ist er unser Bruder geworden.
Was tut er in diesem Augenblick höchster Qual? Welche Tat vollbringt er ?
Wir wissen, dass alle Handlungen des Gottmenschen im vollen Sinn des Wortes gottmenschlich sind; sie haben ihren Ursprung gleicherweise in Gott und im Menschen. Die Würde der Person des Göttlichen Wortes verleiht den menschlichen Handlungen Christi göttlichen Wert: «Der Akt ist der Person eigen - Actio est suppositi»; - hier aber ist die Person göttlich. Jeder seiner Seufzer, jeder Tropfen seines Blutes besitzt hinreichenden Sühnewert, um die Sünden der Welt gutzumachen. Aber nach den Beschlüssen der Ewigen Weisheit wollte der Vater, dass der Sohn uns rette durch den höchsten Akt der Gottesverehrung: das Opfer. Deshalb sagt der Apostel: «Christus hat sich für uns als Opfergabe hingegeben, Gott zum lieblichen Wohlgeruch» (Eph 5, 2).
Das Opfer Christi war in hervorragender Weise ein Versöhnungsopfer. Wegen der unendlichen Würde seiner göttlichen Person und der Grenzenlosigkeit seiner menschlichen Liebe erwies er dem Vater eine Huldigung, die in höherem Maße sein Wohlgefallen fand, als die Bosheit der Welt sein Missfallen erregt hatte. In den Augen des Herrn hat die Hinopferung seines Sohnes solch unvergleichlichen Wert, dass dagegen unsere ihm zugefügten Beleidigungen nicht ins Gewicht fallen. Nach einem kühnen Wort des hI. Paulus hat Jesus uns der Gerechtigkeit des Vaters entrissen und die Schuldschrift, die uns mit ihrer Anklage belastete, ausgelöscht und vernichtet. «Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen … Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat» (Kol 2, 14). Die Haltung Gottes uns gegenüber hat sich geändert: wir waren «Kinder des Zornes» (Eph 2, 3), jetzt aber ist der Herr gegen uns «reich an Erbarmen» (Eph 2, 3-4).
Das hat Jesus, unser Bruder, für uns getan. Wenn wir die Größe dieser Liebe erfassten, wie würden wir uns doch mit seinem Opfer vereinigen, mit dem Apostel sprechend: «Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben» (Gal 2,20). Er sagt nicht: «er hat uns geliebt», sondern «er hat mich geliebt», mich persönlich, für mich hat er dies alles getan!
Es ist klar: was Gott von Jesus verlangt, was den Wert seines Opfers ausmacht, ist nicht das Blutvergießen an sich, sondern dieses Blutvergießen, insofern es Ausdruck der Liebe und des Gehorsams war.
Gott hat bei seinen Plänen die Eigenart unserer menschlichen Natur berücksichtigt. Für uns Menschen aber ist keine größere Liebe denkbar als jene, die sich in der Hingabe des Lebens offenbart, in der Hingabe seiner selbst in den Tod: «Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt» (Joh 15, 13). Jesus betont selbst, welche Bedeutung der Liebe in seinem Leiden zukommt: «Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater mir aufgetragen hat» (Joh 14,31).
Und er wollte uns auch wissen lassen, dass er sein Opfer im Gehorsam vollbrachte. Als Jesus am Ölberg Todesangst litt, bat er dreimal den Vater, der Kelch möge vorübergehen. Doch da der Himmel unerbittlich schwieg, unterwarf sich der Erlöser freiwillig und machte liebend seinen menschlichen Willen dem Willen des Vaters gleichförmig: «Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen» (Lk 22, 42). Paulus konnte von Jesus sagen: «Er ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuze» (Phil 2, 8). Isaias hatte vorausgesehen, dass der Erlöser das Leiden freiwillig annehmen werde: «Er hat sich ausgeliefert, weil er selbst es wollte» (Jes 53, 7).
Mögen die Sünden der Welt noch so zahlreich und noch so schwer sein, die Genugtuung, die unser göttlicher Meister geleistet hat, übertrifft sie stets. Das bestätigt ein Pauluswort, in dem wir die Schauer der Bewunderung vor diesem Geheimnis verspüren: «Wo aber die Sünde zugenommen hatte, wurde die Gnade überschwänglich» (Röm 5, 20).
Wie das Opfer Christi für die Sünde Genugtuung leistet, so ist es auch ein verdienstlicher Akt, der uns alle Gnaden erwirbt. Was verstehen wir unter «verdienstlich»? Verdienstlich ist eine Handlung, die einer Belohnung wert ist. Wenn der Christ im Stand der Gnade eine gute Tat vollbringt, so erwächst ihm daraus kraft einer göttlichen Verheißung das Anrecht auf neue Gnaden; er verdient sie und dieses Recht kommt ihm persönlich zu.
Doch wenn Christus als Erlöser und Haupt des mystischen Leibes dem Vater sein Leiden aufopfert, beschränkt sich dessen verdienstlicher Wert nicht auf die Person Jesu, sondern kommt allen Menschen zu, die er erlöste und deren Haupt er ist. Seine Verdienste sind so ganz unser eigen, dass wir in ihm «reich an allem geistlichen Segen» (Eph 1, 3 ; vgI. 1 Kor 1, 5) geworden sind. Unser Reichtum in Jesus Christus ist so groß, dass man ihn nicht durchforschen kann; «unergründlich» nennt St. Paulus ihn: «den unergründlichen Reichtum Christi verkündigen» (Eph 3, 8).
Lebendiger Glaube, grenzenloses Vertrauen soll uns beseelen. Hat Jesus nicht gesagt: «Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben» (Joh 10,10) ?
Das Opfer Christi ist der strahlende Mittelpunkt, von dem alle Verzeihung Gottes und alle Gnaden ausgehen. Jede übernatürliche Hilfe, die dem Menschen zuteil wird, hat ihren Ursprung in der priesterlichen Hinopferung auf Golgotha. Alle Güte, die Gott uns schenkt, seine unendliche Barmherzigkeit uns gegenüber ist die Antwort auf die Verdienste Christi, die ständig für uns zum Himmel rufen. Wenn die Notschreie der ganzen Menschheit zum Himmel aufstiegen, so wäre das vergeblich: nur der Ruf des Gottessohnes gibt unserm Flehen Wert.
Doch das Drama von Kalvaria setzt sich in der Kirche fort. Unter dem Schleier des Sakramentes, bei der Wandlung, ruft das Blut Jesu noch immer zum Vater, denn in diesem Augenblick werden dem Herrn stets aufs neue die ganze Liebe, der ganze Gehorsam und alle Leiden der Hingabe am Kreuz aufgeopfert. «Jedes Mal», so sagt die Liturgie, «wenn das Gedächtnis dieses Opfers gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung» (Stillgebet am 9. Sonntag nach Pfingsten).
Obwohl das eucharistische Opfer in erster Linie vom Priestertum Christi abhängig ist, befassen wir uns jetzt nicht»ex professo» damit; wir werden es an anderer Stelle tun. Gleichwohl ist schon jetzt eine Grundwahrheit festzuhalten: wenn Gott durch das Messopfer den Menschen Gnaden gewährt, verherrlicht er seinen Sohn, weil er es um der allmächtigen Fürbitte willen tut, die das Blut des Erlösers bei ihm einlegt. Ja noch mehr: Letztlich ist es sein Sohn, dem er Barmherzigkeit erweist, denn Jesus kann sicherlich zu seinem Vater sprechen: «Vater, die Menschen sind meine Glieder; als ich starb, trug ich alle in mir; sie sind mein, so wie sie auch dein sind; alle Barmherzigkeit, mit der du sie überschüttest, hast du mir selber erwiesen.»
D. Das himmlische Priestertum
Seit seiner Himmelfahrt thront Jesus zur Rechten des Vaters, und sein Priestertum in der ewigen Herrlichkeit ist unvergänglich, wie St. Paulus sagt: «ein unvergängliches Priestertum» (Hebr 7, 24).
Ohne Zweifel bleibt das Kreuzesopfer für immer das Opfer, mit dem Christus «ein für allemal die zur Vollendung geführt hat, die sich heiligen lassen» (Hebr 10, 14). Doch um das priesterliche Leben Jesu im Himmel richtig zu verstehen, müssen wir - nach St. Thomas (S. th. III, q. 22, a. 5) - zwischen der Darbietung der Opfergabe und dem Vollzug des Opfers unterscheiden. Wenn das Opfer vollbracht ist, müssen noch seine Früchte den Anwesenden zugewendet werden. Diese Mitteilung der göttlichen Gaben erfolgt auf Grund der bereits vollzogenen Opferung und ist deren Erfüllung oder höchste Vollendung. Daher ist sie trotz ihres sekundären Charakters ein hervorragender Akt der priesterlichen Gewalt.
Wie übt Jesus nach dem Plan Gottes sein ewiges Priesteramt aus?
Der Hebräerbrief unterrichtet uns darüber. Er erinnert uns daran, dass der Hohepriester des Alten Bundes, wenn er ins Innerste des Heiligtums eintrat, symbolisch Christus darstellte. Dieser Hohepriester betrat das Allerheiligste nur einmal im Jahr, nachdem er das Schlachtopfer dargebracht und sich mit dessen Blute besprengt hatte. Auf der Brust trug er zwölf Edelsteine, die die zwölf Stämme Israels symbolisierten. So betrat mit ihm mystischerweise das ganze Volk das Heiligtum.
Dieser feierliche Einzug des Hohenpriesters ins Allerheiligste war nur Vorbild eines unendlich erhabeneren priesterlichen Aktes. Jesus ist der wahre Hohepriester, der, nachdem er hingeopfert worden war und sein Blut vergossen hatte, am Tag seiner glorreichen Himmelfahrt «einging in das wahre Zelt» in Himmelshöhen. Er ist dort für immer und ewig eingetreten, «ein für allemal» (Hebr 9, 12).
Wenn der Hohepriester in das Heiligtum eintrat, gewährte er dem Volk, das ihn begleitete, keinen Zutritt dahin. Christus aber, unser Hoherpriester, lässt uns in seinem Gefolge in den Himmel eingehen. Vergessen wir niemals die wunderbare Wahrheit, die uns der Glaube lehrt: nur durch ihn können wir in den Himmel kommen. Kein Mensch, kein Geschöpf vermag ins Paradies zu gelangen und sich dort der Anschauung Gottes zu erfreuen, außer im Gefolge Jesu, durch die Macht Jesu; dies ist der herrliche Preis seines Opfers.
Alle Auserwählten schauen Gott. Doch woher empfangen sie das Licht, in dem sie die Gottheit erkennen? Der hI. Johannes sagt es uns mehrmals in der Apokalypse: «Die Leuchte des himmlischen Jerusalem ist das Lamm» (Offb 21, 23). Alle Bewohner der heiligen Stadt wissen, dass ihnen einzig und allein die Gnaden, die ihnen aus Jesu Opfertat zugeströmt sind, den Zugang zum Vater erschlossen und ihnen die Fähigkeit, ihn zu loben, verliehen haben. Unaufhörlich singen sie: «Du hast uns erkauft durch dein Blut aus allen Stämmen, aus allen Nationen . .. und hast uns zum Königreich gemacht für unsern Gott» (Antiphon der Vesper am Allerheiligenfest. Vgl. Offb 7, 9 f.).
Der Erlöser hat als Mensch sicherlich das Recht, in das Geheimnis der Gottheit einzudringen, denn seine Menschheit ist die des Göttlichen Wortes. Doch Christus ist auch «Pontifex (Brückenbauer)» , Mittler, Haupt des mystischen Leibes. Auf Grund dieser Rechte und kraft seines Leidens hat er uns mit sich zum Vater geführt.
So zeigt uns die Heilige Schrift, dass im Himmel eine großartige Liturgie gefeiert wird. Christus opfert sich in seiner Herrlichkeit auf und diese glorreiche Opferung ist gleichsam die Vollendung der Erlösung.
In dieser himmlischen Liturgie sind wir alle mit Jesus und untereinander vereint. Wir werden sein glorreiches Siegeszeichen sein. Wir werden an der Anbetung, der Liebe, der Danksagung teilnehmen, die er und alle seine Glieder zur erhabenen Majestät der heiligsten Dreifaltigkeit emporsenden. Die Bilder der Apokalypse geben uns einen Einblick in dieses Geschehen. Der Völkerapostel verkündet im Epheserbrief, am Ende der Zeiten werde der Vater gemäß seinem Ratschluss, den er in der Fülle der Zeiten auszuführen beschlossen hatte, alles im Himmel und auf Erden in Christus als dem Haupt zusammenfassen («recapitulare omnia in Christo»). Das ist der Sinn des Pauluswortes. Die Formulierung der Vulgata: «Instaurare omnia in Christo» (Eph 1, 10) ist nicht so kraftvoll.
Alles wird Jesus Christus unterworfen werden, sagt Paulus weiter; «Oportet illum regnare» (1 Kor 15,25) und der Sohn selbst mit seinen Auserwählten wird sich dem unterwerfen, der ihm alles unterstellt hat, damit Gott alles in allem sei: «Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott herrscht über alles und in allem.» (1 Kor 15,28).
Die ganze Ewigkeit hindurch werden wir voll Freude sehen, dass wir unsere Seligkeit Jesus verdanken, dass sein Priestertum ihr Ursprung ist, wie es auch Ursprung aller Gnaden war, die uns während der mühevollen irdischen Pilgerfahrt zuteil wurden. Empfangen wir doch durch ihn die Annahme als Gotteskinder, unser Priestertum und die Verzeihung und Liebe dessen, zu dem wir bei der Heiligen Messe sprechen: «Barmherzigster Vater!»
Denken wir daran, wenn wir das heilige Messopfer feiern, dass wir uns dem wundervollen Lobgesang anschließen, der uns mit der himmlischen Liturgie verbindet. Im Augenblick, in dem wir die heilige Kommunion empfangen, wissen wir: für uns wie für die Seligen im Himmel gilt, dass wir einzig und allein durch die heilige Menschheit Christi in Verbindung mit der Gottheit treten können.
In Erwartung der beseligenden Gottesschau und der Liebesfülle im Himmelreich sprechen wir: O Jesus, du bist alles für deine Auserwählten. Sei alles auch für uns, solange wir noch im Glauben dem ewigen Jerusalem entgegenstreben, «damit die Lebenden nicht mehr sich leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist» (2 Kor 5, 15).
II. CHRISTUS, VORBILD UND URSPRUNG PRIESTERLICHER HEILIGKEIT
Der himmlische Vater selbst hat uns, den Dienern Christi, unser Heiligkeitsideal bestimmt. «Er hat uns bestimmt, gleichförmig zu werden», nicht irgendeinem Geschöpf, auch nicht einem Engel, sondern «seinem Sohn», der durch die Inkarnation in seiner Menschheit zum Priester geweiht wurde. Der hI. Paulus verkündet uns diesen Gedanken des Vaters, wenn er sagt: er hat uns «im voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben» (Röm 8, 29). Gott stellt uns das Vorbild göttlicher Vollkommenheit vor Augen. Er will in uns die Züge seines menschgewordenen Sohnes wieder finden und durch ihn unsere Seele vom Glanze der Heiligkeit erfüllt.
Wenn es wahr ist, dass die Größe jeder menschlichen Existenz von dem Ideal abhängt, dem sie dient, welche Erhabenheit muss da unserm ganzen Priesterleben eignen, wenn wir den aufrichtigen Wunsch haben, Jesus Christus gleichförmig zu werden! Der Vater findet sein Wohlgefallen am Logos; so wird unsere Ähnlichkeit mit Christus uns zu einer Quelle der Gnade und des Segens.
Betrachten wir ehrfurchtsvoll dieses Geheimnis.
1. Das Übernatürliche
Gott, der Ozean aller Vollkommenheit, ist für jede geschaffene Intelligenz unfassbar; er selbst erkennt jedoch restlos die Fülle seiner Herrlichkeit. Diese Selbsterkenntnis drückt er in einem Gedanken, in einem einzigen Wort aus, in seinem Verbum. Dem Verbum teilt er sein ganzes göttliches Leben mit, all sein Licht, alles, was er ist. Diese Zeugung im Schoß des Vaters ist das Leben Gottes selbst; sie hat nie begonnen und wird nie enden. Auch jetzt, im gegenwärtigen Augenblick, spricht der Vater in unendlichem Jubel zu seinem Sohn: «Mein Sohn bist du; heute - d. h. in einer ewigen Gegenwart - habe ich dich gezeugt» (Ps 2, 7).
Diesen seinen Sohn hat uns der Vater als Vorbild und Quell aller Heiligkeit gegeben. «In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen» (Kol 2, 3). Eine ganze Ewigkeit der Beschauung wird nicht genügen, um dieses Geheimnis zu ergründen und Gott dafür zu danken.
Bevor wir uns näher mit diesem Gegenstand beschäftigen, wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf den Irrtum jener lenken, die hinsichtlich des göttlichen Planes nicht genügend aus dem Glauben leben, sondern selbst die Baumeister ihrer eigenen Heiligkeit sein wollen.
Die Heiligung der Seele ist ein übernatürliches Werk. Was bedeutet «übernatürlich»? Das Übernatürliche ist die in der Zeit sich vollziehende Verwirklichung der ewigen Pläne des Vaters. Aus freiem Willensentschluss hat Gott den Menschen dazu bestimmt, seine endgültige Seligkeit in der Schau der Gottheit von Angesicht zu Angesicht zu finden, jene Schau, die Gott allein natürlich ist. Offenbarung, Menschwerdung, Erlösung, Kirche, Glaube, Sakramente, Gnade und Heiligkeit sind Mittel zur Ausführung dieses Planes, dessen Zentrum Christus und unsere Annahme an Kindes Statt sind. Diese Erhebung ist ein ganz unverdientes, freies Gnadengeschenk, das die Bedürfnisse und das Verlangen der Natur aller Geschöpfe, sowohl der Engel wie der Menschen, übersteigt. Darum ist sie übernatürlich.
An diese gnadenvolle Wirklichkeit muss jede menschliche Tätigkeit anknüpfen, die auf die ewige Seligkeit hingeordnet ist. Denn die sich selbst überlassene Natur vermag nicht aus eigener Kraft das übernatürliche Ziel zu erreichen.
Es gibt Menschen, auch Priester sind darunter, die trotz mehr oder weniger großer Treue in ihren Frömmigkeitsübungen im geistlichen Leben nicht vorwärts kommen; alle ihre Bemühungen führen sie nicht dazu, in Christus zu leben. Sie strengen sich an, ohne sich klar zu machen, welches Ideal sie erstreben sollten; sie zögern, wenn es gilt, sich auf dem besten Weg Gott zu nahen. Paulus hingegen sagt: «Darum laufe ich nicht wie einer, der ziellos läuft, und kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt» (1 Kor 9, 26). Es ist für uns und für die Menschen, die wir zu führen haben, von großer Wichtigkeit, dass wir uns klar sind über die Natur der Heiligkeit, die wir erstreben, damit wir nicht «bloße Luftschläge machen».
Wenn wir uns in die Apostelgeschichte vertiefen und uns mit der Geschichte der ersten Christen beschäftigen, an die der heilige Paulus seine Briefe richtet, sehen wir, dass ihnen die Gaben des Heiligen Geistes in Überfülle verliehen waren. Diese Christen lebten aus Christus, aus der Taufgnade, in der Erwartung des Himmelreiches, von der Lehre des göttlichen Planes, den die Apostel ihnen verkündeten.
Ich tadle jene nicht, die sich bemühen, durch Werke der Übergebühr nach eigener Wahl ihre Heiligung zu erreichen, weil sie das Bedürfnis haben, in solchen Akten Ansporn zu suchen; es ist immer besser, auf Krücken zu gehen als stillzustehen. Doch ich halte es für wertvoller und nützlicher, sich der unendlichen Reichtümer zu bedienen, die wir in Jesus Christus besitzen. Die Menschen möchten ihre Gedanken an die Stelle der Gedanken Gottes setzen, wenn sie die Vollkommenheit auf ihre kurzsichtige Weise erlangen wollen, statt nach den Gedanken Gottes. Paulus stellt schon in seiner Zeit diese Neigung fest: «Lasst euch von niemandem einfangen durch hochklingende Weisheit und leeren Trug, der sich auf menschliche Überlieferung, auf die Weltelemente stützt, aber nicht auf Christus» (Kol 2, 8).
Heute beherrscht der Naturalismus die Welt; er beeinflusst auch jene, die aus dem Glauben leben wollen. Verkennen nicht wir selbst den ausgesprochen übernatürlichen Charakter unseres Innenlebens?
Wenn wir uns also im Streben nach Gottvereinigung nach den Plänen Gottes richten wollen, müssen wir unsere Heiligung vor allem auf die Weise zu wirken suchen, die vom Herrn selbst bestimmt ist, die seinem Willen entspricht.
2. Die Gedanken Gottes über unsere Heiligung
Betrachten wir das Idealbild und die nieversiegende Quelle der Heiligkeit, die der Vater in seiner Liebe für seine Priester bereitet hat.
Durch eine ewige und freie Vorherbestimmung der Liebe hat Gott seinen Sohn für die Welt hingeben wollen. «Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab» (Joh 3,16). Christus gehört jedem von uns ohne Vorbehalt, ganz und gar, als kostbarstes Eigentum. «Er ist uns von Gott her zur Weisheit, zur Rechtfertigung, Heiligung und Erlösung geworden» (1 Kor 1, 30). Alle Heiligkeit, die für die Menschen bestimmt ist, war sozusagen in ihm.
Versuchen wir die Pläne der göttlichen Weisheit und Liebe im Hinblick auf uns zu ergründen.
Gott selbst will sich uns mitteilen, um unsere ewige Beseligung zu sein, doch er will es ausschließlich durch Christus tun, mit ihm, in ihm. Alles zu ihm zurückzuführen, aber geläutert, geheiligt, alles in Christus als dem einzigen Haupt zusammenfassen (Eph 1, 10) - das ist der großartige und erbarmungsvolle Plan des Vaters. St. Paulus spricht gern von diesem «Geheimnis, das von Ewigkeit her in Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war». Es war die Aufgabe, die er vom Himmel empfangen hatte, dieses Geheimnis zu «enthüllen»: «und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat» (Eph 3, 9).
Die Heiligkeit, die Gott von seinen Priestern erwartet, die er von Ewigkeit her für sie vorbereitet hat, ist daher nicht nur sittliche Veredlung, Selbstbeherrschung und Lauterkeit der Gesinnung in der Übung der natürlichen Tugenden. Die Heiligkeit, die Gott von ihnen verlangt, schließt selbstverständlich alle menschliche Rechtschaffenheit in sich; aber sie ist ihrem Wesen nach übernatürlich.
Die erlösende Menschwerdung ist der Mittelpunkt dieses göttlichen Planes. Sie ist uns als höchste Gabe Gottes und seiner Heiligkeit geoffenbart. Diese Mitteilung wird zunächst in ihrer ganzen Fülle der Menschheit Jesu zuteil, dann - durch sie - jedem Christen. Nach den göttlichen Absichten finden sich alle Schätze, die zur Heiligung des Menschen bestimmt sind, in Jesus Christus: «dass ihr an allem reich geworden seid in ihm» (1 Kor 1,5).
Seine Verdienste gehören uns, wir dürfen über sie verfügen. In Bezug auf die Heiligkeit gibt es nichts, was wir nicht durch sie zu erlangen hoffen dürften, wenn nur unser Glaube dieser Hoffnung entspricht.
Schon durch diese Mitteilung ist Christus für uns die Quelle aller Gnaden. Doch noch mehr; durch seinen Tod am Kreuz hat er kraft eines freien Ratschlusses Gottes ein einzigartiges Vorrecht erworben: das ganze Werk der Heiligung der Menschen ist in seine Hand gelegt. Deshalb ist Jesus selbst als Werkzeug der Gottheit durch die Sakramente und auch außerhalb der Sakramente die universelle Wirkursache jeder Gnadenmitteilung. Indem er seinen mystischen Leib durch die Kausalität seiner Verdienste und das Werk der Heiligung beherrscht, ist er auch die beispielhafte Ursache oder das vollkommene Vorbild aller Heiligkeit; denn für Adoptivkinder besteht die Vollkommenheit darin, so sehr als möglich dem natürlichen Sohn zu ähneln.
Diese drei Arten der Kausalität gestatten uns zu erfassen, in welcher Weise Christus nach den ewigen Plänen im Werk unserer Heiligung alles für uns ist. Das zeigt uns die Richtigkeit des Pauluswortes: «Niemand kann einen andern Grund legen als den, der gelegt ist: Jesus Christus» (1 Kor 3, 11). «Dank sei Gott für seine unaussprechlich herrliche Gabe!» (2 Kor 9, 15).
3. Dem Bild des Gottessohnes gleichförmig werden
Betrachten wir nun das gleiche Geheimnis von der Seite des Menschen aus. Man könnte die Heiligkeit definieren als mitgeteiltes und empfangenes göttliches Leben. Dieses Leben wird von Gott, von Christus mitgeteilt; der Mensch empfängt es von der Taufe an (Vgl. in «[[Columba Marmion: Christus, das Leben der Seele|Christus das Leben der Seele]]», das Kapitel über die Taufe.).
Dieses Sakrament verleiht die Gnade der Annahme an Kindes Statt und heiligt so die Seele; es bringt ihr sozusagen das Morgenrot des göttlichen Lichtes; doch dieses Licht will wachsen bis zum Strahlenglanz eines Tages, der keinen Abend kennt.
Die Taufgnade, die heiligmachende Gnade verleiht der Seele die Fähigkeit, sich mit der göttlichen Natur zu vereinigen: durch die Erkenntnis, durch die Liebe, durch den Besitz der Gottheit in der Anschauung von Angesicht zu Angesicht, die Gott allein von Natur aus eigen ist. Diese Gottesgabe ermöglicht dem Menschen eine wunderbare und übernatürliche «Teilnahme am göttlichen Leben», «Eine gewisse Teilnahme an der göttlichen Natur durch ÄhnIichkei», sagt der heilige Thomas» (S. th. III, q. 62, a. 1).
Es ist der Einbruch eines neuen Lebens in die Seele, «eine zweite, geistige Geburt» für den Getauften. Jesus sagt: «Ihr müsst wieder geboren werden» (Joh 3,7). Gott allein kann seinem Geschöpf den Keim dieser übernatürlichen Lebenskraft geben; deshalb ist es wirklich er allein, der ihn für dieses Leben zeugt. «Die aus Gott geboren sind» (Joh 1, 13). Dies ist der Ursprung eines Kindschaftsverhältnisses in der getauften Seele, das ein getreues Abbild der ewigen Kindschaft des Gottessohnes ist.
Leo der Große ruft angesichts dieses Wunders aus: «Erkenne, o Christ, deine Würde»! Und er fährt fort: «Da wir dem Geschlecht Christi angehören, lasst uns auf die Werke des Fleisches verzichten» (Sermo XXXI, 3. P. L. 5t., Sp. 192).
Wenn, wie der hI. Thomas schreibt, «das natürliche und ewige Kindschaftsverhältnis des Wortes im Schoß des Vaters das erhabene Vorbild unserer Annahme an Kindes Statt» (S. th. III, q. 23, a. 2) ist, so muss auch die Heiligkeit, die dem eingeborenen Sohn Gottes eigen ist, Vorbild für die Heiligkeit der Adoptivkinder sein. Worin besteht nun die Heiligkeit Jesu?
Zunächst erkennen wir in Jesus eine Heiligkeit, die der göttlichen Ordnung angehört und nur in ihm existiert; sie ist eine Frucht der hypostatischen Union. Diese «Besitzergreifung» der Seele und des Leibes durch das WORT verleiht der menschlichen Natur Jesu eine unvergleichliche Heiligkeit, die der zweiten göttlichen Person. Wir sagen mit vollem Recht: die heilige Menschheit. Und die Kirche preist in der Heiligen Messe diese einzigartige Heiligkeit mit den feierlichen Worten: «Du allein bist heilig ... Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters.»
Überdies wurde die Seele Jesu von einer unvergleichlichen Fülle der heiligmachenden Gnade erhoben - «und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit» (Joh 1, 14), und der Heilige Geist leitete in wunderbarer Weise alle ihre Akte, passte sie der erhabenen Würde des Gottessohnes an. In der heiligsten Dreifaltigkeit gehören die Personen sich gegenseitig voll und ungeteilt. Die Theologen sprechen von «subsistenten Beziehungen». Der Sohn ist also seinem tiefsten Wesen nach Sohn und auf den Vater ausgerichtet. Durch das Wirken des Heiligen Geistes vereinigte sich die Seele Jesu völlig mit diesem Leben des Logos. Auf Menschenweise war sie kraft einer unendlichen Liebe «ganz auf den Vater ausgerichtet»: sie tat seinen Namen kund, sie erfüllte seinen Willen, sie verherrlichte ihn ohne Unterlass. Alle inneren Regungen Jesu entsprachen völlig seinem Kindschaftsverhältnis zum Vater; sie waren unendlich erhabene Akte der Gottesverehrung und der Liebe.
Durch die heiligmachende Gnade hat der Christ an der Heiligkeit Christi Anteil. Diese Gnade ist gleichsam ein Widerschein des göttlichen Lichtes, das die Seele durchdringt, sie rechtfertigt und dem natürlichen Sohn ähnlich macht. Diese anfängliche Heiligkeit, die sich entfalten soll, wird im Augenblick der Taufe verliehen. Wenn das Adoptivkind durch gute Werke die Tugenden Jesu nachahmt, trägt es zur Vervollkommnung des Lebens Christi in seiner Seele bei.
Als Christus beim letzten Abendmahl seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sprach er zu ihnen: «Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr tut, wie ich getan habe» (Joh 13, 15). Frömmigkeit, Demut, Geduld, Nachsicht, Nächstenliebe - alle Tugenden Jesu sollen uns zu gleicher Gesinnung, zu gleichem Tun anregen; besonders seinen Priestern sollen sie Beispiel sein. Wenn das Wesen unserer priesterlichen Vollkommenheit darin besteht, stets als angenommene Kinder Gottes und als Diener Christi zu handeln, müssen wir so wie er, der Gottessohn und Hohepriester, all unser Tun auf die Liebe und Verherrlichung des Vaters ausrichten, indem wir die Tugenden nachahmen, die er uns als Vorbild vor Augen stellt.
Diese Verähnlichung mit Christus vollzieht sich vor allem dadurch, dass all unser Tun in wachsendem Maß von der Liebe beherrscht wird. Die Liebe richtet jede überlegte Handlung auf das übernatürliche Ziel aus; sie wird immer tiefer im Herzen verankert und wird bestimmend für alle Bereiche der Lebensführung. So wird das Reich Gottes in der christlichen Seele fest begründet. Ist sie nun in der Gnade gefestigt? Nein; sie bleibt der Versuchung zur Sünde ausgesetzt; doch Gott, Christus, das Gottesreich wird die Triebkraft ihres HandeIns. Der Herr hat voll und ganz Besitz ergriffen von dieser Seele, «Der Herr regiert mich», denn die endgültige Vorherrschaft der Liebe bewirkt, dass sie nur noch durch ihn, in ihm und für ihn lebt. Von diesem Augenblick an gewinnt das Apostelwort volle Geltung für die Seele: «Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir» (Gal 2, 20). Nun hat sie die Heiligkeit erreicht.
Gewiss, es gibt sehr verschiedene Grade der Heiligkeit. Die Großmut in der Selbsthingabe, der Heroismus der Tugenden kann vielerlei Formen annehmen und hat fast unbegrenzte Entfaltungsmöglichkeiten. Glauben wir nicht zu schnell, wir seien schon am Ziel. Hier wie überall spielt die Zeit eine Rolle. Von den wahren Dienern Gottes wird gewöhnlich Treue gefordert, die sich lange Zeit hindurch bewähren muss; in vielen Prüfungen wächst die Standhaftigkeit, werden die Verdienste vermehrt. Die Gabe der Beschauung übt ebenfalls einen besonderen Einfluss auf die habituelle Erhebung der Seele und die Beharrlichkeit der Auserwählten aus.
Wie immer es sich mit dem Geheimnis der Vorherbestimmung und der Gnade verhalten mag: der Priester muss den aufrichtigen Wunsch nach priesterlicher Vollkommenheit in sich tragen. Er darf dem göttlichen Ruf gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Wenn nicht der inständige Wunsch in ihm lebt, der Erhabenheit seiner Berufung zu entsprechen, müssen alle Worte wirkungslos bleiben. Ich sage nicht:
Trachtet danach, im ersten Anlauf den höchsten Grad der Heiligkeit zu erlangen. Doch ich rate jedem dringend - denn die Sache ist wichtig -, sich zu bemühen, den Weg der Heiligkeit zu beschreiten, den Gott für ihn will. «Er allein kennt unsere Schwachheit» (Ps 102, 14) und seine Weisheit ermisst genau, wozu wir fähig sind und welcher Gnaden es bedarf, um uns auf dem Höhenweg zu erhalten.
Jedes echte geistliche Leben gründet auf dem Verlangen nach Heiligkeit; durch diesen Wunsch bereitet sich die Seele auf den Empfang der Gaben Gottes vor; in der Anerkennung ihrer eigenen Ohnmacht und in der Erwartung der Gnadenhilfe erschließt sie sich dem Herrn, wächst ihre Fassungskraft für das Göttliche. Das Streben nach Heiligkeit gleicht einer inneren Flamme, es ist wie ein heiliges Feuer, das wir in uns tragen. Zuweilen scheint nur noch ein Funken davon übrig zu sein; aber glaubt nur: es kann wieder angefacht und zur flammenden Glut werden.
Wenn wir wollen, dass der Vater von uns wie von Jesus sagen kann: «Dieser ist mein vielgeliebter Sohn» (Mt 3,17), dann muss all unser Streben und Mühen darauf gerichtet sein, dass das Reich der Liebe in uns fest begründet werde.
(Wir wollen hier nicht untersuchen, ob es für den Priester eine besondere Form der Heiligkeit gibt, die sich von der des einfachen Gläubigen unterscheidet. Durch die Taufe und durch die heiligmachende Gnade ist allen die gleiche essentielle Heiligkeit verliehen. Doch es muss zugegeben werden, dass die Heiligkeit in den Dienern Christi eine besondere Erhebung der Seele zulässt. Das geziemt sich wegen des unauslöschlichen Merkmals, das ihr bei der Priesterweihe eingeprägt wurde, wegen der Aufgabe, die der Priester in der Kirche zu erfüllen hat, und im Hinblick auf die Mittel der Selbstheiligung, die der Würde seines Standes entsprechen. Doch das sind akzidentelle Eigenschaften, die das Wesen der Heiligkeit nicht berühren.
4. In der Gleichförmigkeit mit Christus spiegelt der Priester die Heiligkeit des Vaters wider
Das Evangelium berichtet uns einen erstaunlichen Ausspruch Jesu: «Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist» (Mt 5, 48).
Warum soll unsere Vollkommenheit ein Abbild der göttlichen Heiligkeit sein, die doch unserer menschlichen Schwachheit so unendlich fern ist? Sodann: Vermögen wir das Geheimnis des göttlichen Lebens zu verstehen?
Die Antwort auf diese zweifache Frage lautet: Wir sollen dem himmlischen Vater gleichen, weil wir seine Adoptivkinder sind. Und um die Vollkommenheit des Vaters kennenzulernen, brauchen wir nur zu Jesus zu gehen. Der hl. Johannes sagt: «Niemand hat Gott je gesehen» (Joh 1, 18). Müssen wir also die Hoffnung aufgeben, ihn jemals zu kennen? Nein, denn der Jünger fügt sogleich hinzu: «Der eingeborene Sohn, der ruht am Herzen des Vaters, er hat Kunde gebracht.» Der hl. Paulus ruft im Jubel über diese Offenbarung aus: «Gott wohnt im unzugänglichen Licht» (1 Tim 6, 16); doch er, «der sprach: 'Aus der Finsternis erstrahle das Licht', hat das Licht auch in unsern Herzen aufleuchten lassen, um das Licht der Erkenntnis der Gottherrlichkeit im Antlitz Jesu Christi erstrahlen zu lassen» (2 Kor 4, 6).
Die Weihnachtsliturgie erinnert uns jedes Jahr daran: «Indem wir Gott so mit leiblichem Auge schauen, entflammt er in uns die Liebe zu unsichtbaren Gütern.» In Christus ist uns Gott verständlich geworden, menschlich nahe gekommen. Nach dem letzten Abendmahl sagte Philippus zu Jesus: «Herr, zeig uns den Vater» (Joh 14,8). Und der Heiland antwortete ihm mit einem Wort, das die Lösung des Geheimnisses enthält: «Philippus, wer mich sieht, der sieht auch den Vater» (Ebd. 9). Alles in Christus ist also eine Offenbarung Gottes. Der hl. Augustinus ruft: «Jede Tat des (menschgewordenen) Wortes ist für uns ein Wort.» (Tract. in Joan. XXIV, P. L. 35, Sp. 1593). Zu den Füßen Jesu lernen wir die Vollkommenheit Gottes verstehen; durch die Betrachtung seiner Worte, seiner Handlungen, seiner Leiden, seines Todes dringen wir in die Geheimnisse der unendlichen Barmherzigkeit ein.
Das gilt noch mehr von den Priestern als von den einfachen Gläubigen, denn durch die Lesung der Heiligen Schrift im Lauf des liturgischen Jahres, durch die Feier des heiligen Messopfers betrachten sie die Persönlichkeit Christi mehr als jene.
Worin besteht nach der Auffassung der Theologie das erhabene Attribut Gottes, das wir Heiligkeit nennen?
Gott besitzt höchste Transzendenz; er ist unendlich fern von seiner ganzen Schöpfung, von jeder Unvollkommenheit, von unserer Welt; das ist ein erster, mehr negativer Aspekt seiner Heiligkeit.
Des weiteren können wir sagen, wenn wir in menschlicher Weise sprechen, die Heiligkeit Gottes bestehe in der Liebe, durch die Gott sein eigenes Wesen, seine eigene Vollkommenheit bejaht. Diese Liebe ist weise, geordnet, denn sie entspricht der absoluten Erhabenheit der göttlichen Natur. Mit andern Worten, in der Betrachtung seines Wesens liebt Gott sich selbst und will in Übereinstimmung sein mit allem, was die Vollkommenheit seines eigenen Wesens erstrebt. In dieser Liebe und in diesem Wollen liegt sozusagen die Heiligkeit Gottes. Diese Liebe und dieses Wollen stimmen in ihm nicht nur mit der unendlichen Vollkommenheit überein, sondern sind mit ihr identisch. Daher ihre unveränderliche Festigkeit.
Im Werke der Schöpfung und der Heiligung will Gott seine Geschöpfe in der Ordnung und Unterordnung wirken sehen, die ihnen zukommt. Auf diese Weise verherrlichen sie Gott. Wenn der Mensch seine völlige Abhängigkeit von seinem Schöpfer anerkennt, handelt er ganz nach dem Gesetz seiner Natur, und Gott heißt diese Unterwerfung und diese Verherrlichung gut. Anderseits missbilligt Gott aus demselben Grund notwendigerweise jede Haltung des Ungehorsams oder der Auflehnung und verurteilt die Sünde. Nicht aus Selbstsucht, nicht aus Stolz, sondern auf Grund seiner Heiligkeit, die will, dass sich alles in Lauterkeit, Weisheit und Wahrheit vollziehe. In diesem Sinn ist das Wort zu verstehen: «Gott ist heilig in allen seinen Werken» (Ps 145, 13) und: «Alle Dinge gereichen zu seiner Verherrlichung» (Spr 15,4).
Diese göttliche Vollkommenheit erfüllt die himmlischen Geister mit höchster Bewunderung. Als Isaias und Johannes einen Augenblick den Himmel offen sahen, vernahmen sie den Gesang der Engel: «Sanctus, Sanctus, Sanctus» (Jes 6,3; Offb 4, 8).
Die Heiligkeit Gottes besteht also in der unendlich weisen und vollkommen lauteren Liebe, die er seiner erhabenen Größe entgegenbringt.
In ihrer ganzen Fülle wohnt die Heiligkeit nur in Gott allein, denn nur er liebt in vollkommener Weise seine unendliche Vollkommenheit. Den drei göttlichen Personen ist dieses Attribut wesenseigen, doch jede besitzt es auf die der persönlichen «Beziehung» entsprechende Weise.
Eine klare Vorstellung dessen, was die göttliche Heiligkeit in sich ist, übersteigt unsere Fassungskraft. Doch wenn wir die göttliche Heiligkeit in Jesus betrachten, wird sie uns verständlich und weckt unsere Bewunderung. Hier erkennt der Mensch sie als erreichbar; hier kommt sie ihm nahe.
Die menschliche Natur Jesu hat Anteil an der Heiligkeit des Verbum; Jesus kennt keine Sünde, keine Unvollkommenheit; alles in ihm ist ein Abglanz des Lebens des Logos: durch vollkommene Liebe zu der unendlichen Heiligkeit stimmt er immer und völlig mit dem Vater überein, den er durch alle seine Handlungen verherrlicht.
Dies ist das Ideal, zu dem wir die Augen zu erheben wagen, vor allem wir, denen die ganze Vollmacht Christi verliehen ist: «Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch» (Joh 20, 21).
Wenn nun das göttliche Wort, das in einem einfachen und zugleich unendlichen Sein das ganze Wesen des Vaters ausdrückt, in menschlicher Sprache und durch Beispiele, die unserem beschränkten Intellekt angepasst sind, uns die Geheimnisse des göttlichen Lebens enthüllt hat, ist es dann nicht die größte Torheit vonseiten des Menschen, seiner Botschaft keine Aufmerksamkeit zu schenken und zu versuchen, sich nach eigenem Gutdünken zu heiligen, statt Christus zum einzigen Inhalt seines Strebens, seiner Hoffnung und seines Lebens zu machen?
5. Christus, der lebendige Quell der Heiligkeit Christus ist das überragende und dennoch nachahmbare Vorbild der Heiligkeit, und durch seine allmächtige Gnade verleiht er uns aktive Teilnahme an seiner Heiligkeit
Mehr oder weniger unbewusst haben manche die Auffassung, sie könnten Christus ähnlich werden, indem sie seine Tugenden aus eigener Kraft nachahmen. Das ist eine große Täuschung.
In England genießt zuweilen der oder jener bedeutende Mann unter den Gebildeten eine erstaunliche Beliebtheit. Man will ihn um jeden Preis nachahmen. So liest man nur noch seine Bücher, beschäftigt sich mit allem, was er gesagt oder getan hat, versucht ihn zu kopieren - ja man könnte sagen, ihn nachzuäffen. Man nennt diese Bewunderer «worshippers». Da gibt es «gladstonistes» und «newmaniens» ; besonders Newman zu imitieren war einige Zeit sehr in der Mode.
Wenn jemand versuchen wollte, mittels dieser äußerlichen und gekünstelten Methode Jesus zu folgen und seinem Bild gleichförmig zu werden, so würde er in die Irre gehen. Es wäre ein rein menschliches Beginnen, und wenn der himmlische Vater das Ergebnis dieser Bemühungen betrachten würde, erschiene ihm dieser Mensch wie ein Kind, das nicht aus seiner Gnade geboren wurde; man könnte sogar sagen, wie ein Bastard.
Gewiss, der Herr ist das Vorbild aller Heiligkeit, doch dieses Vorbild ist göttlich und wirkt auf göttliche Weise. Er selbst prägt der Seele die Ähnlichkeit mit seinem Wesen ein.
Wie geschieht dieses Wunder der Gnade? Christus hat es uns geoffenbart: «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben» (Joh 14, 6).
«Ich bin der Weg.»
Zwischen Gott und jedem seiner Geschöpfe klafft ein unendlicher Abgrund. Ohne übernatürliche Erhebung bestünde auch zwischen den Engeln und der Gottheit ein unendlicher Abstand. Gott allein sieht sich kraft seiner Natur so, wie er ist; nur er hat das Recht, die Tiefen seiner Vollkommenheit zu schauen. Die Menschen erkennen Gott nur in seinen Werken: «Wolken und Schatten umgeben ihn» (Ps 96, 2). Doch wir sind berufen, Gott zu schauen, wie er selbst sich sieht, ihn zu lieben, wie er sich liebt, und sein göttliches Leben zu leben. Das ist unsere übernatürliche Bestimmung.
Aber zwischen dieser Erhöhung und den Fähigkeiten unserer Natur ist ein unüberbrückbarer Abgrund. Nur durch Christus, der Gott und Mensch zugleich ist, und durch die Gnade der Annahme an Kindes Statt wird es uns ermöglicht, diese Entfernung zu überwinden. Christus ist gleichsam die Brücke, die über diese unergründliche Tiefe führt: durch seine heilige Menschheit ist er der Weg, auf dem wir bis zur heiligsten Dreifaltigkeit vordringen können. Sagte er doch: «Niemand kommt zum Vater als durch mich» (Joh 14, 6).
Dieser Weg führt nicht in die Irre; wer ihm folgt, gelangt unfehlbar ans Ziel; «er wird das Licht des Lebens haben» (Joh 8,12). Denn als Logos ist Jesus eins mit dem Vater; so sind wir durch seine Menschheit notwendigerweise mit der Gottheit verbunden. Wenn er uns seinem mystischen Leib eingliedert, nimmt er uns wahrhaftig zu sich, damit wir seien, wo er ist, d. h. wir sind vereint mit dem Wort und dem Heiligen Geist im Schoß des Vaters: «Ich werde kommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin» (Joh 14,3).
Stützen wir uns also in allem auf die Verdienste unseres Erlösers. Unsere Hoffnung, die Vereinigung mit Gott zu erlangen, kann sich nicht auf unsere armseligen eigenen Verdienste gründen, wohl aber auf seine unendlichen Verdienste. Je mehr wir unsern Reichtum in ihm suchen, desto mehr wird unser Gottsuchen gesegnet und unser Wirken fruchtbar sein. Löschen wir uns aus, lassen wir Christus in uns herrschen, schließen wir uns ihm an, wie der hI. Paulus sagt : «Mir sei es fern, in etwas anderem meinen Ruhm zu suchen als im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus» (Gal 6, 14). Und weiter: «Ich betrachte alles als Kehricht, um Christus zu gewinnen» (Phil 3, 8).
«Ich bin die Wahrheit.»
Uns selbst überlassen, leben wir auf dieser Erde im Dunkel (Lk 1, 79). Nur wenn wir übernatürliches Licht empfangen, können wir uns zu Gott erheben.
Christus allein offenbart uns die religiösen Wahrheiten; er ist das Licht der Welt: «Ich bin das Licht der Welt» (Joh 8,12). Seine Lehre zerstreut zwar nicht alles Dunkel, aber sie ermöglicht es uns, ihn als den Gesandten des Vaters zu erkennen und ihm anzuhangen als der höchsten und unfehlbaren Wahrheit. «Gott ist mein Licht» (Ps 26, 1).
Das Evangelium enthält die Offenbarung aller großen religiösen Wahrheiten: die der Trinität, der Menschwerdung, der Erlösung, der Vergeltung im Jenseits. Es enthüllt den Menschen das Geheimnis der göttlichen Vaterschaft. Wenn Jesus zu uns von Gott spricht, zeigt er ihn uns immer als unsern Vater: «Ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater» (Joh 20,17). Es ist ein Charakteristikum des Neuen Testamentes, dass es uns lehrt, Gott unsern Vater zu nennen und uns ihm gegenüber zu verhalten, wie nur seine Kinder es dürfen: «Vater unser, der du bist im Himmel» (Mt 6, 9). «Der Geist Gottes bezeugt unserm Geist, dass wir Kinder Gottes sind» (Röm 8,16). Wenn Jesus uns die Vaterschaft Gottes offenbart, tut er uns gleichzeitig unsere Annahme an Kindes Statt kund, unsere Bestimmung zur himmlischen Seligkeit, zeigt er uns die Gesinnung der Liebe und alle Tugenden, die dem Christen eigen sein sollen.
Nehmen wir die Lehren ehrfurchtsvoll auf, die von der personhaften Wahrheit ausgehen, und halten wir in unerschütterlichem Glauben daran fest.
Überdies bringt Christus unsern Seelen die Wahrheit durch die Gnade ganz individueller Erleuchtung.
Diese Erleuchtung, die jeder persönlich empfängt, ist wesentlich für das Wachstum des Lebens Christi in uns. Durch sie betritt der Priester die göttlichen Wege der Heiligkeit. Er «wandelt nach der Wahrheit» (2 Joh 1,4), wie Johannes sagt.
Wir müssen also die Erdenwege im Licht des Glaubens an Christus betrachten. Wie eine göttliche Leuchte soll er in unserem Herzen stehen. Tragen wir unsere Gedanken, unsere Urteile, unsere Wünsche zu Jesus, damit wir die Welt, die Menschen und die Ereignisse mit seinen Augen zu sehen vermögen. Dann werden wir den Wert der zeitlichen und der ewigen Dinge richtig einschätzen.
«Ich bin das Leben.»
Um das Ziel zu erreichen, genügt es nicht, auf dem richtigen Weg zu bleiben und Licht für die Wanderung zu haben; dazu braucht es auch Kraft; nur dann werden wir vorwärts kommen. Beim Streben nach Heiligung ist Christus auch unser Leben: «Ich bin die Auferstehung und das Leben ... Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben» (Joh 11,25; 10,10).
Durch seine göttliche Kraft, durch die Sendung des Heiligen Geistes ist er die allgemeine und wirksame Ursache aller Gnaden. Seine Menschheit ist das Werkzeug der Gottheit. Sie bewirkt in den Seelen jenes Wachstum des übernatürlichen Lebens, durch das sie umgestaltet und in den Augen des Vaters wahre Abbilder seines menschgewordenen Sohnes werden. Christus wirkt durch die Sakramente, aber auch außerhalb derselben; das Gebet, die Betrachtung seiner Geheimnisse, die Demut, die Liebe in all ihren Formen erschließen die Seele seinem Wirken.
Nach der Auffassung der Kirche schafft der Heilige Geist - die erhabenste Gabe des Vaters und des Sohnes - in den Seelen diese echte Verähnlichung mit dem Gottessohn. Er ist «der Finger an der Rechten des Vaters» (Hymnus «Veni Creator»). Wie verwirklicht er in unserer Seele die Annahme an Kindes Statt? Indem er uns rufen lässt: «Abba, Vater» (Gal 4, 6). Das Wirken des Heiligen Geistes wie das des menschgewordenen Wortes führt uns also zum Vater. Alles geht aus diesem Quell aller Vollkommenheit hervor und kehrt in einem gewaltigen Strom zu ihm zurück. So sind wir den göttlichen Personen zugesellt und ahmen das Strömen ihrer ewigen Liebe nach.
Jesus selbst hat unsern Glauben an sein heiligendes Wirken durch eine Parabel zu höherem Erkennen geführt. «Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben», so sagt er (Joh 15, 5). Die Reben leben, doch sie ziehen den Saft, der ihnen Fruchtbarkeit verleiht, nicht aus sich selbst. Ihre Lebenskraft strömt ihnen aus dem Stamm zu. Dieser Saft, der nicht in den Rebzweigen, sondern im Weinstock entstanden ist, gibt ihnen Leben. So ist es auch mit den Gliedern Christi: gute Werke, Übung der Tugenden, geistlicher Fortschritt - das alles ist ihnen eigen, gewiss; doch es ist die Kraft der Gnade Christi, der in ihnen diese Wunder vollbringt. «Wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt» (Joh 15,4).
Alles an Christus strahlt sein Leben aus: seine Worte, seine Handlungen, sein So-sein. Alle seine Geheimnisse, die der Kindheit wie die seines Todes, seiner Auferstehung und seiner Verherrlichung, besitzen eine stets wirksame, heiligende Kraft. In ihm gibt es keine Vergänglichkeit. «Christus stirbt nicht mehr. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn» (Röm 6, 9). «Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit» (Hebr 13, 8). Unaufhörlich spendet er uns das übernatürliche Leben.
Aber unser Mangel an Aufmerksamkeit oder unser geringer Glaube lähmt nur zu oft sein Wirken in unserer Seele. Wenn wir vom Leben Gottes leben wollen, müssen wir die heiligmachende Gnade besitzen und durch einen Akt des Glaubens und der Liebe alle unsere Gedanken und Gefühle auf Christus richten, alle unsere Handlungen in ihm vollziehen.
Wenn jemand uns sagte: Ein solcher Höhenflug der Seele ist mit meiner Schwachheit unvereinbar; ich muss darauf verzichten; dann muss man ehrlich antworten: Ja, es ist unmöglich für dich, wenn du nur auf deine natürlichen Kräfte angewiesen bist und nicht warten willst. Doch das Wirken Christi ist so machtvoll, so heiligend ist der Einfluss der andächtig gefeierten Messe, der Kommunion, der Atmosphäre des Gebetes und der Hochherzigkeit, in der sich das Leben des Priesters für gewöhnlich abspielt, dass du dein Herz in einem grenzenlosen Vertrauen öffnen musst. Wenn du dich auch nur ein wenig um Treue zu Christus bemühst, wird er dich durch seine Gnade erheben.
Selbst wenn dein Priesterleben in den Augen mancher mittelmäßig schiene - das Urteil der Welt lautet oft so-, sei sicher, dass es in den Augen Gottes groß, dem Herrn wohlgefällig ist, denn der Vater sieht in ihm das Abbild des Lebens seines Sohnes: «Ihr seid ja gestorben, euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen» (Kol 3, 3).
III. DER PRIESTER, EIN ANDERER CHRISTUS
1. Der sakramentale Charakter
«Was Christus ist, sollen wir Christen werden», sagt uns ein Kirchenvater (HI. CYPRIAN, De idolorum vanitate, XV, P. L. 4, Sp. 603), um die Gläubigen an ihre erhabene Würde zu erinnern. Fürwahr, alle Sakramente, von der Taufe angefangen, verähnlichen uns dem Erlöser: «Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen» (Gal 3, 27). «Christus anziehen» heißt aber, ihm ähnlich werden, ihm, dem Gottessohn. Wir Priester sind überdies mit seinem Priestertum bekleidet.
Diese durch die Sakramente bewirkte Ähnlichkeit mit Christus ist ein großes Geheimnis. Die heiligmachende Gnade und der Eigencharakter der Taufe, der Firmung und der Priesterweihe tragen - jeder in seiner Weise - dazu bei, diese übernatürliche Ähnlichkeit in der Seele des Priesters zu vervollkommnen.
Die Gnade der Annahme an Kindes Statt ist, wie wir wissen, ein «Lebenskeim» voll Wirkkraft, dem das Gesetz des Wachstums innewohnt, und dessen Kräfte ausschließlich dazu bestimmt sind, den Menschen zur Teilhabe an der göttlichen Seligkeit zu führen. Durch diese Gnade ist unsere Seele befähigt, Gott zu erkennen, ihn zu lieben und zu besitzen, wie er selbst sich erkennt und liebt. So dringen wir in das Innerste des göttlichen Lebens ein.
Auch die drei sakramentalen Charaktere tragen - wenngleich in ganz anderer Weise - dazu bei, die Seele Christus zu verähnlichen. Diese Ähnlichkeit kennt kein Wachstum, keine Änderung. Sie ist ihr ein für allemal unauslöschlich eingeprägt.
Worin besteht eigentlich dieser «Charakter»? Er ist ein heiliges Zeichen, ein geistiges Siegel, das der Seele aufgedrückt wird, um den Menschen Christus zu weihen als seinen Jünger, als seinen Soldaten oder seinen Gesandten. Er bezeichnet uns für immer mit dem Zeichen des Erlösers und verleiht uns schon dadurch eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm.
Wo dieser «Charakter» vorhanden ist, dort fordert er notwendig den dauernden Stand der Gnade. Denn es wäre unvereinbar mit der Stellung eines Jüngers, eines Soldaten oder gar eines Gesandten, der seinem Meister zugesellt ist, um das heilige Opfer darzubringen und die Sakramente zu spenden, wenn er nicht in Freundschaft mit dem lebte, dessen unauslöschliches Siegel er in der Tiefe seines Wesens trägt.
Weihe, unauslöschliches Siegel, Forderung des Gnadenstandes, diese Worte erschöpfen noch nicht den Begriff des «Charakters», wie die Kirche ihn versteht. Man muss darüber hinaus in ihm eine «geistige Macht» sehen.
Der Taufcharakter verleiht jedem Christen außer der Fähigkeit, die andern Sakramente zu empfangen, die wirkliche, wenn auch nur grundgelegte Vollmacht, am Priestertum Christi teilzunehmen. Bei der Heiligen Messe kann er sich in voller Wirklichkeit mit dem Zelebranten vereinen und mit dem Priester zusammen den Leib und das Blut Christi aufopfern; er kann zu der Hinopferung des Erlösers das geistige Opfer seiner Handlungen und seiner Leiden hinzufügen (Thomas, S. th. III, q. 82, a. 1 ad 2).
Gewiss, er bewirkt nicht zusammen mit dem Priester die sakramentale Hinopferung ; diese Vollmacht vermag der Taufcharakter nicht zu verleihen. Doch so begrenzt auch das Priestertum des einfachen Gläubigen sein mag, es besitzt doch bereits eine hohe Würde. Deshalb nannte der hl. Petrus das ganze christliche Volk ein «königliches Priestertum» (1 Petr 2, 9).
Durch den Eigencharakter der von ihr vermittelten Gnade fügt die Firmung dieser Ähnlichkeit des Getauften mit dem Erlöser neue Züge hinzu. Sie macht den Jünger zu einem Christen, der seinen Glauben bekennt, Zeugnis dafür ablegt, ihn verteidigt, ihn ausbreitet, für ihn kämpft als Soldat Christi, gestärkt durch die Gaben und die Gnade des Heiligen Geistes.
Den höchsten Grad erreicht diese Verähnlichung im Sakrament der Priesterweihe. Durch die Auflegung der Hände des Bischofs empfängt der Weihekandidat den Heiligen Geist und dieser Geist verleiht ihm eine außerordentliche Vollmacht über den wirklichen und den mystischen Leib des Herrn. So sind die Priester dieser Erde dem ewigen Hohenpriester zugesellt und werden zu Mittlern zwischen den Menschen und der Gottheit.
Die Hauptwirkung dieses Sakramentes ist der priesterliche Charakter (Thomas, S. th. III, Supplem. q. 34, a. 2.). Wie in Jesus die hypostatische Union die Ursache für die Fülle der Gnade ist, die in ihm lebt, so ist bei dem Priester der priesterliche Charakter die Quelle aller Gnadengaben, die ihn über den einfachen Christen erheben.
Es ist eine übernatürliche Macht, die uns verliehen wurde, eine Vollmacht, die es uns ermöglicht, als Diener Christi das eucharistische Opfer darzubringen und Sünden zu vergeben. Von diesem Charakter geht auch überströmende Gnade, Kraft und Licht auf unser ganzes Leben über. Er drückt unserer Seele ein unauslöschliches Merkmal ein; er wird für uns in der Ewigkeit Ursache zu unendlicher Glorie oder unaussprechlicher Schmach in der Hölle.
Aus dieser Schau wird verständlich, wie eng die Verbindung Christi mit seinen Priestern ist. Das christliche Altertum betrachtete den Priester als eins mit Christus. «Er ist das lebende Abbild, der bevollmächtigte Vertreter des höchsten Priesters» (HI. Cyrill von Alexandrien, De adoratione in Spiritu Sancto. P. G. 68, Sp. 882). Das oft zitierte Wort «Der Priester ist ein zweiter oder anderer Christus» («Sacerdos alter Christus») spricht klar diesen Glauben der Kirche aus.
Erinneren wir uns, was am Tag der Priesterweihe geschieht. An diesem Gnadentag wirft sich ein junger Levit, erschüttert durch das Wissen um seine Unwürdigkeit und Schwäche, vor dem Bischof als dem Stellvertreter des himmlischen Hohenpriesters nieder; er beugt sein Haupt unter die Hand des weihenden Prälaten. In diesem Augenblick steigt der Heilige Geist auf ihn herab und der ewige Vater betrachtet mit unendlichem Wohlgefallen den Neupriester, der das lebende Abbild seines vielgeliebten Sohnes ist: «Das ist mein geliebter Sohn ...»
Während der Bischof die Hand ausstreckt und alle anwesenden Priester die gleiche Handlung vollziehen, verwirklicht sich gewissermaßen von neuem, was der Engel zu Maria sprach: «Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten» (Lk 1,35).
In dieser geheimnisvollen Stunde erfüllt der Heilige Geist den Auserwählten des Herrn und bewirkt eine ewige Verähnlichung zwischen ihm und Christus; wenn der Geweihte sich erhebt, ist er umgewandelt: «Du bist Priester ewiglich nach der Ordnung des Melchisedech» (Ps 109,4).
Wir haben also ein göttliches Siegel empfangen, durch das unser ganzes Wesen gezeichnet wurde; wir sind mit Leib und Seele Gott geweiht worden wie ein Altargefäß, das man nicht profanem Gebrauch zuführen kann, ohne ein Sakrileg zu begehen.
2. Drei Aspekte der Verähnlichung des Priesters mit Christus
Der traurigste Irrtum, dem ein Priester verfallen könnte, wäre der, die Priesterweihe für etwas Unbedeutendes zu halten. Man soll vielmehr eine sehr hohe Auffassung davon haben.
Der erste Aspekt unserer Ähnlichkeit mit Christus im Priestertum ist durch die Worte Jesu an seine Apostel ausgedrückt: «Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt» (Joh 15, 16).
«Niemand darf die Würde an sich reißen, sondern er muss wie Aaron von Gott berufen werden» (Hebr 5, 4). Warum diese Forderung? Weil es niemandem zusteht, sich selbst zu einer so hervorragenden Stellung zu erheben. Das Priestertum Christi ist eine Gabe des Vaters. Christus hat sich nicht selbst die Würde eines Hohenpriesters gegeben, wie St. Paulus sagt, sondern sie von dem empfangen, der zu ihm sprach: «Mein Sohn bist du . .. Priester in Ewigkeit nach der Ordnung des Melchisedech» (Hebr 5, 5 f.). Auch der Priester muss vom Allmächtigen auserwählt sein.
Wir müssen ständig in lebendigem Glauben dafür danken, dass die gütige Vorsehung uns zum Priestertum erwählte: «Gott hat dich gesalbt mit dem Öl der Freude vor deinen Genossen» (Ps 44, 8). Diese Auserwählung setzt vonseiten Gottes eine bevorzugende Liebe voraus. Oft hat der Herr seinen künftigen Priester von der Kindheit oder doch von früher Jugend an beschützt und auf den Wegen des Lebens geführt. Die Gabe des Priestertums ist wie ein goldener Ring, das erste Glied einer neuen Kette besonderer Gnaden, die den Dienern des Altares vorbehalten sind. Dieser große Gedanke sollte uns ein Ansporn zu unwandelbarer Treue sein.
Gewiss, niemand von uns vermag das Geheimnis der Auserwählung zu ergründen, das in Gott verborgen ist. Doch es gibt Anzeichen, die es uns ermöglichen, uns vorsichtig eine persönliche Meinung darüber zu bilden, welche Absichten Gott mit einer Seele hat. Nur dem Bischof als dem offiziellen Stellvertreter Gottes kommt es zu, in letzter Instanz über die Echtheit einer Berufung zu urteilen und durch eine kanonische Berufung den Willen des Höchsten zu offenbaren.
Es ist eines der schwersten Verbrechen, wenn jemand versucht, die priesterliche Salbung des Heiligen Geistes und die Priesterweihe zu erhalten, ohne dass er von Gott dazu berufen ist. Dieses Verbrechen wird schwer bestraft.
Wenn hingegen der Diakon im Gehorsam gegen seinen Bischof die Handauflegung empfängt, darf er sicher sein, dass Gott in seiner unendlichen Erbarmung ihn wirklich erwählt hat. Darum ist seine Freude über die Berufung zum Priestertum so rein, sein Stolz darauf so berechtigt.
Der Priester gleicht Christus auch durch die Macht, die ihm verliehen ist.
Das Wesen des Priestertums besteht darin, heilige Mittler zwischen Himmel und Erde einzusetzen, die dem Herrn die Gaben der Menschen darbringen und ihnen dafür die Gnaden Gottes vermitteln. «Der Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen in ihren Angelegenheiten bei Gott bestellt» (Hebr 5, 1).
Bevor Jesus in den Himmel auffuhr, wollte er Männer bestellen, die sein Wirken fortführen, indem sie die gleichen Taten der Allmacht und Liebe vollbringen wie er. Der Priester ist der Stellvertreter Christi: «Der Priester ist wirklich der Stellvertreter Christi, denn er tut das, was Christus vor ihm getan.» So sagt der hl. Cyprian in Übereinstimmung mit der gesamten christlichen Tradition.
Christus gibt seinen Priestern mehr als einen einfachen Auftrag; er verleiht ihnen seine Vollmacht; er selbst wirkt durch sie. Daher ist ihr Priestertum ganz dem Priestertum Christi untergeordnet; doch diese Unterordnung verleiht ihm seine hohe Würde; es ist der Widerschein des Priestertums des eingeborenen Sohnes Gottes.
Der Priester ist Träger heiliger Gaben: «sacra dans». Und das aus einem doppelten Grund: er bringt dem Vater den sakramental hingeopferten Jesus dar; das ist die kostbarste Gabe, die die Kirche auf Erden Gott bieten kann; die Menschen aber macht er der Erlösungsfrüchte teilhaft, er vermittelt ihnen Gnaden und die göttliche Verzeihung. Er hat die Vollmacht, die Schätze des Erbarmens Christi auszuteilen, die vom Kreuz ausgehen: «So betrachte man uns als Diener Christi und als Verwalter der Geheimnisse Gottes» (1 Kor 4,1). Als Jakob sich mit Esaus Gewändern bekleidete, zog er allen Segen auf sich herab, der für seinen älteren Bruder bestimmt war. Der Priester, der durch sein Priestertum mit der Macht Christi bekleidet ist, kann zum Herrn mit mehr Recht als Jakob sprechen: «Ich bin dein Erstgeborener» (Gen 27, 32).
Er wird so ganz eins mit dem ewigen Hohenpriester, dass er bei der Messe nicht spricht: «Das ist der Leib ... das Blut Christi», sondern: «Das ist mein Leib ... das ist mein Blut ...» Und wenn er im Beichtstuhl Sünden nachlässt, tut er es mit den Worten: «Ich spreche dich los». Er beruft sich nicht auf Gott, sondern spricht und befiehlt kraft seiner Amtsgewalt. Warum? Weil die Kirche, die ihm die Lossprechungsformel auf die Lippen legt, mit Sicherheit weiß, dass er in diesem Amt eins ist mit Christus, der mit ihm und durch ihn wirkt: «Er handelt in der Person Christi («Agit in persona Christi».
Das Priestertum ist ein erhabenes Vorrecht, das der Vater dem Erwählten verleiht, wie er es seinem Sohn verlieh. Es ist die größte Ähnlichkeit, die der Mensch mit dem fleischgewordenen Logos erreichen kann. Auf dieser Erde gibt es nichts, was an Erhabenheit dem Priestertum gleichkäme.
Drittens: Wie Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, so trägt auch der Priester ein göttliches und ein menschliches Element in sich.
Während seines Erdenlebens verbarg Christus seine Gottheit unter dem Schleier seiner Menschheit. Für das Volk galt er als Sohn eines Arbeiters: «Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns?» (Mt 13, 55). Der Hohe Rat zu Jerusalem und die römischen Soldaten betrachteten ihn als Missetäter, der die schwersten Strafen verdient hatte. Und dennoch war er das Wort Gottes, der erhabene Herr des Universums, die Quelle allen Segens.
Unter der Gestalt eines Menschen, der den Prüfungen und dem Elend dieser Welt unterworfen ist, verbirgt der Priester die unsichtbare Erhabenheit seines Priestertums. Der Ungläubige betrachtet ihn oft als einen Mann, der für die Gesellschaft gefährlich ist; kaum dass er ihm dieselbe Rücksicht und Achtung zugesteht wie dem letzten Staatsbürger.
Und doch ruht in diesen schwachen Händen übermenschliche Macht! In diesem Menschen, der aussieht wie alle andern, wohnt wahrhaft göttliche Kraft. Wenn er spricht, kommt Christus vom Himmel herab, um sich zum Opfer darbringen zu lassen. Der Sünder, der von seiner Schuld fast erdrückt ist, kniet vor dem Priester nieder, und dieser sagt zu ihm im Namen Gottes: «Geh hin in Frieden.» Dieser Sünder, der vielleicht vor einer Minute noch zu ewiger Strafe verdammt war, erhebt sich gerechtfertigt; er hat Verzeihung erlangt, und seine Seele ist von himmlischer Gnade erfüllt.
Jesus selbst setzt das Werk der Heiligung der Gläubigen fort; von der Geburt bis zum Todeskampf steht er seinen Auserwählten in allen Lebenslagen durch seine Priester bei. So wird die Ehrfurcht und Liebe verständlich, die das christliche Volk stets den Dienern Christi entgegengebracht hat. Ist doch der Priester nach der Auffassung der Kirche eins geworden mit seinem göttlichen Meister.
Der hl. Franz von Sales beobachtete einmal einen Neupriester unmittelbar nach der Weihe. Der junge Priester blieb bei der Türe stehen und es schien, als ob er eine Auseinandersetzung mit einem Unsichtbaren hätte. «Was gibt's ?» fragte der Heilige. Der Neupriester gestand, er habe das Glück, seinen Schutzengel zu sehen. «Bevor ich Priester war, ging er immer vor mir her; doch jetzt will er mir den Vortritt lassen» (Mgr. Trochu, Saint François de Sales, I, 2 f.). Die Engel sind nicht Priester, und sie ehren in uns die Würde, die sie in Christus anbeten.
3. Ruf zur Heiligkeit
Jesus betrachtet seine Priester als seine vertrauten Freunde. An seine Apostel richtete er nach ihrer Erhebung in den Priesterstand die Worte: «Nicht mehr Knechte nenne ich euch; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Freunde habe ich euch genannt, denn ich habe euch alles geoffenbart, was ich von meinem Vater gehört habe» (Joh 15,15). Nach unserer Priesterweihe wurden uns im Namen Jesu die gleichen Worte gesagt.
Aus unserer Würde erwächst uns eine schwere Gewissenspflicht; sie ist ein ständiger Aufruf, nach der Vollkommenheit unseres Standes zu streben.
Im Priestertum ist alles übernatürlich.
Wir können diese Gottesgabe nicht mit den Maßstäben der Welt messen und schätzen. Die Welt kennt Gott nicht. «Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt» (Joh 17,25).
Schon im Seminar muss der Priesteramtskandidat überzeugt sein, dass er zur Heiligkeit berufen ist. Ein Leben des Gebetes und der Hingabe wird diese Überzeugung in ihm erhalten und stärken. Er kann gar nicht hoch genug denken von der Gnade, die er bei der Priesterweihe empfängt: «Vernachlässige die Gnade nicht, die in dir ist und die dir verliehen wurde» (1 Tim 4, 14).
Wenn jemand meinte, es genüge, die Sünde zu meiden, man müsse nicht Höheres erstreben, so würde das bedeuten, man brauche nicht aus dem Glauben und der Liebe zu leben; ein solcher Mensch wäre in großer Gefahr, in die Irre zu gehen. Doch auch wenn es nicht zur Katastrophe käme, würde sein ganzes Leben vergehen, ohne dass er die tiefen Freuden kennenlernt, die Gott seinen treuen Priestern vorbehält, und ohne sein priesterliches Lebenswerk in seiner Gänze vollbracht zu haben.
Schon im Alten Testament fordert Gott von den Dienern des Tempels Heiligkeit; und doch war die Opferung von Böcken und Kühen, die sie vollzogen, nur ein Gleichnis für das Opfer des Neuen Bundes. Sollte Gott nicht allen Grund haben, von den Dienern des Neuen Bundes eine weit größere Reinheit des Lebens zu fordern ?
Drei Beweggründe erinnern den Priester unaufhörlich an seine Pflicht, diese Heiligkeit zu erstreben: seine Vollmacht über den Leib und das Blut des Gottessohnes; sein Amt als Gnadenvermittler: sollte er als solcher nicht zuerst selbst von den Sakramenten geheiligt sein, die er spendet ? Schließlich erwartet das christliche Volk von ihm das Beispiel seines Lebens: wenn er andern das Gesetz Christi predigt, darf er nicht durch sein Verhalten die Wahrheit Lügen strafen, die er verkündet.
Wenn der hl. Thomas die traditionelle Lehre über diesen Gegenstand zusammenfasst, preist er die priesterliche Heiligkeit: «Wer die heilige Priesterweihe empfängt, ist fähig, die erhabensten Funktionen auszuüben, durch die Christus im AItarssakrament gehuldigt wird» (S. th. II-lI, q. 184, a. 8). «Da die Priester zu einem so hohen Amt erhoben sind, können sie sich nicht mit irgend welcher moralischer Güte begnügen; von ihnen wird eine hervorragende Tugend verlangt.» (S. th., Supplem., q. 35, a. 1 ad 3.).
Denken wir genug daran? Wir sind die Vertrauten Jesu, die Verwalter seines Opfers. Die Tatsache, dass wir dem Erlöser so nahestehen, müsste uns ohne Unterlass anspornen. Auch die gottwohlgefälligsten Laien haben nicht so leicht Zugang zum Herrn wie wir. Eine hl. Gertrud, eine hl. Theresia, die mit Gnaden überschüttet wurden und mit dem Heiland so innig vereint waren, konnten niemals Brot und Wein konsekrieren, niemals die Hostie in die Hände nehmen, niemals die Kommunion reichen.
Die Hostie gehört sosehr dem Priester, dass seine Macht über sie nur durch Gesetze und Vorschriften der Kirche begrenzt ist. Jesus liefert sich seinen Priestern aus, wie er sich Maria ausgeliefert hat; und niemand hat das Recht, die Hostie zu berühren - den Fall äußerster Not ausgenommen -, als nur der Priester allein. Er hütet den Tabernakelschlüssel. Er nimmt Jesus heraus, um den Kranken die heilige Kommunion zu spenden, um das Volk zu segnen, er trägt ihn in Prozessionen durch die Straßen.
Sollte es möglich sein, dass Laien, vielleicht sogar einfache Frauen aus dem Volk, Jesus mehr lieben als seine Priester? Versuchen wir, zu Jesus ganz aufrichtig zu sagen: «O Jesus, du hast dich mir ausgeliefert, du hast mir deinen Leib und dein Blut übergeben, du hast mir die Sorge für die Seelen anvertraut, die dir gehören; auch ich übergebe mich dir ganz; gebrauche mich, wie es dir gut scheint.»
Bei der Arbeit in Nazareth, bei den Wanderungen auf den Straßen Galiläas, im Gespräch mit seinen Aposteln, beim Gebet auf dem Berg war Jesus sich stets seines Priestertums bewusst. So sollte es auch bei uns sein: wir hören nicht auf, Priester zu sein, wenn wir vom Altar weggehen; wir sind es immer und überall. Machen wir wie Jesus die Interessen Gottes zu den unsern: «Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist» (Lk 2, 49).
Erinneren wir uns an die Parabel von den Talenten: wir sind jene, die fünf Talente empfingen. Denken wir darüber nach. Vollbringen wir unsere priesterlichen Handlungen in der reinsten Gesinnung? Wie Maria, die Mutter Jesu, eine hervorragende Heiligkeit besaß, so soll der Priester wegen seiner Vertrautheit mit dem, der die Heiligkeit selbst ist - «Jesus Christus, Du allen bist heilig» - eine große Reinheit seines ganzen Lebens, eine ständige Erhebung der Seele erstreben.
Damit er auf diesem steilen Weg nicht den Mut verliert, muss er in seinem Herzen beständig den Wunsch nach Vollkommenheit wachhalten und sich des Wortes erinnern, das der Bischof an die Weihekandidaten richtet: «Gott ist mächtig genug, um seine Gnade in dir zu vermehren».
4. Ahmt das Geheimnis nach, dessen Diener ihr seid
Der Priester ist ein «anderer Christus», und wie sein göttlicher Meister muss er eine Opfergabe sein, die zur Verherrlichung Gottes zum Heil der Seelen hingeopfert wird. Wenn er das nicht ist, dann entspricht er nicht den Forderungen, die Gott an ihn stellt, mag er auch ein Gelehrter sein, ein sozialer Reformator, ein genialer Organisator.
Welches ist nun eigentlich der Höhenweg, den der Priester nach dem Wunsche der Kirche gehen soll ?
Das Pontifikale zeigt in kurzen, prägnanten Worten die Gesamtheit der Tugenden, die dem Diener Christi ziemt; es gibt keine authentischere Belehrung darüber.
Bevor der Bischof dem Weihekandidaten die Hände auflegt, spricht er die Worte: «Die Erwählten mögen sich durch beharrliche und treue Übung der Gerechtigkeit empfehlen»; ihr Wandel zeuge von der «Keuschheit und Reinheit ihres Lebens». Und er verlangt, dass die Priester «nicht weniger durch ihr Beispiel als durch ihre Lehre predigen und dass der Wohlgeruch ihrer Tugenden die Freude der Kirche Gottes sei».
Besonders eine Ermahnung des Pontifikale ist beachtenswert: «Achtet wohl auf eure Handlungen; ahmt das Geheimnis nach, dessen Diener ihr seid, nämlich das Geheimnis des Todes des Herrn,» das ihr feiert. Sucht eure Glieder von allen Lastern und Begierlichkeiten abzutöten.
Das ist unser wahres Heiligkeitsideal. Wenn wir auf der Höhe unserer priesterlichen Berufung sein wollen, wenn wir wollen, dass das Priestertum unser ganzes Leben forme und dass wir von Liebe und Eifer erfüllt seien, Seelen zu gewinnen - und ist dies nicht unser höchstes Verlangen? -, dann müssen wir nach dem Wort des weihenden Bischofs Christus, den Priester und die Opfergabe, nachahmen. Wenn wir an seiner Priesterwürde teilhaben, ziemt es sich da nicht, dass wir auch an seiner Hinopferung teilnehmen?
Welche Phase des Lebens Jesu und welche seiner Tugenden wir auch betrachten mögen - er ist das Ideal für alle. Das Kind findet in ihm ein Vorbild, der einfache Christ, der Arbeiter, die Jungfrau, der Ordensmann.
Doch es gibt in ihm ein Allerheiligstes, einen verschlossenen Tabernakel, in den einzudringen der Priester wünschen soll, denn dort ist die Quelle des ganzen Innenlebens Jesu. Von der Menschwerdung an hat sich «der Erlöser völlig der Erfüllung des väterlichen Willens» geweiht; er hat sich in vollkommener Liebe hingegeben: «Siehe ich komme ... deinen Willen Gott zu tun» (Hebr 10, 7). Und an diesem Willen hielt er fest.
Unsere Pflicht ist es, Jesus zu folgen in der totalen Hingabe seines Lebens zur Verherrlichung des Vaters und für das Heil der Welt. Darin besteht die Vollkommenheit des Priesters; dies ist die erhabenste Berufung.
Der Aufforderung gehorchen: «Ahmt das Geheimnis nach, dessen Diener ihr seid», das heißt nicht nur, dieses Opfer fromm feiern, sondern sich mit dem Opfer Jesu vereinen durch die Totalhingabe unseres Lebens. Erwägen wir wohl: der Kreuzestod Jesu wurde durch sein ganzes Erdenleben vorbereitet. «Für uns» ist er vom Himmel herabgestiegen, wie es im Credo heißt: « Für uns Menschen und zu unserm Heil.» Schon als Jesus in Nazareth in Josefs Werkstatt arbeitete, wusste er, dass es seine Bestimmung war, als Schlachtopfer dargebracht zu werden. Im voraus hat er seinen Lebensweg angenommen, all sein Leiden und seine Schmach vorhergesehen. Als seine Stunde gekommen war, gab er sich in unendlicher Liebe für unsere Rettung hin: «Er wurde für uns gekreuzigt.»
Diese vorbehaltlose Annahme der göttlichen Pläne soll unser Vorbild sein. «Ahmt nach ...» Bringen auch wir am Altar dem Herrn unser ganzes Leben dar, unser Leben, das wir in Liebe der Sache Gottes und dem Heil der Seelen weihen. Durch die tägliche Nachahmung der Hinopferung Jesu wird es uns möglich sein, allmählich in das innerste Geheimnis der Seele des göttlichen Meisters einzudringen.
5. Nach dem Beispiel des heiligen Paulus
Unter denen, die Christus gewürdigt hat, an seinem Priestertum teilzunehmen, erfasste niemand besser die Weite und Tiefe dieser Berufung als der heilige Paulus.
Von dem Augenblick an, da Christus sich ihm offenbarte, zählten die Welt, Fleisch und Blut nicht mehr in seinen Augen (Gal 1, 16). Er wusste, dass er vom Mutterschoß an bestimmt war, Diener, Priester, Apostel Christi zu sein (Gal. 15). In einem Brief an die Korinther schildert er sein Leben. Es ist eine ununterbrochene Folge, sozusagen eine unvergleichliche Verkettung von Leiden, die er für Christus zu erdulden hatte, und von mühevollen Arbeiten, die er auf sich nahm, um den Reichtum der Gnade zu verkünden: «Dreimal wurde ich mit Ruten geschlagen; einmal wurde ich gesteinigt ...» Gefahren aller Art lauerten auf seinem Weg: «Gefahren in den Städten ... in den Wüsten . .. von falschen Brüdern.» Hunger, Kälte und viele andere Mühsale waren ihm vertraut. Überdies lastete auf seiner Seele die schwere Sorge, die mit der Gründung neuer Christengemeinden verbunden war. Die persönlichen Schwierigkeiten der Neubekehrten fanden ein Echo in seiner Seele: «Wer wird schwach, ohne dass ich schwach werde? Wer nimmt Anstoß, ohne dass ich entbrenne?» (2 Kor 11, 29).
Trotz dieser vielfachen Widerwärtigkeiten lässt St. Paulus nicht den Mut sinken. Was ist die Quelle seiner Kraft? Er vertraut es uns an : «Ich rühme mich gern meiner Schwachheiten, damit die Kraft Christi in mir wohne» (2 Kor 12, 9). Und an einer andern Stelle sagt er: «Aber in all dem bleiben wir siegreich durch den, der uns geliebt hat» (Röm 8,37). Er war zu einer so innigen Verbindung mit dem Erlöser gelangt, dass er ausrufen konnte: «Christus ist mein Leben» (Phil 1, 21). «Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingeopfert hat» (Gal 2, 20). Wenn jemals ein Priester die Tiefe des Leidens und Sterbens Jesu, die Grenzenlosigkeit des göttlichen Erbarmens erfasst hat, dann ist es Paulus. Er fühlte sich mit Christus ans Kreuz geheftet, «Ich bin mit Christus gekreuzigt worden» (Gal 2, 19). Und wer ans Kreuz geheftet ist, der ist wirklich zum Schlachtopfer geworden.
Was ergibt sich daraus für ihn? Er sollte sagen können: «Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir» (Gal 2, 20). Christus ist in mir; ihr seht mich handeln, aber dieser Eifer, diese Worte sind nicht die meinen; es sind Christi Handlungen, Christi Worte. Denn Christus ist es, der mein ganzes Leben beherrscht, weil ich ihm mein ganzes Sein übergeben habe, um voll und ganz sein Diener zu sein. Durch die Gnade Christi lebe ich aus Liebe zu dem, der sein Leben für mich hingab.
Wenn wir wünschen, dass unser Priesterleben heilig sei und sich nicht im eiligen Abbeten des Breviers und dem gewohnheitsmäßig vollzogenen Zelebrieren der Heiligen Messe erschöpfe, dann heften wir uns in Wahrheit an das Kreuz Christi; nur wenn das Kreuz in unserm Herzen aufgerichtet ist, wird Jesus uns seiner Hinopferung zugesellen. Der hl. Paulus von Nola drückt diesen Gedanken mit den Worten aus: «Der Herr selber ist die Opfergabe, die die Priester darbringen ... So müssen die Priester Opfergaben für ihn werden» (Epist. XI, P. L. 61. Sp. 196).
Es gibt viele Menschen in der Welt, die sich als Opfer betrachten, doch sie sind es in ihrer Einbildung, sie übertreiben, sie sträuben sich gegen den kleinsten Nadelstich. Seelen, die sich wirklich hingegeben haben, bewahren diese Gesinnung in jedem Geschehen des Alltags; ihre Akte der Hingabe und ihre Leiden steigen unaufhörlich schweigend wie ein Wohlgeruch zum Thron Gottes empor. Frauen, die verborgen in einem unbekannten Kloster oder sogar mitten in der Welt leben, haben zuweilen dieses Ideal vollkommen erfasst. Warum leben nicht auch wir, die Priester Jesu, aus ihm?
Kehren wir zu St. Paulus zurück. Seine Lehre lässt uns das Wort verstehen: «Ich vollende an meinem Leib, was am Leidensmaß Christi noch fehlt» (Kol 1,24). Welch geheimnisvolles Wort! Kann an den unendlichen Verdiensten Christi etwas mangeln? Hat er den Willen des Vaters nicht bis zum letzten Jota in vollkommener Liebe erfüllt? Und doch, Paulus schreibt: «Ich vollende ...»
Die Antwort ist: Durch einen Beschluss seiner anbetungswürdigen Weisheit hat Gott seiner Kirche einen Teil der Genugtuung vorbehalten, die er für die Sünden der Welt fordert. Die Seelen, die sich in dieser Gesinnung mit Christus vereinen, erweisen Gott große Verherrlichung; sie «vollenden» durch ihre Hinopferung die Sühneleistung, die die unendliche Gerechtigkeit von der Menschheit fordert. Ihr könnt euch also wirklich auf dem Altar dem Vater darbieten und ihn bitten, euch zusammen mit der Hinopferung Jesu Christi anzunehmen.
Warum spricht der Apostel so? Er war Priester im vollen Sinn des Wortes, ein Priester, der zum Opfer Christi die Opfergabe eines ganzen Lebens des Verzichtes und des Seeleneifers hinzufügte: «Damit die Lebenden nicht mehr sich leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist» (2 Kor 5, 15).
St. Paulus feierte nicht nur das heilige Opfer, sondern er vereinigte sich damit, er lebte es, er betrachtete sich vereint mit Christus als Opferpriester und Opfergabe.
Wenn wir heilige Priester sein wollen, müssen wir vom Beispiel des Apostels lernen. Schreibt er doch: «Seid meine Nachahmer, wie ich Nachahmer Christi bin» (1 Kor 4, 16).
6. Der Priester, Gnadenquell für die Seelen
Das ewige Priestertum Christi ist die Quelle aller Gnaden, die die Menschen hienieden empfangen, und die Quelle der Seligkeit, deren sie sich in der Ewigkeit erfreuen werden: «Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen» (Joh 1, 16).
Der katholische Priester setzt das Werk Christi auf Erden fort, handelt in der Vollmacht Christi. Deshalb ist er der gewöhnliche Vermittler aller übernatürlichen Gaben, die Gott der Welt gewährt.
Wenn wir unsere Priesterwürde unter diesem Gesichtspunkt betrachten, entdecken wir in ihr eine unvergleichliche Größe.
Gott könnte in seiner souveränen Freiheit und Freigebigkeit alle Gnaden unabhängig von unserem priesterlichen Wirken spenden. Doch gemäß dem Plan der ewigen Weisheit wird die Gotteskindschaft, die Vergebung der Sünden, die Hilfe des Himmels und die Verkündigung der geoffenbarten Wahrheiten durch Menschen vermittelt, die von Gott bevollmächtigt sind.
Diese Einrichtung ist eine Fortführung der durch die Menschwerdung begründeten Ordnung. Wie die Welt durch das Opfer eines einzigen Menschen, des neuen Adam, gerettet wurde, so werden die Erlösungsgnaden durch die Vermittlung von Menschen, die auf Erden Stellvertreter Christi sind, mitgeteilt.
Und durch diese Mitteilung wird der Sohn nach dem Willen des Vaters ohne Unterlass verherrlicht. In der Tat, wenn die Gläubigen sich an den Priester wenden, um Licht und Kraft zu empfangen, so erkennen sie an, dass im Werk des Heiles und der Heiligung alle geistlichen Güter von Christus ausgehen. Durch diesen gelebten Glauben tragen die Glieder des Mystischen Leibes zur allumfassenden Verherrlichung des Erlösers bei; so gehen sie auf die Absichten des Vaters ein, der sprach: «Ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn noch weiter verherrlichen» (Joh 12, 28).
Das Ziel der Menschwerdung ist die Erhebung des Geschöpfes in die übernatürliche Ordnung. Wurzelhaft ist dies in Jesus Christus geschehen, aber durch die Gnaden, die von der Kirche ausgeteilt werden, muss sich auch an jeder einzelnen Seele diese göttliche Erhöhung vollziehen. Dank der ihm verliehenen Gaben ist jeder Christ fähig, seine Mitmenschen für die Tugend zu gewinnen, mindestens durch das Beispiel. Doch der Priester muss gleichsam Zentrum sein, das göttliches Leben ausstrahlt. Ihm steht es zu, die heiligen Gaben zu vermitteln, vor allem die höchste aller Gaben: Jesus Christus. Er ist von Amts wegen Führer; er soll den Ordenschristen wie den einfachen Gläubigen auf den Wegen der Vollkommenheit leiten. Ihm kommt es überdies zu, allen Geschöpfen die Frohbotschaft zu verkünden: «Verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!» (Mk 16, 15).
Die große Aufgabe des Priesters besteht darin, Christus in die Welt zu tragen.
In der Messe von den heiligen Kirchenlehrern heißt es : «Ihr seid das Salz der Erde» (Mt 5, 13). Das ist ein Wort Jesu an seine Apostel. Allen, die mit ihm in Verbindung treten, bietet der Priester diesen Schutz gegen die Verderbnis; von ihm sollte man in Wahrheit sagen können: «Es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte» (Lk 6, 19). Doch das hängt weithin von der persönlichen Heiligkeit ab.
Wenn das Salz fad wird, hat es keinen Wert mehr; man wirft es als nutzlosen Abfall weg. Das gilt auch für den Priester; wenn er auch nur ein wenig von dem Eifer verliert, der ihn am Tag der Priesterweihe beseelte, verringert sich sofort der Wert seines Wirkens im Dienste der Seelen.
Ist er hingegen von Gottesliebe erfüllt und eng mit Jesus vereint, wirkt er sogar dann Gutes, wenn er nicht in der Seelsorge arbeitet. Man hat schon oft festgestellt, dass ein Professor der Philosophie oder der Naturwissenschaften, ein Gymnasiallehrer oder ein Inspektor, wenn er wahrhaft Priester ist, seine Schüler unverkennbar günstig beeinflusst, auch wenn er es nicht weiß. Diese Tiefenwirkung könnte die Arbeit eines Laien nicht im gleichen Grade haben, mag sie noch so vortrefflich sein, denn der Priester ist auf Grund seiner Berufung «das Salz der Erde».
Vergessen wir es nie: Wir sind Werkzeuge in der Hand Jesu zur Heiligung der Welt. Das Werkzeug muss ganz in der Hand dessen sein, der sich seiner bedient; durch das Werkzeug wird nur das vollbracht, was der Handelnde mit ihm tut. Seien wir demütige und bereitwillige Werkzeuge in den Händen Gottes und schreiben wir nicht uns selbst zu, was der Herr durch unsere Vermittlung wirkt. Die Gültigkeit unseres sakramentalen Amtes hängt von der Priesterweihe und von der Jurisdiktion des Bischofs ab; aber über die heiligende Fruchtbarkeit unseres Wortes im Beichtstuhl, bei der Predigt und bei jeder Begegnung mit den Gläubigen entscheidet zum größten Teil unsere Vereinigung mit Christus.
Wie bewundernswert ist doch der göttliche Heilsplan! Der Vater wollte in seiner Barmherzigkeit, dass die Menschwerdung nicht nur dem Heil der Welt diene, sondern dass wir im göttlichen Mittler auch ein Herz finden, das dem unsern gleicht; ein Herz voll Liebe und Mitleid, das unsere Leiden und unser Elend kennt, ausgenommen die Sünde.
Der Priester setzt auf Erden das Werk Christi fort. Deshalb wählte der Herr zu Ausspendern seiner Gnade nicht Engel, die doch so rein und so von Liebe erfüllt sind, sondern Menschen. Er soll aus persönlicher Erfahrung «mit Unwissenden und Irrenden mitfühlen können, weil er selbst mit Schwachheit behaftet ist» (Hebr 5, 2).
Die Gottheit Christi erfüllt uns mit Bewunderung und Ehrfurcht, doch seine Güte, sein Erbarmen trösten und stärken uns. So ehrt auch das christliche Volk die Erhabenheit des Priestertums; doch was am Priester anzieht, was den Diener Gottes dem Volk so teuer macht, ist vor allem seine Güte, sein Mitgefühl für alle Schwächen und Leiden, seine Hingabe im Dienste aller, die ihn dem heiligen Paulus ähnlich macht, der an die Römer schrieb: «Ich bin allen verpflichtet, Gebildeten und Ungebildeten» (Röm 1, 14).
In meiner Heimat, in der die Religion drei Jahrhunderte lang verfolgt wurde, ist es der Priester, der nicht nur den Glauben im Volk unversehrt bewahrt hat, sondern auch in jeder Familie, bei jedem einzelnen der stets willig gehörte Ratgeber ist, der zuverlässigste Tröster und Freund.
Zu dieser großen Güte, die ein Ausfluss der Güte Jesu ist, muss im Priester ein lebendiger Glaube an die Wirksamkeit der Gnade kommen, deren Ausspender er ist. Mögen die Schwachheiten, die Sünden noch so groß sein, der Diener Christi muss fest an die Macht der Gnade glauben, damit er jedem in seinen Nöten Beistand leisten kann. Wie ein Kirchenvater sagt, wandelt Jesus jede Seele um, die guten Willen hat. «Er begegnet einem Zöllner und macht einen Evangelisten aus ihm; dem reuigen Schächer verspricht er den Himmel ... Eine Sünderin kommt zu ihm und er macht sie den Jungfrauen gleich» (HI. Johannes Chrysostomus, P. G. 52, Sp. 803 [Monastisches Brevier, Pfingstdienstag]).
Zuweilen fühlt der Priester, auch wenn er sich mit ganzer Seele seiner Aufgabe widmet, dass er das Ideal nicht zu erreichen vermag. Diese Erkenntnis darf ihn nicht entmutigen, denn gerade die demütige Gesinnung zieht den Segen Gottes auf sein Wirken herab.
Doch wenn er dem Herrn gefallen will, muss das Wissen um seine Nichtigkeit stets von grenzenlosem Vertrauen auf die Verdienste Jesu begleitet sein. «In ihm seid ihr an allem reich geworden: an jeglicher Rede und jeglicher Erkenntnis ... So steht ihr in keiner Gnadengabe zurück» (1 Kor 1, 5-7). Wenn die Erkenntnis unserer Armseligkeit uns niederdrücken will, dürfen wir mit vollem Recht wie der Apostel sprechen: «Ich kann alles in dem, der mich stärkt» (Phil 4, 13). Christus empfing das göttliche Leben vom Vater, um die Erlösung der Welt vollbringen zu können; so sind auch wir in unserm Wirken für die Seelen des himmlischen Beistandes sicher.
Jeden Morgen begegnen wir Jesus; sein Fleisch und sein Blut nähren unsere Seele. Sorgen wir dafür, dass wir ihn mit Glauben empfangen, um «ihn anzuziehen»: «Legt (als neues Gewand) den Herrn Jesus Christus an» (Röm 13, 14). Dann wird unser Herz erfüllt werden von Liebe und Mitgefühl für die Sünder, die Unwissenden, die Geprüften, für alle Leidenden. Und wie Jesus werden wir wünschen, dass alle zu uns kommen, um Erquickung zu finden: «Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen» (Mt 11,28).
ZWEITER TEIL: PRIESTERLICHES HEILIGKElTSSTREBEN
A. DIE TUGENDEN DES PRIESTERS
IV. Lebt aus dem Glauben
Wir erkannten, welches das Heiligkeitsideal ist, von dem alle Handlungen des Priesterlebens bestimmt sein sollen: sein Priestertum ist Teilnahme am Priestertum des menschgewordenen Logos.
Niemals werden wir dieses Ideal voll erreichen. Das müssen wir uns immer wieder sagen, sonst würden wir den Mut verlieren. Dennoch sollen wir das glühende Verlangen in uns tragen, nach diesem Ideal zu streben, mag es noch so erhaben sein. Dieses Verlangen wird unsern Eifer beleben und bewirken, dass das Bild des göttlichen Meisters allezeit vor unsern Augen steht.
Wissen wir uns nicht von der Überfülle seiner Gnade getragen?
Um uns darüber klar zu werden, wie sich unsere Heiligung vollzieht, wollen wir die wichtigsten Tugenden betrachten, die wir zu erstreben haben. Wohl sind sie für jeden Christen erforderlich, doch der Priester muss sie in der besonderen Weise üben, die seinem heiligen Amt, seiner Sendung zu den Seelen und der Heiligkeit entspricht, die der himmlische Vater von ihm erwartet.
1. Der Glaube, Lebensraum des Priesters
Der Wert unseres Lebens hängt von unserem Glauben ab: «Ohne Glauben aber ist es unmöglich, (Gott) zu gefallen» (Hebr 11,6). «Wenn unser Glaube nichtig ist, dann sind wir die Beklagenswertesten unter allen Menschen» (1 Kor 15, 19). Das gilt tausendfach für den Priester: ohne den Glauben wäre sein ganzes Leben eine Sünde gegen die Wahrheit.
Ist nicht schon sein Priestertum nur im Glauben zu verstehen? Seine Erhabenheit ist äußerlich in keiner Weise erkennbar. Unser «Gott ist ein verborgener Gott» (Jes 45,15). Gewiss, sein Wesen ist strahlendes Licht, das kein Dunkel kennt; doch wir sehen es nicht. Gott und alles, was er in uns und durch uns wirkt, ist Gegenstand des Glaubens.
Was bedeutet der Priester für einen Ungläubigen? Ein Mensch wie alle andern, der die Harmlosigkeit der guten Leute ausnützt und an dem nichts Besonderes ist außer seiner Kleidung. Oft hasst man ihn sogar um Christi willen. Nur im Glauben kann man erfassen, was der Priester ist.
Aber niemand ist mehr verpflichtet, an das Priestertum zu glauben, als der Priester selbst. Er muss sich im Glauben stets der grenzenlosen Herablassung bewusst sein, in der Gott ihn zu einer solchen Würde berief. Mehr noch als die Diakone, die St. Paulus ermahnt, «sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren» (1 Tim 3,9), ist der Priester dazu verpflichtet. Wir Priester leben in ständiger Verbindung mit der Eucharistie; darum müssen wir dafür sorgen, dass unser Glaube stets lebendig sei.
Es kann geschehen, dass man diese kostbare Gabe völlig verliert. Ich erinnere mich an einen armen Priester, den ich im Auftrag seines Bischofs besuchen sollte. Ich traf ihn zu Hause an, mit der Gefährtin seiner Sünde. Er lag im Sterben. Als ich ihm die großen Wahrheiten des Christentums vor Augen hielt, antwortete er mir: «Das sind doch alles nur Legenden und Dichtungen.» Es gelang mir nicht, seinen Glauben wieder zu erwecken. Wenn auch andere nicht so weit in die Irre gehen, so besteht doch für den Diener Christi immer die Gefahr, dass sein Glaube an Frische, an Freudigkeit und an Innigkeit verliert.
Es ist eine tiefe Freude, wenn man am Lebensabend wie St. Paulus zu Gott sprechen kann: «Ich habe den Glauben bewahrt» (2 Tim 4, 7). «Ich habe in allem den Glauben bewahrt» und mein Blick war stets auf die Ewigkeit gerichtet. Wo ist der Ursprung unserer Berufung zum Priestertum? Im Glauben unserer Jugend. Wenn unser Glaube stark ist, vermögen wir «in Gott zu leben», «für Gott leben» (Röm 6, 11). Ohne den Glauben sind wir nichts; wenn der Glaube erschlafft, schwinden mit ihm alle unsere Tugenden dahin.
Für das ganze Leben hat es große Bedeutung, in welchem Bereich sich unsere Gedanken für gewöhnlich bewegen.
Welches soll die Gedankenwelt des Priesters sein? Die gleiche wie die des Laien? Dorfgespräche ? Die letzten Nachrichten aus der Zeitung? Oder Bücher aus der profanen Literatur? Sicher nicht. Gewiss, der Priester muss sich über viele Dinge auf dem Laufenden halten, aber vor allem bedarf er eines echten Innenlebens, und dieses kann nur in der Atmosphäre des Glaubens gedeihen.
Denken wir an die Wohltaten Gottes und an die übernatürlichen Schätze, die er durch die Kirche seinen Kindern austeilt. Unsere Aufgabe ist es, Jesus Christus zu den Menschen zu tragen: «So sehr hat Gott die Welt geliebt ...» (Joh 3, 16). Da Gott uns Schätze des Heiles anvertraut hat, wird er Rechenschaft von uns fordern, wie wir sie gebrauchten.
Seien wir uns unserer Verantwortung stets bewusst. Die Überzeugung, dass wir nicht uns selbst gehören, ist ja doch grundlegend für unser Denken. Mit Paulus sprechen wir: «Ich gehöre Christus» (1 Kor 1, 12); und fügen wir hinzu: «Gebildeten und Ungebildeten bin ich verpflichtet» (Röm 1, 14). Können wir vor den Augen Gottes in Frieden leben, wenn wir wissen, dass eine der uns anvertrauten Seelen in Not ist und wir ihr nicht zu Hilfe kommen ?
Der Priester muss die WeIt mit gütigen Augen betrachten.
Doch er darf sich nicht vom Glanz der Dinge bezaubern lassen wie ein Jüngling, der nicht um die dunkle Kehrseite weiß. Der Diener Christi kann sich mit den Gütern der Erde nicht zufrieden geben; er muss sie mit den Augen des Herrn betrachten, d. h. mit den Augen des Glaubens, der ihm ihren Wert oder Unwert enthüllt.
Es ist von großer Bedeutung, dass die Gläubigen bei uns Priestern die übernatürliche Einstellung spüren; die Fruchtbarkeit unseres priesterlichen Wirkens hängt zu einem guten Teil davon ab.
2. Die Bedeutung des Glaubens
Der Glaube ist eine fundamentale Tugend. Ohne ihn ist Liebe, Frömmigkeit, ja überhaupt jede Tugend unmöglich. Der Glaube ist die Grundlage der übernatürlichen Verbindung mit Gott. Er ist nach der Absicht Gottes das Licht, das uns in der irdischen Prüfungszeit leiten soll. Unser Zugang zu Gott, der Gebrauch der besonderen Mittel, die unsere Vereinigung mit ihm sichern, unser Verdienst - das alles ist zum Teil in Dunkel gehüllt.
Auch die Engel hatten eine Prüfung des Glaubens zu bestehen. Denn weIcher Art immer die «Versuchung» gewesen sein mag, die über sie kam, sie mussten sich in voller Freiheit entscheiden, bevor sie zur beseligenden Anschauung Gottes zugelassen wurden.
Das Konzil von Trient fasst die Bedeutung des Glaubens in die Worte zusammen: «Das Heil des Menschen beginnt mit dem Glauben; dieser ist die Grundlage und die Wurzel jeder Rechtfertigung. Ohne den Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen und seinen Kindern zugesellt zu werden (Sess. VI, 8).» Unser Glaube ist der Beginn, die Grundlage, die Wurzel unseres Lebens als Kinder Gottes. Vertiefen wir uns ein wenig in die Worte des Konzils.
Wem gewährt Gott die Macht, seine Kinder zu werden? Der hl. Johannes verkündet es uns: Diese Gnade ist allein den Glaubenden vorbehalten: «allen, die an seinen Namen glauben» (Joh 1, 12). Und St. Paulus sagt: «Wer Gott nahen will, muss glauben», «wer zu Gott kommen will, muss glauben» (Hebr 11,6).
Der Glaube ist nicht nur für die Weckung des übernatürlichen Lebens erforderlich, sondern auch für dessen Wachstum und Entfaltung. Er ist wirklich Grundlage und Wurzel des inneren Lebens.
Warum legt man Grundsteine, wenn man ein Gebäude errichten will? Nicht nur, weil sie es ermöglichen, dass man dann mit dem Bauen beginnen kann, sondern auch, weil die Festigkeit, das Gleichgewicht und die Lebensdauer des Gebäudes davon abhängt.
Das gilt auch vom Glauben im Leben jedes Christen. Nur auf dem Fundament eines starken Glaubens können Hoffnung und Liebe gedeihen, kann das Gebet zu Gott emporsteigen. Wo sollten wir in der Stunde der Prüfung wie auch im Alltag Halt finden, wo wirksame Motive für unser Handeln, wenn nicht im Glauben? Deshalb ermahnt der heilige Paulus die Kolosser, «im Glauben festgegründet und beständig zu bleiben» (1,23).
Der Glaube hat auch die Aufgabe der Wurzel zu erfüllen; die Wurzel hält den Baum im Boden fest und führt ihm ununterbrochen, aber in unmerklicher Weise, Nahrung zu. Das Wachstum des Baumes und seine Entwicklung hängen von dieser verborgenen Ernährung ab. Sägt die Wurzeln ab, und der schönste, kräftigste Baum wird bald elend zugrunde gehen.
So groß ist die Bedeutung der Glaubensgewissheit. Sie übt unaufhörlich ihren Einfluss: sie verleiht dem Leben Adel, der Seele Kraft; ihr dankt es der Christ und besonders der Priester, dass er im Kampf mit den Mächten der Finsternis nie am Siege zweifelt: «Das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: unser Glaube» (1 Joh 5, 4).
Der hl. Paulus fasste diese Lehre, die ihm sehr teuer war, in ein kurzes Wort zusammen: «Der Gerechte lebt aus dem Glauben» (Gal 3, 11 ; Röm 1, 17 ; Hebr 10, 38). Wir können die praktische Bedeutung des Glaubens gar nicht hoch genug einschätzen, denn je stärker unser Glaube ist, desto mehr wird unser ganzes Leben neugestaltet, desto fester werden die Bande, die uns als Adoptivkinder mit dem himmlischen Vater verbinden.
3. Der Begriff des Glaubens
Worin besteht eigentlich der Glaube, aus dem wir leben sollen? Das (Erste) Vatikanische Konzil (Sess. IlI, cap. 1) gibt uns eine klare Definition davon: «Der Glaube ist eine übernatürliche Tugend, durch die wir unter der Eingebung und mit Hilfe der Gnade Gottes alles für wahr halten, was Gott geoffenbart hat; nicht mit dem natürlichen Licht des Verstandes können wir die innere Wahrheit der übernatürlichen Wirklichkeiten erfassen, sondern auf Grund der Autorität des offenbarenden Gottes selbst, der weder irren noch irreführen kann.»
Der Glaube ist die Huldigung unseres Geistes an die göttliche Wahrhaftigkeit. Gott aber hat vor allem durch den Mund Jesu und die inspirierte Verkündigung der Apostel zu uns gesprochen. Wenn der Mensch die göttliche Offenbarung mit all ihrem Licht und all ihrem Dunkel annimmt, dann wirft er sich gleichsam vor Gott nieder; er übergibt sich der souveränen und unfehlbaren Wahrheit und erweist dadurch Gott Verherrlichung.
Das Wesen des Glaubens besteht in dieser Unterwerfung des Verstandes, der der Ewigen Wahrheit zustimmt, wenn sie das göttliche Geheimnis und die Wege des Heiles enthüllt.
Der Glaube ist die Übereinstimmung unseres Verstandes - nicht mit den Auffassungen eines Menschen, sei er auch noch so gelehrt -, sondern mit den Gedanken Gottes selbst. Durch den Glauben machen wir uns diese Gedanken zu eigen; wir nehmen teil an der Erkenntnis, die Gott von sich selbst besitzt, und am Wissen um die Pläne seiner ewigen Vorherbestimmung. Mit tiefer Ehrfurcht müssen wir die göttliche Offenbarung annehmen: in ihrer Gesamtheit und in jeder einzelnen Wahrheit, die uns die Kirche - als höchster Richter auf diesem Gebiet - zu glauben vorschreibt. «Was wir von Deiner Herrlichkeit glauben, das glauben wir auf Deine Offenbarung hin» (Präfation von der allerheiligsten Dreifaltigkeit).
Der Glaube unterdrückt den menschlichen Verstand nicht, sondern erhebt ihn, er weitet ungeheuer die Grenzen menschlichen Erkennens und lässt den Gläubigen mit Sicherheit den Sinn des Lebens verstehen.
Der Glaube besteht notwendigerweise aus drei Elementen: aus einer Zustimmung des Verstandes, einem Akt des Willens, einer Einsprechung der Gnade, die gleichsam den ganzen Glaubensakt leitet.
Der Akt des Glaubens ist kein Vernunftschluss, also nicht eine Überzeugung, die der Verstand auf Grund von Argumenten gewinnt. Nein, er ist eine freiwillige, vertrauende, totale Unterwerfung des Geistes unter die Autorität des offenbarenden Gottes.
Warum fordert der Glaube die Mitwirkung des Willens? Wir wissen, dass wir Dinge, die außerhalb unserer menschlichen Erfahrung liegen, nicht durch eine schwierige, abstrakte Gedankenarbeit erfassen können. Deshalb enthalten die übernatürlichen Wahrheiten für uns immer viel Dunkel. Wenn wir die Offenbarung und ihre Lehren annehmen, erschließt sich unser Geist der göttlichen Wahrheit; er empfängt und nimmt auf, aber er wäre nicht dazu imstande ohne einen Akt des Willens, der Gott finden und sich mit ihm vereinen möchte. Die Gnade begleitet alle diese Akte; sie muss jedoch nicht fühlbar sein.
Der Anteil des Willens und der Freiheit macht den Glaubensakt vor Gott verdienstlich. Gott wollte uns genügend Dunkel belassen, damit der Glaube ein Akt tiefen Vertrauens in ihn sei, und er wollte uns genügend Klarheit geben, damit der Glaubensakt vernünftig sei.
Doch die Einwirkung der Gnade auf den Geist ist zum Glauben notwendig. Lesen wir das Evangelium. Die Zeitgenossen Jesu konnten ihn berühren, hören, ihre Sinne ihn wahrnehmen; der Verstand sagte ihnen, dass er ein hervorragender, hochstehender Mensch sei. Doch um sein göttliches Wesen zu erfassen und zu glauben, dass er der wahre Sohn Gottes war, brauchte es außer den Wundern und den Worten der Propheten ein Gnadengeschenk. Jesus selbst sagt es: «Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater» (Mt 16, 17). Und ein andermal sprach er: «Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht» (Joh 6, 44).
Der Glaube ist ein Geschenk des Himmels. Der Ungläubige muss demütig die Gnade seines Kommens erflehen und wir, die wir diese Gottesgabe besitzen, müssen um Wachstum des Glaubens bitten: «Ich glaube; hilf meinem Unglauben!» (Mk 9, 24).
Versuchungen gegen den Glauben sind immer möglich, aber sie sollen uns ein Ansporn zum Beten sein; durch sie wird unser Glaube lebendiger, erkennen wir besser, dass er eine übernatürliche, ungeschuldete Gabe ist. Setzen wir uns nicht durch Unterhaltungen oder Lektüre freiwillig der Gefahr des Zweifels an geoffenbarten Wahrheiten aus, aber ziehen wir Nutzen aus den Schwierigkeiten: schließen wir uns noch bewusster und fester an Christus und seine Botschaft an.
4. Das Vorrecht des Glaubens: er ist Beginn der beseligenden Gottesschau
Alle Lehren des Tridentinischen und des Vatikanischen Konzils über den Glauben sind implicite in dem Pauluswort enthalten: «Der Glaube ist das feste Vertrauen auf das, was man erhofft, die Überzeugung von dem, was man nicht sieht» (Hebr 11, 1).
Diese Worte besagen, dass der Glaube die Lebenskraft all unserer übernatürlichen Hoffnungen ist; er ist die Überzeugung von der Existenz der jenseitigen Welt, die wir nicht sehen, von der uns der ganze Hebräerbrief berichtet. Dieser inspirierte Text sagt uns, worin der wunderbarste Vorzug des Glaubens besteht: er ist die Morgenröte des himmlischen Lichtes; zwischen der beseligenden [[[Gottesschau]] und dem Glauben klafft kein Riss.
Wir kennen drei verschiedene Wirklichkeitsbereiche : den der Materie, den der Verstandeswahrheiten und die höhere Sphäre des Übernatürlichen. Jeden dieser Bereiche erfassen wir auf die ihm angepasste Weise.
Die stoffliche Natur mit ihrer Unermesslichkeit und ihrer Schönheit offenbart sich unserm Auge durch die Pracht ihrer Erscheinungsform.
Der Verstand betrachtet das Universum in einer anderen, höheren Art, denn er dringt von den Erscheinungen zu ihren Ursachen vor; er entdeckt in den Dingen die Spuren des Allmächtigen, der Schöpferweisheit, und gelangt so zur Erkenntnis der Existenz Gottes und seiner Vollkommenheiten. Das Licht, das wir mit den Augen wahrnehmen, ist zweifellos ganz anderer Art als das Licht, durch das der Verstand erkennt, überlegt und urteilt. Sie stehen nicht in Zusammenhang miteinander, gehören verschiedenen Ordnungen an.
Jenseits der Welt, die durch die Sinne und den Verstand erfasst werden kann, existiert eine dritte Sphäre, die transzendent, unzugänglich, göttlich ist. Es ist die des inneren Lebens der Dreifaltigkeit. «Gott wohnt im unzugänglichen Licht. Ihn hat kein Mensch gesehen, noch vermag er ihn zu sehen» (1 Tim 6, 16). Unsere übernatürliche Erhebung ermöglicht es uns, in die «Tiefen der Gottheit» einzudringen (1 Kor 2, 10). Im Himmel wird uns dieses göttliche Licht geschenkt, damit wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen können. «In Deinem Licht werden wir das Licht schauen» (Ps 36, 10).
Doch der Herr gestattet seinen Adoptivkindern, schon auf dieser Erde mit der jenseitigen Welt in Verbindung zu treten. Wie vollzieht sich dieses Wunder? Durch die Gnade des Glaubens. Der Glaube ist der Beginn der beseligenden [[[Gottesschau]].
Was geschieht im himmlischen Jerusalem? Das Licht der Verklärung verstärkt in den Heiligen auf wunderbare Weise die Fassungskraft des Verstandes und befähigt sie zur Anschauung Gottes. Gleichzeitig strahlt dieses Licht auf alle Akte des Erkennens, der Liebe, der Freude aus, die das Leben der ewigen Seligkeit ausmachen.
Spielt der Glaube auf der Erde nicht dieselbe Rolle? Im Dunkel, in aller Mühsal, in der Prüfung lässt er uns um die Nähe Gottes wissen; durch ihn können wir uns mit Gott vereinen; er lässt uns die unsichtbare Wirklichkeit erfassen, die Gegenstand unserer Hoffnung ist. Doch zugleich wirft er sein Licht auf alle Handlungen, die der Christ auf dem Wege zum Himmel zu vollbringen hat; alles übernatürliche Tun, das die Kinder Gottes darauf vorbereitet, dereinst das Glorienlicht zu empfangen, und das es ihnen ermöglicht, dieses Licht zu verdienen, muss seinen Ursprung im Glauben als einer nieversagenden Quelle haben. «Jetzt schauen wir wie durch einen Spiegel, unklar; dann aber von Angesicht zu Angesicht» (1 Kor 13, 12).
Der Glaube gehört der übernatürlichen Ordnung an; in der beseligenden Gottesschau findet er seine Entfaltung, seine höchste Blüte. Das Leben, das wir in der Taufe empfangen haben, entwickelt sich und wird umgestaltet. Der Glaube ist tatsächlich der erste Schimmer, die Morgendämmerung, das Morgenrot der ewigen Gottesschau. Der hl. Thomas fasst diese erhabene Lehre in die Worte zusammen: Der Glaube ist eine «Tugend, die dem Geist eigen ist; er leitet in uns das ewige Leben ein» (S. th. lI-lI, q. 14, a. 1).
5. Der Glaube an Christus, den menschgewordenen Logos
Gott ist für uns Gegenstand des Glaubens, besonders in der Person Christi. Er verlangt von uns den festen Glauben, dass das von Maria geborene Kind, der Arbeiter von Nazareth, der Lehrer im Kampf mit den Pharisäern, der Gekreuzigte von Kalvaria wirklich sein Sohn ist, sein Ebenbild, und dass wir ihn als solchen anbeten. Den Glauben an das menschgewordene Wort unter den Menschen begründen - dies ist das große Werk Gottes in seiner Heilsökonomie : «Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat» (Joh 6, 29).
Nichts vermag den Glauben an Christus, der wahrer Gott, gleichen Wesens mit dem Vater und sein Gesandter ist, zu ersetzen. Er ist die Synthese aller Glaubenssätze, weil Christus die Synthese der ganzen Offenbarung ist.
Das gilt für jeden Christen, vor allem aber für den Priester. Denn die Lebensberechtigung des Priesters liegt ja darin, dass er der Welt das Heil Christi, des Gottessohnes, bringt, der aus Liebe Mensch geworden ist. Das ganze Leben des Völkerapostels lässt sich mit den Worten kennzeichnen: «Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingeopfert hat» (Gal 2, 20), und unser ganzes Priesterleben muss diese Überzeugung bekunden.
Das Leben der Kirche hat immer und überall die Anbetung ihres göttlichen Bräutigams zur Voraussetzung. Vor aller Welt, die ihn leugnet und verkennt, beteuert sie mit Petrus: «Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes» (Mt 16, 16).
Diese kraftvolle Glaubensschau, die den Schleier der Menschheit Christi zerreißt und sich in die Tiefen seiner Gottheit versenkt, fehlt leider vielen Geistern. Sie sehen Jesus, sie berühren ihn, aber es bleibt bei ihnen wie bei dem Volk Galiläas ein rein äußerliches, oberflächliches Anschauen, das die Seele nicht umgestaltet.
Andere hingegen sehen Jesus verklärt; die Gnade erleuchtet ihren Glauben an seine Gottheit. Sie sehen in Jesus die Sonne der Gerechtigkeit; alle Schönheit der Erde verblasst vor ihm, und sein Anblick entzückt ihre Herzen so sehr, dass keine Lockung sie von seiner Liebe scheiden kann. Mit Paulus dürfen sie sprechen: «Ich bin überzeugt: Weder Tod noch Leben ... noch sonst etwas Erschaffenes vermag uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Jesus Christus, unserm Herrn» (Röm 8, 38-39).
Wo ein solcher Glaube lebt, dort hat Christus wahrlich eine sichere Wohnstätte gefunden. Dieser Glaube ist nicht eine einfache Zustimmung des Geistes; er schließt Liebe, Hoffnung und Totalhingabe seiner selbst an Christus in sich; den Willen, sein Leben zu leben, an seinen Geheimnissen teilzuhaben, seine Tugenden nachzuahmen.
Es gibt Christen - und sogar Priester -, für die Jesus niemals zur Quelle ihres geistlichen Lebens geworden ist. Sie glauben ohne lebendige persönliche Überzeugung, dass er Gott ist, doch dieser Glaube ist für sie nicht die Wurzel und die Grundlage ihrer ganzen Religion. In der Praxis übersehen sie das so klare Pauluswort: «Niemand kann einen andern Grund legen als den, der gelegt ist: Jesus Christus» (1 Kor 3, 11). Deshalb bleibt ihr Wirken oft ohne Frucht.
Wir müssen uns Christus zu Füßen werfen und ihm die Huldigung eines ganz lebendigen Glaubens darbringen: «O Jesus, obwohl ich Dich nicht in der Herrlichkeit Deiner Gottheit sehe, bekenne ich, dass Du der Sohn des lebendigen Gottes bist, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott». Im geistlichen Leben ist es von höchster Bedeutung, dass unser Aufstieg zu Gott sich auf den Glauben an das menschgewordene Wort stützt.
Doch es genügt nicht, einmal diesen festen Vorsatz gefasst zu haben; alle Tage müssen unsere Kräfte durch diesen Glauben erneuert, muss unsere Hochherzigkeit belebt werden. Je vollkommener dieser Glaube ist, desto mehr Anteil gibt Christus uns an seiner Gottessohnschaft. Es ist das beste, was Jesus besitzt - und er gibt es uns.
Diese Lehre beruht auf folgender Erwägung: Der Glaube ist die Teilnahme an der Erkenntnis, die Gott von sich selbst und von allen Dingen in ihm hat. Durch die Übung dieser Tugend wird unser Leben gleichsam ein Widerschein des seinen. Wenn die Seele von Glauben erfüllt ist, sieht sie sozusagen mit den Augen Gottes.
Der Vater betrachtet von Ewigkeit her seinen Sohn. Er erkennt und liebt alles in ihm. Dieser Blick und diese Liebe gehören zu seinem Wesen. Auch jetzt, in diesem Augenblick, betrachtet er den Logos, der ihm wesensgleich ist, der aus Liebe Mensch geworden ist.
Der Vater liebt seinen Sohn unendlich, göttlich, wie er allein es vermag; deshalb gehört er ihm auch ganz; alles, was er tut, bezweckt seine Verherrlichung: «Ich habe ihn verherrlicht, und ich will ihn noch weiter verherrlichen» (Joh 12,28). Er will, dass sein Sohn von den vernunftbegabten Geschöpfen mit der Ehrfurcht betrachtet werde, die seiner Gottheit zukommt. Als er ihn in die Welt sandte, wollte er, dass alle Engel ihn anbeten: «Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen» (Hebr 1, 6). Von den Menschen verlangt er die gleiche Huldigung. Der Vater will, dass alle seinen wesensgleichen Sohn ehren: «damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren» (Joh 5, 23). Und hat er nicht am Tabor gefordert, dass alle den Worten Jesu glauben, weil es die Worte seines vielgeliebten Sohnes sind? «Das ist mein geliebter Sohn … auf ihn sollt ihr hören» (Mt 17,5).
Wenn wir Christus mit den Augen des Vaters betrachteten, wäre unsere Bewunderung für die Würde seiner Person, das Ausmaß seiner Verdienste, die Macht seiner Gnade grenzenlos. Mögen unsere Sünden und unsere Unwürdigkeit noch so groß sein, Christus leistet in unerschöpflichem Erbarmen Genugtuung für uns. In unserem Elend sind wir «reich in Christus», «an allem reich geworden [seid] in ihm» (1 Kor 1,5). Die Überfülle der Verdienste eines Gottes ist für die Kirche, deren Eigentum sie ist, eine nieversagende Quelle der Danksagung, des Lobpreises, des Friedens und unbeschreiblicher Freude.
Vor allem von uns Priestern, die wir so häufigen Kontakt mit dem Geheimnis der Eucharistie haben, fordert der Glaube an die Gottheit Christi die tiefste Ehrfurcht vor dem Gottessohn: «Verehren wir tiefgebeugt». Wenn Jesus seine Herrlichkeit verbirgt, beten wir umso mehr die unfassbare Tatsache seiner Gegenwart an. In dem Maße, in dem wir aus dem mysterium fidei leben, wächst unsere Liebe zu ihm. «Die Himmelsgabe [zu] lieben, die sie so oft empfangen» (Oratio super populum, am Donnerstag der 1. Fastenwoche). Unendliche Milde bestimmt Christus, seine Herrlichkeit vor unsern Augen zu verbergen, damit wir in unserer Schwachheit nicht fürchten, ihm zu nahen. Eine solche Güte müsste bewirken, dass unser Glaube den Schleier zerreißt und wir uns anbetend dem Gottessohn zu Füßen werfen.
Denken wir daran, wenn wir vor dem Tabernakel oder beim Schlussevangelium unser Knie beugen, wenn wir im Gloria das «Sohn des Vaters» und im Credo das «Er ist Fleisch geworden» - und so manche andere Texte der Schrift oder der Liturgie - aussprechen. Und sagen wir dem Heiland, den wir hier gegenwärtig wissen: «Im Kind, das in der Krippe liegt, im Arbeiter von Nazareth, im Gekreuzigten, unter den Gestalten von Brot und Wein bete ich Dich an als meinen Gott, o Jesus Christus; ich liebe Dich und ich bejahe Dich mit allem, was Du bist und was Du mir auferlegst.»
6. Drei Eigenschaften des priesterlichen Glaubens
Es ist von großer Wichtigkeit, dass der Glaube des Priesters vollkommener sei als der des einfachen Gläubigen. Da er dazu berufen ist, den Seelen die Geheimnisse der Religion zu verkünden, muss er imstande sein, deren Wert zu erfassen: «damit ihr einseht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid», «welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt» (Eph 1, 18).
Drei Eigenschaften sollen dem Glauben des Priesters besonders eignen: er soll mit ganzer Kraft die Wahrheit bejahen; er soll Klarheit haben über den ganzen Glaubensinhalt, der der Gesamtheit des Glaubens der Kirche entspricht; und schließlich muss er wirksam sein, d. h. er muss beherrschenden Einfluss auf alle Handlungen seines Lebens haben.
Wenn der Glaube die Zustimmung des Geistes zu den von Gott selbst geoffenbarten Wahrheiten ist, wenn er die Antwort des Menschen auf die göttliche Mitteilung darstellt, wird diese Zustimmung kraftvoll, fest, unbedingt sein.
Als Petrus in den Wellen des Sees Genesareth zu versinken drohte, rief er: «Herr, rette mich!» (Mt 14,30). Er glaubte noch an Jesus, als er ihn rief, aber sein Glaube war wankend; der Herr machte es ihm auch zum Vorwurf. Doch als er auf dem Tabor zum göttlichen Meister sprach: «Hier ist gut sein» (Mt 17, 4), oder auch nach der Verheißung der Eucharistie: «Zu wem sollten wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens» (Joh 6, 68), da war sein Glaube stark. Maria glaubte auf Kalvaria aus ganzer Seele. Sie war im Vollsinn des Wortes die getreue Jungfrau. Trug sie nicht schon damals den lebendigen Glauben der ganzen Kirche in der Seele? «Virgo fidelis . .. continens fidem vivam totius Ecclesiae in corde suo.» (Wir haben die Quelle dieses Zitates nicht gefunden. Albert der Große schreibt von Maria: «Fidem habuit in excellentissimo, quae ... etiam discipulis dubitantibus, non dubitavit.» [In Luc. I, Gratia plena]).
Um zu erfassen, was ein kraftvoller Glaube ist, betrachten wir noch andere Bilder aus der Heiligen Schrift; sie sind immer die besten. Wenn Paulus von Abraham spricht, scheint er von heiliger Begeisterung erfüllt zu sein. So groß war der Glaube des «Vaters der Gläubigen», dass er entgegen jeder menschlichen Hoffnung mit absoluter Festigkeit, ohne Zweifel die göttliche Verheißung für wahr hielt: «Entgegen aller Hoffnung hat er gehofft und geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde … Er wurde im Glauben nicht schwach, obwohl er wahrnahm, dass sein Leib schon erstorben war; er war ja beinahe hundert Jahre alt» (Röm 4, 18-19).
Als der Hauptmann, von dem das Evangelium berichtet, bekennt, dass Jesus Macht hat über die körperlichen Leiden wie er über seine Soldaten, wundert sich Jesus : «Wahrlich, ich sage euch, so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden» (Mt 8,10). Und in der Szene mit der kananäischen Frau, die nicht aufhört, die Güte und Macht des Meisters anzuflehen, obwohl Jesus sie zurückweist und mit scheinbarer Härte behandelt, sehen wir den Herrn gleichsam überwältigt, als ob die Beharrlichkeit des Glaubens dieser Frau einen unwiderstehlichen Zauber auf ihn ausübte: «O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe nach deinem Wunsche!» (Mt 15,28).
Und im Hebräerbrief zeigt der Apostel mit sichtlicher Freude, wie alle Patriarchen und die Gerechten des Alten Bundes im Glauben große Dinge für Gott zu tun vermochten: «Durch ihren Glauben bezwangen sie Königreiche, schafften Recht, empfingen Verheißungen» (Hebr 11,33).
Wenn wir Priester mit solch edlem Starkmut in jedem Augenblick aus dem Glauben zu leben suchen, so schließen wir uns den Heiligen an, die im Alten wie im Neuen Bund ihre übernatürliche Kraft aus einem unerschütterlichen Festhalten an der Offenbarung schöpften.
Ferner gehört zur Vollkommenheit des Glaubens, dass er klar sei. Es könnte in der Tat vorkommen, dass er zwar kraftvoll wäre, sich aber nicht auf hinreichendes Wissen stützen könnte. So war es bei dem Blindgeborenen, den Jesus heilte; als Jesus ihn fragte, ob er an den Sohn Gottes glaube, antwortet er mit einem Akt starken Glaubens, lieferte sich ganz dem Erlöser aus: «Ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder und betete ihn an» (Joh 9, 39). Hinsichtlich der Zustimmung war sein Glaube vollkommen. Doch es fehlte ihm klares Wissen; er kannte noch nicht die Fülle der Wahrheit und der Lehre, die der menschgewordene Logos der Welt verkündet hat. Dieser Glaube nimmt zwar alle geoffenbarten Wahrheiten an, aber einschlussweise, gesamthaft, ohne sie zuvor in ihren Einzelheiten zu kennen.
So wertvoll und wirksam ein solch spontaner, großmütiger Glaube auch sein mag, er kann nicht genügen, wenn im einzelnen oder in der Gemeinschaft das Verlangen nach Klarheit erwacht. Der Verstand will die Gegenstände des Glaubens erkennen, unterscheiden, präzisieren. Aus diesem Verlangen entstand im Laufe der Zeit die Theologie. Diese macht es sich zur Aufgabe, innerhalb der Möglichkeiten des menschlichen Geistes den Inhalt der Offenbarung zu erfassen, zu analysieren, zu ordnen. Der Begriff der Theologie ist in dem Wort des hl. Anselm richtig umschrieben: «Der Glaube auf der Suche nach dem Verständnis für sein Objekt» («Fides quaerens intellectum»: Proslogium, P. L. 158, Sp. 225).
Die Pflege des Glaubens ist für uns Priester umso wichtiger, als es unsere Aufgabe ist, den Glauben des Volkes zu mehren, ihn gegen die Angriffe der Häretiker und der Gottlosen zu verteidigen. Erinneren wir uns an das Schriftwort: «Weil du das Wissen (um heilige Dinge) verworfen hast, schließe ich dich aus meinem Priestertum aus» (Hos 4,6).
Es kommt zuweilen vor, dass die theologischen Studien keinen Einfluss auf das persönliche Innenleben des Priesters ausüben. Das ist bedauerlich. Man muss das, was sich der Geist erarbeitet hat, durch fromme Lektüre, durch Betrachtung und Gebet fruchtbar machen. Dann wird der Priester über jenes lebendige theologische Wissen verfügen, das das Zentrum der priesterlichen Heiligkeit sein soll.
Unter dem Studium der Theologie - wohlverstanden, ich meine damit nicht die Beschäftigung mit Spitzfindigkeiten, nicht die Durcharbeitung von Lehrbüchern zu dem Zweck, sich die notwendigen Kenntnisse für eine Prüfung anzueignen - verstehe ich das Studium der Kirchenväter, der wichtigsten Lehrer des Glaubensgutes, besonders des hl. Thomas. Ich meine vor allem die Vertiefung in die Heilige Schrift, die der kostbare Besitz der Braut Christi ist. Die Kirchenlehrer und die größten Theologen haben sich auf diese Weise gebildet. Und bis ans Ende der Zeiten wird das Buch der Bücher die wahre Quelle für die Theologie bleiben.
Trifft man nicht oft Priester, die in ständigem Kontakt mit den Glaubensgeheimnissen stehen, ohne daran zu denken, ohne auch nur zu versuchen, sie besser kennenzulernen ? Sie verbringen ihr Leben inmitten göttlicher Wirklichkeiten; am Altar, im Beichtstuhl, auf der Kanzel sind sie stets in Berührung mit den übernatürlichen Kräften. Doch weil es ihrem Glauben an Klarheit fehlt und ihre Frömmigkeit nicht theologisch unterbaut ist, entgehen ihnen viele Gnaden, sehr zum Schaden für ihr seelsorgliches Wirken; viel Licht und Wärme geht ihnen verloren und ihre Seele bleibt mitten im Überfluss hungrig. Der Priester soll danach streben, die Offenbarung, die Jesus uns brachte, so vollständig als möglich zu kennen. Ist Christus nicht die Ewige Weisheit?
In unserer Zeit (Dom Marmion spielt auf den Modernismus an) besteht die Gefahr, dass der Glaube jener, die sich höheren Studien widmen, an Reinheit und Frische verliert. Der Geist einer oft übertriebenen Kritiksucht hat auf allen Gebieten um sich gegriffen: Geschichte, Theologie, Heilige Schrift. Wer nicht auf der Hut ist, läuft Gefahr, dass sein Glaube geschwächt wird, ja, dass er ihn völlig verliert. Gegen diese Gefahr kann man sich schützen, indem man die Ehrfurcht vor der traditionellen Lehre hochhält.
Dadurch wird weder der Fortschritt ausgeschlossen noch das Studium verschiedener moderner Geistesrichtungen; doch man muss alles von der hohen Warte aus beurteilen, auf die uns eine vertiefte Kenntnis der Theologie stellt. (Unter den Notizen Dom Marmions haben wir folgendes Zitat von POPE gefunden: «Seid nicht die ersten, die versuchsweise Samen ausstreuen; doch seid auch nicht die letzten, die Veraltetes aufgeben» (Essay on Criticism).
Weisen wir jede Irrlehre zurück; sie ist der Feind der offenbarten Wahrheit, der Gedanken Christi. Doch zeigen wir unsern Brüdern, die Opfer des Irrtums geworden sind, stets das größte Wohlwollen (Siehe: Dom Marmion et les protestants, in: Présence de Dom Marmion, Paris, Desclée, 1848).
Bemühen wir uns, unsere Arbeit übernatürlich aufzufassen. Beginnen wir nie unser Studium, ohne zuvor gebetet zu haben. Prüfen wir unsere Absichten: alles sei auf Gott, auf die Wahrheit ausgerichtet. Manche betreiben mit großem Eifer theologische Studien, «um als berühmte Gelehrte angesehen zu werden», sagt der hl. Bernhard; das ist eine beschämende Eitelkeit (In Cantic., Sermo 36, 1-3). Wer in dieser Gesinnung arbeitet, für den kann das Studium nicht zur Grundlage von Heiligkeit werden. Es ist das eine Wissenschaft, von der der Heilige Geist sagt: «Wissenschaft macht überheblich» (1 Kor 8,1) und: «Die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott» (1 Kor 3,19). Man könnte hinzufügen: «und vor den Menschen», denn es gibt nichts Widerlicheres als einen Priester, der von seinen Erfolgen berauscht ist und glaubt, seine intellektuelle Überlegenheit gebe ihm Anrecht auf besondere Achtung. Machen wir uns in Bezug auf unser Wissen nichts vor: in diesem Leben werden unsere Kenntnisse stets sehr beschränkt sein.
Betreiben wir unsere Studien, um dem Reich Gottes, der Ehre Gottes, der Kirche zu dienen, das Glaubensgut gegen alle Angriffe zu verteidigen, dem christlichen Volk den Glauben in seiner ursprünglichen Reinheit und Kraft zu bewahren, und auch, um in uns selbst die Erkenntnis Christi und seiner unvergleichlichen Geheimnisse zu vertiefen.
Ich wiederhole: Unsere Theologie soll lebendig, Grundlage der priesterlichen Heiligkeit sein.
Auch die geistliche Lesung hat große Bedeutung im Leben des Priesters. Es ist gefährlich für ihn, wenn er zuviel mit profanen Angelegenheiten zu tun hat und für Lektüre eingenommen ist, die keinen übernatürlichen Geist atmet. Auch jene, die sich dauernd mit klassischen Studien beschäftigen, brauchen ein Gegenmittel, um die Lebendigkeit ihres Glaubens zu bewahren.
Ein Professor, ein überlasteter Seelsorger verfügen nicht über viel Zeit für zusätzliche Studien; das ist richtig; aber kann man sich nicht jeden Tag der geistlichen Lesung widmen, der lectio divina, wie der hl. Benedikt sie nennt? Man wird nach einiger Zeit mit Staunen feststellen, wie sehr diese Übung, sogar «in kleiner Dosis», den Verstand mit großen Gedanken erfüllt, das Herz erwärmt und die Seele in Verbindung mit den göttlichen Geheimnissen erhält.
Wenn der Priester regelmäßig die Heilige Schrift liest und ihren Inhalt dem Gedächtnis einprägt, werden ihre Worte zu einer nieversiegenden Quelle in seinem Herzen.
Verstehen wir wohl: In der Eucharistie verbirgt sich das Göttliche Wort unter den heiligen Gestalten und umgibt sich mit erhabenem Schweigen; in der Heiligen Schrift teilt es sich durch menschliche Worte mit, die sich unserer Sprechweise anpassen.
Das Göttliche Wort ist in sich unfassbar, ist es doch unendlich. Der Vater drückt in seinem Sohn sein ganzes Wesen und Wissen aus. In der Heiligen Schrift lesen wir nur eine kurze Silbe des unübersetzbaren Wortes, das der Vater in seiner Unermesslichkeit spricht. Im Himmel werden wir dieses fortklingende Wort betrachten, wir werden in sein Geheimnis eingeführt werden; doch schon hienieden wollen wir ehrfurchtsvoll aufnehmen, was die Heilige Schrift an Offenbarungsgut und göttlichem Wissen enthält.
Wie ich schon sagte - man kann es nicht oft genug betonen -, sahen während des Erdenlebens Jesu viele nur sein Äußeres; sie ahnten nicht, dass sich hinter dieser Menschengestalt die Gottheit verbarg; das menschgewordene Wort blieb ihnen verhüllt. So bleiben auch viele beim menschlichen Element der Bibel stehen und finden unter dieser Hülle nicht die göttliche Offenbarung.
Gläubige Einstellung hindert niemanden an kritischer Arbeit, doch wenn wir wollen, dass der Logos, der in den heiligen Texten gegenwärtig ist, zum Vermittler des Heils werde, müssen wir uns beim Studium ständig sagen: «Hier ist das ewige Wort niedergelegt, die Botschaft Gottes.»
Wenn wir den Seelen nützen wollen, können wir gar nicht genug das Pauluswort beachten: «Das Wort Christi wohne in reicher Fülle unter euch» (Kol 3, 16), (Dom Marmion gab in dieser Hinsicht das beste Beispiel. Ein Großteil der segensreichen Wirkung, die seine Schriften ausüben, ist der häufigen und glücklichen Verwendung der Heiligen Schrift zuzuschreiben. Siehe: Dom Marmion et la Bible, von D. Rousseau; Saint Paul et Dom Marmion, von P. Byuz, in La vie spirituelle, Januar 1948).
Der Glaube in der Seele des Priesters sei endlich auch tätig. Da er die Grundlage des ganzen geistlichen Gebäudes ist und die Wurzel, aus der das Wachstum unseres Lebens als Gotteskinder hervorgeht, kann er nicht untätig, nicht unfruchtbar bleiben, sondern muss unser ganzes Leben durchdringen und beherrschen: er muss unsere Urteile beeinflussen, unsere Handlungen bestimmen, unsern Eifer anspornen, das sein, was der Apostel meint: ein «Glaube, der sich in der Liebe auswirkt» (Gal 5, 6).
In den Mitmenschen erblickt solcher Glaube vor allem die Seele, die durch die Liebe, durch das Blut Christi erlöst wurde und zum ewigen Leben bestimmt ist. Dieser Glaube wird zur Triebkraft für all unsern Dienst an ihnen.
Die Ereignisse beurteilt er, wie Christus sie bewerten würde. Die Wege Gottes sind unergründlich wie sein Wesen; doch der Priester, der aus dem Glauben lebt, weiß, dass Gott die Liebe ist - «Gott ist die Liebe» (1 Joh 4, 8). Will der Herr nicht durch Leiden jene, die er liebt, läutern und festigen? Wie die Passion Christi die Quellen der Gnade zum Strömen brachte, so haben die Leiden und Prüfungen des Christen, und erst recht die des Priesters, vor Gott hohen Wert.
Der Niedergang des Glaubenslebens in unsern Tagen kann auch die Diener Christi beeinflussen. Manche meinen, wenn man Seelen gewinnen und das Reich Christi ausbreiten will, sei die äußere Arbeit die Hauptsache, ja, fast das einzige, was zu tun sei. Der persönlichen Heiligkeit des Priesters und dem Gebet messen sie kaum Bedeutung für die Rettung der Welt bei; sie glauben, durch kühne Initiative, neue Methoden und intensive Tätigkeit könne die Aufgabe gemeistert werden.
Doch wir wissen es: die Rettung der Seelen und ihre Heiligung gehören wesentlich der übernatürlichen Ordnung an. Jede menschliche Tätigkeit, die nicht von der Gnade befruchtet wird, ist außerstande, auch nur eine einzige Seele zu bekehren oder zu heiligen. Ist es nicht Gott, der das Menschenherz in seinen Händen trägt? Daher muss all unser Wirken vom Glauben her bestimmt sein und wir müssen unsere Hoffnung vor allem auf das Gebet, den Gehorsam und die Hilfe des Herrn setzen.
In den Heiligen ist der Glaube wie ein Feuer, das Wärme und Licht spendet. Das Geheimnis dieses sich mitteilenden, gewinnenden Glaubens ist die mitreißende Kraft, die einer starken Überzeugung eigen ist. Den Heiligen erschien die übernatürliche Welt, wenn auch verhüllt, so doch ebenso greifbar wie die Realitäten dieses Lebens; deshalb ließen sie sich auch von den größten Schwierigkeiten nicht niederdrücken. Sie strauchelten nicht auf dem Weg; den Blick auf die ewigen Wahrheiten gerichtet, gingen sie voran und errangen schließlich den Sieg: «Das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: unser Glaube» (1 Joh 5, 4).
Wenn der hl. Paulus ausrief: «Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes» (Gal 2, 20), spüren wir da nicht in seinen Worten den herrlichen Stolz seines Glaubens an das Geheimnis Christi, die heilige Freude, die das Herz des Apostels schwellt? Die volle Annahme der Botschaft Jesu, des Gottessohnes, der vom Vater gesandt wurde, um uns zu heiligen, müsste auch unsere Seele erheben, mit Stolz und Freude und unwiderstehlicher Kraft erfüllen.
Die geoffenbarten Wahrheiten bilden, wie gesagt, gleichsam eine höhere Welt, die über dem Elend dieses Lebens steht. Dort soll die geistige Heimat des Priesters sein. Da die Grundsätze des Glaubens sein Leben bestimmen, lebt seine Seele sozusagen in dieser übernatürlichen Welt. Dadurch, dass er sich ständig auf das Wort Gottes stützt, erhält sein Glaube volle Lebendigkeit und wird zur Verherrlichung Christi auf seine ganze priesterliche Tätigkeit ausstrahlen; so wird es dem Priester möglich, alle Ereignisse zu meistern.
Es kann vorkommen, dass zwei Priester die gleiche äußere Aufgabe zu erfüllen haben. Der eine, der von Liebe erfüllt ist, gewinnt großen Einfluss auf die Seelen; sein Wirken ist Gott wohlgefällig und fruchtbar für die Kirche. Der andere hingegen, dessen persönliches Innenleben ohne Schwung ist, wird keinerlei bleibenden Erfolg in der Seelsorge erzielen. Die Ursache für diese Verschiedenheit liegt in der Beschaffenheit ihres Glaubens. Der Glaube ist die einzige Wurzel der Liebe.
V. «DER SÜNDE STERBEN»
Das Evangelium hat für den Priester - wie für jeden Christen - klar die zwei Grundbedingungen des Heiles aufgezeigt: den Glauben und den Empfang der Taufe: «Wer glaubt und und sich taufen lässt, wird gerettet werden» (Mk 16, 16).
Nach den Betrachtungen über den Glauben wollen wir jetzt die Gnade des Lebens betrachten, das wir in der Taufe empfingen. Diese Gnade ist wie ein Keim, der wachsen will und den jeder Getaufte während seines ganzen Lebens unaufhörlich entfalten soll.
Der heilige Paulus beschreibt die übernatürliche, geheimnisvolle Macht der Wirkungen, die von der Taufe ausgehen: «Wir sind durch die Taufe auf den Tod mit ihm begraben. Wie aber Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferstanden ist, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln» (Röm 6, 4).
Diese Worte vermitteln uns in einer Gesamtschau die Wesenselemente unserer Heiligung, und die Richtung, die unser Tugendstreben einschlagen soll.
Die Wege und die Gedanken Gottes sind nicht die unsern. Er selbst sagt es uns: «Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege ... So hoch der Himmel über der Erde, so hoch sind meine Wege über euren Wegen» (Jes 55, 8-9).
Um die Welt zu heiligen, wählte er das, was Paulus die «Torheit des Kreuzes» nennt (1 Kor 1,18).
Wer hätte je geglaubt, dass für das Heil der Menschen der eingeborene Sohn Gottes der Schmach von Kalvaria und dem Tod am Kreuz ausgeliefert werden müsste? Und doch, was den Menschen Torheit dünkt, ist der Plan, den die göttliche Weisheit ersann: «Was der Welt töricht erscheint, hat Gott auserwählt, um die Weisen zu beschämen» (1 Kor 1, 27).
Die Welt wurde durch den Tod und die Auferstehung Christi erneuert, und jeder Christ muss, wenn er gerettet und geheiligt werden will, geistig am Geheimnis dieses Todes und dieser Auferstehung teilnehmen. Der Inbegriff aller evangelischen und priesterlichen Heiligkeit ist Teilnahme an diesem zweifachen Geheimnis.
1. Es ist notwendig, der Sünde zu sterben
Die Seele kann sich nur in dem Maße mit Gott vereinen, als sie ihm ähnlich ist. Wenn Gott eine Seele an sich ziehen und erheben soll, muss er sich in gewissem Sinn mit ihr identifizieren können; deshalb hat er sie ja von Anfang an nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen.
Nach den Absichten Gottes ist der Mensch das Bindeglied zwischen der reinen Geistigkeit der Engel und der Materie; er soll vollkommener als die materielle Schöpfung das Wesen Gottes widerspiegeln: «Nur wenig unter die Engel hast du ihn gesetzt; mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt» (Ps 8, 6). Mit Entzücken betrachtet der Psalmist das Werk Gottes im Universum: «O Gott, wie wunderbar ist doch dein Name auf Erden» (Ebd. 1).
Dieser großartige Plan wurde durch Adams Schuld durchkreuzt. Die Sünde hat im Menschen die Herrlichkeit des Gottesbildes zerstört und ihn unfähig gemacht, sich mit Gott zu vereinigen.
Doch in seiner unendlichen Güte hat der Herr beschlossen, den durch die Sünde entstandenen Schaden «wunderbarerweise» wieder gut zu machen. Wir wissen, wie sich diese Wiedergutmachung vollziehen sollte: durch das Kommen eines zweiten Adam, Jesus Christus, dessen erbarmungsvolle Gnade uns zu Gotteskindern macht, seinem Bildnis gleichförmig, befähigt zur Vereingung mit Gott: «Denn wie in Adam alle dem Tode verfallen sind, so werden in Christus alle das Leben haben» (1 Kor 15, 22).
Die Taufe ist das Heilsmittel, das Gott eingesetzt hat, um in der Seele die Erbsünde zu tilgen und den Keim übernatürlichen Lebens in sie einzusenken. Dieses Wunder kann das Sakrament durch die fortwirkende Kraft des Sterbens und der Auferstehung Christi vollbringen. Diese Kraft bringt in der Seele einen Zustand des Todes und einen Zustand des Lebens hervor, die ihren Ursprung in Christus haben. Wie er selbst «dies alles leiden musste und so in seine Herrlichkeit einging» (Lk 24, 26), so soll jeder Christ geistig dieses Sterben mitvollziehen, damit er das göttliche Leben empfange.
So ist Christus gleichzeitig Urbild und Quelle unserer Heiligung: «Denn sind wir mit ihm durch die Ähnlichkeit mit seinem Tod verwachsen, so werden wir es auch durch die Ähnlichkeit mit seiner Auferstehung sein» (Röm 6, 5).
Was verstehen wir unter dem geistigen Sterben, das die Taufgnade in uns einleitet?
Es gehört vor allem dem Bereich des Freiwilligen an: durch die Eingießung der heiligrnachenden Gnade und der Liebe richtet die Taufe die Seele und ihre Kräfte auf den Besitz Gottes aus. Die Erbsünde hatte bewirkt, dass sich der Mensch von Gott, seinem einzigen übernatürlichen Ziel, radikal abwandte. Die Gabe der Liebe ändert diese Grundhaltung der Seele; sie vernichtet in ihr die Herrschaft der Sünde und öffnet ihr den Zugang zum göttlichen Leben.
Wir dürfen nie vergessen: der Besitz der heiligmachenden Gnade genügt nicht, damit die traurige Fähigkeit zum Sündigen in uns völlig erstorben sei. Die Taufgnade lässt viele schlechte Neigungen in uns weiterbestehen, und aus ihnen geht das hervor, was St. Paulus die «Werke des Fleisches» nennt (Gal 5, 19).
Das Sakrament der Buße, das zwar die aktuelle Herrschaft der Sünde vernichtet, bewirkt ebenso wenig wie die Taufe ein völliges Sterben. Die oder jene Anhänglichkeit, tiefeingewurzelte Gewohnheiten, mehr oder weniger freiwillige Neigungen verbünden sich mit den Wünschen der Natur und werden immer wieder Anlass zur Sünde.
Dieses «Der Sünde sterben» wurde zwar durch die Rechtfertigung, die wir in der Taufe empfingen, begonnen und es wird durch die Wirkung des Bußsakramentes gefördert; aber es kommt nur dann zur Vollendung, wenn wir uns mit Hilfe der Gnade persönlich darum bemühen; wir müssen uns anstrengen, unsere Seele immer mehr von allem zu befreien, was das übernatürliche Leben hemmen könnte.
In den Apostelbriefen wird mehrmals auf die absolute Notwendigkeit hingewiesen, auf alles zu verzichten, was uns ein Hindernis auf dem Weg zu Gott sein könnte. Der heilige Petrus schreibt im gleichen Sinn wie der heilige Paulus: «damit wir der Sünde absterben und der Gerechtigkeit leben» (1 Petr 2, 24). Diese Worte sind nur eine Erklärung des Herrenwortes: «Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein» (Joh 12, 24-25).
Dieses Sterben ist notwendig; es ist nicht das Ziel, wohl aber eine wesentliche Vorbedingung für das neue Leben. Es ist unerlässlich, dass das Weizenkorn in der Erde stirbt; doch diese Vernichtung wird Ausgangspunkt eines schöneren, vollkommeneren, fruchtbareren Lebens.
Verstehen wir die Sprache des heiligen Paulus recht. Leben besagt die Fähigkeit, selbst zu handeln. Wir sagen von einem Wesen, dass es lebt, wenn der Ursprung seiner Bewegungen in ihm selbst liegt und wenn es diese auf seine eigene Vervollkommnung ausrichtet. Vom Tode hingegen sprechen wir, wenn ein Wesen diese Fähigkeit verloren hat. Der Apostel gebraucht dieses Bild, wenn er von der Sünde und ihrer Herrschaft in uns spricht. Die Sünde «lebt» in uns - nach seiner Auffassung -, wenn sie uns soweit beherrscht, dass sie zum Prinzip unserer Handlungen wird: «Darum darf nicht mehr die Sünde in eurem sterblichen Leib herrschen, dass ihr seinen Gelüsten folgt» (Röm 6, 12). Wenn also die Sünde zur Wurzel unseres Tuns wird, hat sie ihre Herrschaft in uns errichtet, und wir sind ihre Sklaven geworden: «Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde» (Joh 8, 34); und da es unmöglich ist, zu gleicher Zeit zwei Herren zu dienen (Mt 6, 24), entfernen wir uns von Gott, «sterben wir ihm», wenn wir der Sünde leben.
Also müssen wir genau das Gegenteil erstreben; wir müssen «der Sünde sterben», um «für Gott zu leben».
Dieses Sterben führen wir freiwillig herbei, wenn wir gegen die Herrschaft der Sünde in uns vorgehen, wenn wir sie brechen, wenn wir nicht mehr zugeben, dass sie die Triebkraft unseres Handelns ist. Indem sich der Getaufte weigert, den Grundsätzen der Welt, dem Begehren des Fleisches, den Einflüsterungen des Teufels zu folgen, befreit er sich immer mehr von der Sünde. Auf diese Weise «stirbt er der Sünde». In dem Maße, in dem diese innere Freiheit zu einem bleibenden Zustand wird, ist es dem Christen möglich, sich immer mehr Christus, seinem Beispiel, seiner Gnade, seinem Willen zu unterwerfen. Dann ist Christus das Prinzip aller seiner Handlungen und das Leben Christi löst in ihm die Herrschaft der Sünde ab: «Betrachtet euch als solche, die tot sind für die Sünde, die aber leben für Gott in Christus Jesus» (Röm 6,11).
2. Grade dieses Sterbens
Der erste Grad ist selbstverständlich der völlige Verzicht auf die Todsünde; solange wir mit ihr nicht kategorisch gebrochen haben, kann die Liebe Gottes nicht in uns leben.
Sodann der entschiedene Verzicht auf die lässliche Sünde. Ein Gebot Gottes, wenn auch nur in kleinen Dingen, mit Vorbedacht übertreten, beleidigt den Herrn. Lassen wir niemals eine solche Unordnung in unserm Leben zu, unter welchem Vorwand es auch sei.
Wir wissen es: wenn auch die lässliche Sünde nicht die Verbindung zerstört, die durch die heiligmachende Gnade bewirkt wird, so fügt sie der Seele doch großen Schaden zu. Jede lässliche Sünde ist eine Untreue gegen den Vater im Himmel und hindert uns am herzlichen Verkehr mit dem göttlichen Meister. Dieser Verkehr ist von größter Bedeutung für die Heiligung des Priesters und die Fruchtbarkeit seines Wirkens.
Wir sprechen hier von vollfreiwilligen lässlichen Sünden. Viel von unserm täglichen Versagen ist auf Unachtsamkeit, Nachlässigkeit, auf unsere menschliche Schwachheit zurückzuführen und ist deshalb keine überlegte Beleidigung Gottes. Völlige Makellosigkeit werden wir erst im Himmel erlangen. Auf Erden ist sie eine seltene Gnadengabe; sogar die Heiligen - außer der Gottesmutter - haben Schwachheits- oder Überraschungsfehler begangen.
Wenn überlegte lässliche Sünden häufig vorkommen, vermindern sie die Furcht, Gott zu missfallen, schwächen die Widerstandskraft und führen oft zu schwerer Sünde. Wenn man einwilligt, in gewohnheitsmäßiger Untreue gegen die Gnade und die Pflicht zu leben, entsteht in der Seele jener Zustand, den man als geistliche Lauheit bezeichnet.
Dieses Übel umfasst verschiedene Grade. Sein Charakteristikum ist nicht, wie zuweilen angenommen wird, innere Trockenheit, das Fehlen der «Andacht» bei den religiösen Übungen. Das Schlimme an der Sache ist, dass sich die laue Seele an ihren Zustand gewöhnt, sich damit abfindet, keine Anstrengungen macht, um ihn zu überwinden, und nicht mehr danach strebt, Gott mit ganzer und aufrichtiger Treue zu dienen.
Wenn es bei einem solchen Menschen zu einem ernsten Fehltritt kommt, vermag er sich kaum mehr zu erheben, weil seine Kraft durch das gewohnheitsmäßige Sich-gehen-lassen erschlafft ist. Dennoch kann er durch die Rückkehr zu einem echt priesterlichen Leben, zu treuer Pflichterfüllung, zur geistlichen Lesung und zum Gebet mit Hilfe der Gnade alle Hindernisse besiegen.
Zuweilen ist die Todsünde nicht eine Folge der Lauheit, sondern einer vorübergehenden Leidenschaft. Es kommt vor, dass der Sünder durch den Fall seinen Gewissenszustand klar erkennt. Und diese Erkenntnis entmutigt ihn nicht, sondern bewegt ihn, sich in die Arme der göttlichen Barmherzigkeit zu werfen. Scham und Reue wecken in ihm großmütigen Eifer, der zum Ursprung der Treue wird. Nach der Lehre des heiligen Ambrosius wird so die Erinnerung an die Sünde ein Ansporn zu intensiverem Gottsuchen: «Acriores ad currendum resurgunt, pudoris stimulo, maiora reparantes certamina.» (De Apologia prophetae David, 1. 1, c. 2 P. L. 14, Sp. 854).
Schließlich müssen wir für die Austilgung der Sünde bis in die geheimsten Falten unserer Seele Sorge tragen, bis zu den tiefverwurzelten Neigungen, die Ursache für aktuelle Fehltritte werden können. Diese sündhaften Neigungen sind vor allem der Hochmut, die Selbstsucht und die Sinnlichkeit. Achten wir darauf, dass wir nicht den inneren Regungen folgen, die sie uns eingeben; machen wir uns immer mehr frei von der Eigenliebe, dem eigenen Urteil, dem Eigenwillen und allem ungerechten «Eigenbesitz», der unsere Seele hindert, die Verähnlichung mit Christus zu erlangen.
Solange wir nicht entschlossen sind, jede Neigung zu bekämpfen, von der wir wissen, dass sie dem Willen Gottes entgegengesetzt ist, solange herrscht immer noch irgendwie die Sünde in uns.
Löschen wir doch die Taufgnade nicht aus! «Wir sind ja der Sünde gestorben. Wie sollten wir noch in ihr leben?» (Röm 6, 2).
Drei Erwägungen ermutigen uns sehr bei dem Streben nach völliger Losschälung.
Vor allem diese: Die Zeit ist nach der Absicht Gottes ein Faktor, mit dem wir rechnen müssen. Nicht ein für allemal, sondern tagtäglich müssen wir dem sterben, was Gott missfällt. Diese Akte der Hochherzigkeit haben jenen «geistlichen Aufstieg» in unserm Herzen zur Folge, von dem der Psalmist spricht (Ps 84, 6). Gott verlangt von uns nicht, dass wir ohne Rast weitermarschieren. In der Gnadenordnung vollzieht sich das Wachstum ebenso wie im Bereich der Natur nicht an einem Tag. Wenn der Bauer sät, muss er mehrere Monate warten, bis er ernten kann. Ohne dass unsere Treue darunter leidet, müssen wir lernen, im geistlichen Leben Geduld mit uns selbst zu haben, Niederlagen zu ertragen und immer Vertrauen zu bewahren. So sagt auch der Apostel: «Wenn wir nicht ermatten, werden wir zur rechten Zeit ernten» (Gal 6, 9).
Und hier gilt noch mehr als von unsern Kämpfen, dass wir nicht allein sind: wir können auf die Hilfe dessen zählen, der uns berufen hat. Der heilige Paulus gibt uns die Versicherung: «Mit Christus sind wir begraben» (Röm 6, 4). Unser mystisches Sterben kann sich nur in Vereinigung mit Christus und in seiner Kraft vollziehen. Durch seine Leiden hat er uns alle Gnaden erworben, deren wir bedürfen, um dem Fleische, der Welt und uns selbst zu sterben. Und diese Gnaden werden uns durch die hl. Messe und Kommunion jeden Tag in reicher Fülle geschenkt.
Erwägen wir ferner, welches Glück es für einen Priester bedeutet, wenn er spürt, dass er nicht mehr unter der Tyrannei der Sünde steht, wenn er sich frei fühlt von der Enge der Selbstsucht und Eigenliebe, wenn er nicht mehr von den Trugbildern der Welt getäuscht wird. Auf diese Weise wird er fähig, seiner erhabenen Berufung zu entsprechen. Je vollständiger dieser Tod ist, desto mehr wird sich seine Seele der Gnade erschließen, desto mehr wird sein Wirken gesegnet sein.
Markten wir nicht mit dem Herrn. Fordert er ein Opfer von uns - und wenn es unser Herzblut wäre -, so antworten wir wie Abraham: «Hier bin ich, Herr». Beten wir: «O Jesus, mach, dass niemals die Sünde in mir herrsche.» (Röm 6,12). Und fügen wir hinzu: «Herrsche du in mir, Jesus ... ! Würdige dich, Herr, heute unsere Seele und unsern Leib ... nach deinem Gesetz zu leiten und zu heiligen» (Offizium [Prim]). Dann beginnen sich die Worte des hl. Paulus an uns zu verwirklichen: «Ihr seid ja gestorben, euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott» (Kol 3, 3).
3. Die Schwere der Sünde
Es gibt Seelen, die hohe Heiligkeit erreicht haben; wir preisen Gott, der «wunderbar ist in seinen Heiligen» (Ps 68, 36).
Doch man entdeckt auch zuweilen - glücklicherweise nur selten - Abgründe der Sündhaftigkeit. Wo liegt die erste Ursache für einen solchen Fall? Die Seelen, die versagt haben, wollten sich Gott nahen, ohne zuvor der Sünde gestorben zu sein. Der besonderen übernatürlichen Auserwählung hätte der Mensch durch entschiedeneren Verzicht entsprechen müssen.
Der Abfall kommt nicht plötzlich; er wurde lange Zeit durch große Nachlässigkeit im Gebrauch der Gnadenmittel vorbereitet; er war nur möglich, weil man «Gelegenheiten» nicht mied, weil man bestimmte Neigungen nicht bekämpfte. Bevor das Gebäude zusammenstürzte, waren schon längst Risse entstanden.
Um die Festigkeit der Grundlagen zu sichern, auf denen unser geistliches Leben ruht, betrachten wir zunächst die Abscheulichkeit der Sünde in sich; denken wir dann über die Letzten Dinge nach. Die Erwägung dieser großen Wahrheiten ist eines der wirksamsten Mittel, um unsere Neigung zum Bösen zu überwinden.
Die Sünde ist in den Augen Gottes «das Übel schlechthin». Es wird uns nie gelingen, uns eine richtige Vorstellung von der Schwere einer Beleidigung Gottes zu machen. Deshalb ruft der Psalmist aus: «Wer erfasst, was die Sünde ist?» (Ps 19, 13).
Gott sieht sich in der Fülle des Lichtes aller Liebe und aller Unterwerfung würdig. Da er die Heiligkeit selbst ist, will er alles auf seine Ehre hinlenken. Er will das mit unbeirrbarer Treue, weil dies der wesenhaften Ordnung entspricht. Überdies schenkt sich Gott in grenzenloser Liebe in der Menschwerdung, in der Eucharistie, im Himmel. So groß ist seine Vollkommenheit, seine Schönheit, seine Herrlichkeit, dass wir hienieden Gott nicht schauen könnten ohne zu sterben.
Und doch, durch die Sünde lehnt sich der Mensch, soweit dies in seiner Macht steht, gegen die göttliche Souveränität auf. Er weigert sich, seine Abhängigkeit anzuerkennen, weigert sich, Gott zu gehorchen, ihn als sein letztes Ziel zu erstreben. Dadurch fügt er der unendlichen Heiligkeit schweren Schimpf zu, beleidigt die Liebe selbst.
Übersehen wir auch nicht, dass in jeder freiwilligen Sünde, auch der lässlichen, ein Vergleich angestellt, eine Wahl getroffen wird, wenigstens eingeschlossen. Man sieht auf der einen Seite Gott und seinen Willen, auf der andern Seite einen oft sehr niedrigen Genuss: einen Triumph der Eigenliebe, einen Hass, die Befriedigung einer Leidenschaft. Man zieht die flüchtige Befriedigung der ewigen Heiligkeit vor. Wie die Juden vor Pilatus Jesus und Barrabas verglichen, so ruft der Sünder - wenn nicht mit dem Mund, so doch durch seine Handlungen: «Nicht diesen, sondern Barabbas» (Joh 18, 40). Gewiss, wir wiederholen es, die lässliche Sünde ist nicht so schrecklich wie die Todsünde; sie zerstört nicht die Freundschaft mit Gott; aber auch sie schließt eine «Wahl» in sich und diese Wahl verletzt ein göttliches Gebot, beleidigt Gott.
Die Sünde ist also ein wirkliches «Unrecht gegen Gott». Nicht etwa, weil der Herr irgend einen Schaden erleiden könnte, aber weil sie ein Unrecht gegen seine erhabene Majestät und ein Angriff auf seine Allherrschaft ist.
So groß und so ernst zu nehmen ist diese Beleidigung, dass der Vater seinen eigenen Sohn dem Tod überlieferte, um sie zu sühnen: «Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben» (Röm 8, 32).
Nirgends können wir die Schwere der Sünde besser erfassen als zu Füßen des Kreuzes. Betrachten wir mit Maria, Johannes und Magdalena diesen leidenden Gott. Warum stirbt er unter unbeschreiblichen Qualen? Um unsere Sünden zu tilgen. «Wegen unserer Verfehlungen wurde er hingegeben» (Röm 4,25). Das Kreuz ist die eindrucksvollste Offenbarung über das Wesen der Sünde. Beim Anblick des Kreuzes kann jeder von uns sprechen: «Das ist mein Werk, das habe ich getan ... Ich habe Gott beleidigt!»
Die Sünde ist auch das große Übel, das einzige Unglück des Menschen. Der Mensch, der bewusst und freiwillig eine Todsünde begeht, verzichtet auf die ewigen Güter, die der Vater für ihn bereitet hat. Wie Esau verzichtet er auf ein Erbe von unendlichem Wert für ein Linsengericht. Durch unsere Annahme an Kindes Statt in Christus sind wir Erben des Himmels. Kein Geschöpf, und wäre es noch so erhaben, hat Anrecht auf den Genuss göttlicher Seligkeit; dieses Glück steht natürlicherweise Gott allein zu. Doch durch die heiligmachende Gnade hat uns der Herr befähigt, dereinst an dieser Seligkeit teilzunehmen. Diese Gnade ist so kostbar, dass wir ihren Wert nie voll ermessen können.
Und durch die Sünde verlieren wir nicht nur diesen Schatz, sondern bewirken, dass wir von Gott verstoßen werden. Verstoßen von einem so unendlich gütigen Gott! Dieser Gedanke ist meines Erachtens eines der stärksten Motive, um die Sünde zu verabscheuen. Gott, der in seinem Urteil nicht irren kann, der sich zu keiner Affekthandlung hinreißen lässt, der viel mehr geneigt ist, Barmherzigkeit zu üben, als seiner Gerechtigkeit ihren Lauf zu lassen, verurteilt einen Menschen, den er für das Glück geschaffen hat, zur ewigen Verdammnis. Ich glaube, das lässt uns ahnen, wie sehr die Sünde unsere Fassungskraft übersteigt. Das Urteil Gottes ist immer richtig. Obschon die göttliche Barmherzigkeit jederzeit den reuigen Sünder aufnimmt, ändert sich die Haltung Gottes gegenüber der Sünde selbst nicht. Das Evangelium bestätigt es: die Folge der Sünde ist die Verdammung.
Diese Tatsachen sind umso erschütternder, wenn es sich um die Herrschaft der Sünde in einer Priesterseele handelt. Verhärtung des Herzens, Verblendung des Geistes, fortschreitender Verlust des Glaubens sind meist die furchtbaren Folgen langandauernder Treulosigkeit eines Dieners Christi.
Vor einiger Zeit kam es mit einem Priester, der die Gnade schwer missbraucht hatte, zum Sterben. An seinem Lager stand ein Freund, der die Hoffnung auf Verzeihung in ihm wecken wollte; er sprach zu ihm von der Allmacht des Blutes Christi. Da antwortete der Unglückliche verzweifelt: «Als ich noch die Messe las, habe ich das Blut Christi getrunken ... Es hat mir nichts genützt; glauben Sie, dass es mich jetzt retten könnte?»
Es gibt Seelen, die Gott niemals schwer beleidigt haben. In ihnen lebt eine instinktive Furcht, dem Herrn zu missfallen. Schon der Gedanke an die Sünde lässt sie sozusagen erzittern.
Bewahren wir in uns einen heiligen Abscheu vor der Sünde, auch vor der geringsten freiwilligen lässlichen Sünde. Sollte uns das große Unglück zustoßen, dass die Furcht vor einer Beleidigung Gottes in uns zu schwinden beginnt, dann bemühen wir uns, durch erneuten Eifer in den religiösen Übungen diese innere Haltung wiederzugewinnen, die so sehr unserer Berufung entspricht.
4. Der Tod, die Strafe Gottes für die Sünde
Im 17. Jahrhundert gelang es dem Quietismus, einen Teil der eifrigsten Christen von der Betrachtung der Letzten Dinge abzubringen. Gewiss, diese Betrachtung ist beunruhigend; sie stört die Fröhlichkeit und Sorglosigkeit mancher Seelen. Dennoch raten alle frühchristlichen Lehrer des geistlichen Lebens, besonders auch der hl. Benedikt, dringend, sich unaufhörlich diese großen Wahrheiten zu vergegenwärtigen. Der Vater der Mönche sagt: «Den Tag des Gerichtes fürchten. Vor der Hölle zittern. Das ewige Leben mit der ganzen Glut der Seele wünschen. Jeden Tag die Gefahr des Todes vor Augen haben (Regel, IV. Kap.).»
Diese Auffassung unserer Väter ist solid, sie ist ernst, sie erfüllt das Herz mit wohltuender Furcht und mit Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes; sie hilft der Seele, die Sünde fern zu halten und keinen Kompromiss mit ihr zu schließen.
Zunächst: Wie nützlich ist doch der Gedanke an den Tod für das ganze Leben!
Die Aussicht auf den Tod bewahrt den Menschen in der Wahrheit: sie lässt ihn besser erkennen, dass die vergänglichen Dinge nichts sind und dass Gott alles ist. Ich stand einmal am Sterbebett eines Mitbruders, der die Regel sehr treu beobachtet hatte und ein fröhliches Gemüt besaß. Plötzlich sagte er zu mir: «Die Ewigkeit, - es ist schrecklich !» Und er fuhr fort: «Pater, wenn Sie etwas tun, was nicht für Gott getan ist, verlieren Sie Ihre Zeit; es gibt nichts als Gott und das, was für ihn getan ist. Alles übrige sind Kleinigkeiten, Kleinigkeiten, Kleinigkeiten!»
Bei der Betrachtung über den Tod können uns drei Gedanken helfen: Der Tod ist für jeden von uns sicher - wir können seine Stunde nicht vorhersehen - er bedeutet die endgültige Trennung von der Welt.
Der Tod ist sicher; er ist die Strafe Gottes für die Sünde. «Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod auf alle Menschen übergegangen, weil alle gesündigt haben» (Röm 5, 12). Und es ist bestimmt, dass der Mensch nur einmal stirbt: «Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben» (Hebr 9, 27). Das ist eine unumstößliche Wahrheit; nichts kann uns vor dem Tod retten, nicht Reichtum, nicht Liebe, nicht Wissenschaft, nicht Medikamente. Wenn die Stunde gekommen ist, kann sich kein Geschöpf zwischen Gott und die Seele stellen. Und diese Stunde kommt jeden Tag näher.
Der genaue Zeitpunkt unseres Todes kann nicht vorausgesehen werden. Jesus selbst sagt uns: «Ich werde kommen wie ein Dieb ... mitten in der Nacht ... zu einer Zeit, wo ihr es nicht erwartet.» (Vgl. Mt. 24, 43-44.) Großen Heiligen hat Gott zuweilen den Augenblick ihres Todes geoffenbart, aber uns wird diese Stunde bis zum Ende unbekannt bleiben. Es ist eine List Satans, wenn er Priestern im Alter und in schwerer Krankheit einreden will, der Tod sei noch fern. In verschiedenen Diözesen weiß man von Priestern, sogar solchen, die ein frommes, verdienstliches Leben führten, dass sie sich durch ihren Eigensinn der Sterbesakramente beraubten. Nehmen wir uns vor, uns denen dankbar zu zeigen, die uns aufmerksam machen werden, dass unsere Stunde gekommen ist, und folgen wir ihrem Rat. Ist doch der Empfang der Sterbesakramente eine Quelle von Frieden und Freude.
Für jeden bedeutet der Tod ein endgültiges Scheiden. Wenn die entscheidende Stunde naht, vollzieht sich eine vollständige Trennung der Seele von allen irdischen Dingen. Die Sinne, die unsere Verbindung mit der Umwelt herstellten, versagen einer nach dem andern; das Gewissen ist allein mit Gott. In dieser völligen Einsamkeit kann keiner unserer Freunde, die wir verlassen, uns helfen.
Doch für viele besteht die Bitterkeit des Sterbens nicht in der Trennung von geliebten Wesen, sondern in der Angst, in eine unbekannte Welt einzugehen, über die uns unsere Erfahrung nichts sagt.
Vielen scheint der Tod nur darum so schrecklich, weil ihm das Gericht folgt: «worauf dann das Gericht folgt» (Hebr 9, 27). Die Art, in der Gott das persönliche Verhalten des einzelnen beurteilt, ist für jeden gläubigen und denkenden Menschen etwas sehr Ernstes. Dieser Gedanke kann uns erschrecken. Wenn der Mensch den letzten Atemzug getan hat, befindet er sich vor seinem Richter, um ihm Rechenschaft abzulegen über seine Gedanken, seine Worte, seine Handlungen, und vor allem über die Gnaden, die er empfing.
Der Priester muss dieses Urteil noch mehr fürchten als jeder andere, wegen der Wichtigkeit der heiligen Handlungen, die er zu vollziehen hatte, wegen der Schwere seiner Verantwortung. Wer mehr empfing, von dem wird auch mehr gefordert werden.
Wir alle kennen Mitbrüder, die der Tod im Schlaf überraschte. Begeben wir uns daher niemals zur Ruhe, bevor wir die innere Sicherheit erlangt haben, dass wir uns in einem Zustand befinden, in dem wir vor Gott erscheinen könnten. Denken wir daran, wenn der Tod in dieser Nacht kommt, wird der höchste Richter in letzter Instanz über unsern Wandel und unser ganzes Leben urteilen.
Es ist von großer Wichtigkeit, diesen höchsten Richter zum Freund zu haben. Der ehrliche, treue Freund, der uns nie verlassen wird, ist Jesus. Ist er im Leben unser alles, dann wird er es auch im Augenblick des Todes sein: «Auch wenn ich wandle in Todesschatten, fürcht' ich kein Unheil, denn du, Herr, bist bei mir» (Ps 22, 4).
5. Die ewige Strafe der Sünde
Betrachten wir die Worte Jesu. Immer wieder spricht er von der Hölle; nicht ausschließlich, nicht mit Vorliebe, aber oft und mit einer Klarheit, die keinem Zweifel Raum lässt: «Wenn dein Auge dir zum Ärgernis wird, reiße es aus. Es ist besser für dich, du gehst mit einem Auge ins Reich Gottes, als dass du mit zwei Augen in die Hölle geworfen wirst, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt» (Mk 9, 47 f.). Nach dem Gericht werden die Bösen «eingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben» (Mt 25, 46).
Warum spricht der göttliche Meister mit solcher Deutlichkeit über diesen Gegenstand? Er ist die Wahrheit selbst. Seine Seele schaute ohne Unterlass die grenzenlose Majestät des Vaters, seine unendliche Heiligkeit; er kannte die Forderungen dieser Gerechtigkeit, die keine Sünde ungestraft lassen kann: «Fürchtet den, der Leib und Seele in die Hölle stürzen kann» (Lk 12,5).
Gibt es nicht zu denken, dass er diese Worte zu seinen bevorzugten Jüngern sprach, «wegen der Liebe, die er ihnen entgegenbrachte» : «Euch, meine Freunde, sage ich ...» (Lk 12,4). Weil die Apostel seine Freunde, seine Vertrauten sind, warnt er sie mit so ernsten Worten; wünscht er doch inständig, sie vor der furchtbaren Strenge des künftigen Gerichtes zu bewahren. «Meine Freunde»: im Gedanken an diese Anrede sollen wir Jesu Worte aufnehmen, wenn seine Liebe ihn drängt, uns vor der Sünde und den Sündenstrafen zu warnen.
Der Gedanke an die ewigen Strafen soll durchaus nicht der gewöhnliche Beweggrund unserer Handlungen sein; die Liebe soll uns drängen, den Weg der Vollkommenheit zu beschreiten. Doch dieser Glaube wird uns im Lauf unseres Lebens außerordentlich nützlich sein, besonders in Stunden der Versuchung und des Kampfes. Für jeden von uns können solche Stunden kommen; sie bringen zuweilen große Verwirrung mit sich; die Leidenschaft lässt nicht mehr klar sehen; der Wille möchte kapitulieren. In solchen Augenblicken ist der Gedanke an die Ewigkeit vielleicht der wirksamste Schutz vor dem Fall.
Ich will nicht versuchen, ein Bild der physischen Höllenstrafen zu zeichnen; ich will nur an das erinnern, was der Glaube und die Theologie über die hauptsächlichsten Leiden an der Stätte der Verzweiflung lehren.
Doch bei diesen Erwägungen dürfen wir niemals die Lehre der Kirche über folgende Punkte aus dem Auge verlieren: Gott prädestiniert niemanden für die Verdammung; Christus ist für die Erlösung aller Menschen gestorben; die heilsnotwendigen Gnaden werden jedem gegeben; die Verwerfung ist einzig und allein das Werk des Menschen, der sich hartnäckig weigert, die göttliche Ordnung anzunehmen und sich lieber für immer von Gott abwendet, als sich ihm in Hoffnung und Liebe zu unterwerfen. Es ist eine grauenhafte Gotteslästerung, zu sagen, Gott, die Gerechtigkeit selbst, könne eine Seele verstoßen, ohne dass diese es verdient hat. Im Licht dieser Wahrheiten verstehen wir besser die persönliche Verantwortung, die der Mensch für sein Verderben trägt.
Zum Wesen der Sünde gehören zwei Elemente: Abneigung gegen Gott und Hinneigung zur Kreatur. Wenn sich der Mensch in der Todesstunde trotz des göttlichen Werbens in der Auflehnung gegen seinen Herrn verhärtet, gibt Gott ihn auf. Sich selbst überlassen, von Gott getrennt, erduldet die Seele dann die unbeschreiblichen Qualen der Verdammnis.
Der hl. Paulus sagt vom Himmel: «Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, in keines Menschen Herz ist es gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben» (1 Kor 2, 9). Leider müssen wir sagen, dass wir uns ebenso wenig die Peinen vorstellen können, die der Verworfenen im ewigen Kerker, der Hölle, harren. Um sie zu verstehen, müssten wir erfassen, welch unendliches Glück der Besitz Gottes bedeutet, und wir müssten die grauenhafte Angst kennen, die ein Leben beherrscht, das für immer sein beseligendes Ziel verfehlt hat und von keinem Hoffnungsstrahl erhellt wird.
Die wesentlichste Strafe der Hölle besteht in der Verbannung von Gott: «Weichet von mir, ihr Verfluchten» (Mt 25, 41).
In uns lebt eine unendliche Sehnsucht nach Glück: Verstand, Wille, alle Kräfte unserer Natur suchen unaufhörlich ihre Befriedigung. In diesem zeitlichen Leben wird dieser Durst zum Teil durch die uns umgebenden Erdengüter gelindert oder gestillt. Das ist der Ursprung des unvollkommenen, bedingten Glückes auf Erden. Es gibt genug Freuden in unserm Leben, um es erträglich zu gestalten; doch in unserm Innern lebt trotzdem das Verlangen nach dem Unendlichen fort. Der hl. Augustinus bekennt: «Für dich hast du uns erschaffen, o Gott, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir» ([[Augustinus von Hippo: Confessiones, I, 1. P. L. 32, Sp. 661).
Wenn einmal das Ende kommt, wenn wir in die Ewigkeit eingehen, dann erkennen wir die Absolutheit Gottes, unseres letzten Zieles, in seiner unwandelbaren Notwendigkeit, und die Nichtigkeit alles dessen, was nicht Gott ist. Die Seele wird von einem unstillbaren Hunger nach Glück gefoltert; ihre ganze Natur verlangt mit Allgewalt nach dem Glück, das sie für immer verloren hat.
Überdies ist der Verdammte in seiner Auflehnung gegen Gott verhärtet, und diese Verhärtung zerstört alles, was an Gutem in ihm war. Auch im verkommensten Menschen ist noch irgendeine gute Neigung, eine Möglichkeit zur Umkehr; er kann wieder zur Besinnung kommen, bereuen, sich erheben. Doch im Herzen des Verdammten wohnt nur Hass; sein Wille kann sich nicht mehr von der Sünde abwenden und wird, wie der des Teufels, seinem Wesen nach böse. Er hasst Gott, er hasst seine Mitmenschen, er verabscheut sich selber; niemals steigt eine Regung des Mitleids, ein Gedanke der Liebe in seiner Seele auf.
Wie in Gott und seinen Heiligen die Liebe herrscht, so triumphiert in ihm die Auflehnung. Verstehen wir es recht: es ist nicht Gott, der ihn verdammt; der Verworfene selbst tut es durch seine endgültige Entscheidung für den Ungehorsam. Nun ist er für die ganze Ewigkeit in dieser ohnmächtigen Auflehnung gegen seinen Schöpfer erstarrt.
Der Verdammte ist innerlich zerrissen: seine Natur verlangt mit unwiderstehlicher Leidenschaft nach Gott, dem letzten Ziel, für das er erschaffen wurde; anderseits stößt sein Wille, der im Widerstand verhärtet ist, Gott zurück, lästert ihn und bejaht diese Abneigung.
Wer vermöchte die Peinen dieser Verzweiflung zu beschreiben? Die «Hinneigung zur Kreatur» lässt ihn nur die Nichtigkeit seiner Seele erkennen, die für immer der Liebe und ihres höchsten Gutes beraubt ist. In seiner inneren Auflehnung trägt er die Hölle in sich selbst.
Wenn ich zuweilen in der Einsamkeit des Klosters, allein mit Gott, angesichts der Ewigkeit an diese Trennung vom höchsten Gut und an die entsetzlichen Worte denke: «Weichet von mir, ihr Verfluchten» (Mt 25, 41), die Menschen - und sogar Priester - verdienen können, dann erkenne ich, dass man lieber alle Leiden und alle Verachtung der Welt annehmen muss, als sich der Gefahr dieser Qual auszusetzen, und dass wir als Apostel Christi alle unsere Fähigkeiten, alle unsere Kräfte, all unsern Eifer einsetzen müssen, um die armen Blinden davor zu bewahren, dass sie die Wege des ewigen Verderbens gehen.
Noch ein anderer Aspekt der Höllenstrafe muss tiefen Eindruck auf uns machen: der Verdammte ist der Macht der Dämonen ausgeliefert. Die einfache Natur dieser Geister ist unwiderruflich der Verderbtheit anheim gefallen. Sie sind von Grund aus böse, ihre einzige Beschäftigung ist, zu hassen und zu schaden. Obwohl ihre Macht auf Erden noch begrenzt ist, schildert die Heilige Schrift sie als furchterweckende Wesen: «wie brüllende Löwen, die suchen, was sie verschlingen könnten» (1 Petr 5, 8).
Doch in der Hölle, wo der Verdammte von Gott verlassen und völlig ihrer Macht ausgeliefert ist, «in der äußersten Finsternis» (Mt 22, 13), haben die Teufel freies Spiel. Sie stürzen sich auf ihre Beute, um sie zu überwältigen, um ihr unaufhörlich die furchtbarsten Leiden zuzufügen.
Ihr unversöhnlicher Hass richtet sich vor allem gegen den Christen, denn sie sehen in ihm das Bild des Gottmenschen.
Und ist der Verdammte ein Priester, so werden seine Qualen in unvorstellbarer Weise vermehrt. Im Priester sieht Satan jenen, der es früher als seine Aufgabe betrachtete, im Namen Christi gegen seine Herrschaft über die Menschen anzukämpfen. Damals war er gezwungen, ihn zu verschonen, da das Zeichen des Priestertums seiner Seele eingeprägt war. Jetzt, da der Priester gefallen, von Gott verstoßen, aller Macht beraubt ist, macht ihn der Teufel zu seinem Spielzeug. Allein der Gedanke, für die ganze Ewigkeit schutzlos dem Wüten Satans ausgeliefert zu sein, genügt, um uns vor Schrecken erstarren zu lassen.
Mit der ganzen Kraft meiner Seele rufe ich euch im Namen Jesu zu: «Wacht . . . !»
Geben wir uns keiner Täuschung hin: für jeden von uns, für jede der uns anvertrauten Seelen ist die Verdammung möglich. Die Kirche, die vom Heiligen Geist geleitet wird, lässt uns in ihrem offiziellen Gebet die Gnade erbitten, dass wir vor der ewigen Verdammung errettet werden. In der feierlichen Allerheiligenlitanei und im erhabensten Teil des Messopfers lässt sie uns sprechen: «Von der ewigen Verdammnis rette uns.» Und im Augenblick der Kommunion sollen wir Christus nach ihrem Willen bitten, er möge nicht zugeben, dass wir jemals von ihm getrennt werden.
Hüten wir uns also vor Nachlässigkeit und Unvorsichtigkeit. «Wer glaubt zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle» (1 Kor 10, 12). Und im Hebräerbrief (10,31) spricht Paulus davon, wie schrecklich es ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Deshalb «härtete der Apostel seinen Leib ab und brachte ihn in Dienstbarkeit, damit er nicht etwa andern predige und selbst verworfen werde» (vgl. 1 Kor 9, 27). Sagen wir uns auch von allem Dünkel los. Wenige Stunden nach seiner Priesterweihe hörte Petrus, der versprochen hatte, den Herrn niemals zu verlassen, das Wort Jesu: «Wachet und betet, denn der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach» (Mt 26, 41).
Die Furcht vor der Verdammung ist eine kostbare Gnade. Die große hl. Theresia berichtet, dass sie sich eines Tages während des Gebetes in die Hölle versetzt fühlte. «Ich erkannte, dass der Herr mir den Platz zeigen wollte, den die Dämonen für mich bereitet hatten. Ich war entsetzt; obwohl seither sechs Jahre verflossen sind, ist mein Entsetzen jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, noch so groß, dass es mir das Blut in den Adern erstarren lässt . .. Ich scheue mich nicht, es zu wiederholen: es ist eine der hervorragendsten Gnaden, die der Herr mir erwiesen hat. Sie hat mir den größten Nutzen gebracht» (Leben der hl. Theresia, von ihr selbst geschrieben, 32. Kap.). Der Eifer für die Bekehrung der Sünder, die Geduld im Ertragen der größten Prüfungen, die Dankbarkeit gegen Gott, der sie errettet hat, die Treue im Dienste des Herrn - das sind die kostbaren Früchte, die der Heiligen nach ihrem Bekenntnis durch diese Vision zuteil wurden.
Auch für uns ist der Glaube an die Ewigkeit der Strafen eine der heilbringendsten Gnaden. Sie flößt dem Priester - nach dem Wort der Heiligen - den glühenden Wunsch ein, die Seelen vor dem Abgrund der Hölle zu retten. Und dieser Eifer geziemt vor allem dem Priester, der die Verantwortung für die Seelen trägt, für die Jesus sein Blut vergossen hat und für deren jede er Gott wird Rechenschaft ablegen müssen.
VI. DAS SAKRAMENT DER BUSSE UND DER GEIST DER ZERKNIRSCHUNG
Die göttliche Weisheit hat uns ein besonderes Mittel zur Verfügung gestellt, um uns zu helfen, der Sünde zu sterben: das Bußsakrament. Wenn wir diese Gabe richtig gebrauchen, wird die Herrschaft der Sünde in uns immer mehr geschwächt und wir werden alle ungeordnete Anhänglichkeit an die Geschöpfe überwinden.
Selbst dem Christen, der für gewöhnlich in Freundschaft mit Gott lebt, empfiehlt die Kirche, die treue Interpretin des Willens Christi, häufig zu beichten. Große Heilige, die keine Skrupeln kannten, wie z. B. Karl Borromäus, beichteten sehr oft; der nachsichtige hl. Franz von Sales beichtete täglich vor dem Zelebrieren der hl. Messe; angesichts der Heiligkeit Gottes fühlten sie ständig das Verlangen, sich zu «waschen im Blute des Lammes», «Wasch meine Schuld von mir ab» (Ps 51, 4).
Ich habe nicht die Absicht, eine so häufige Beichte anzuraten; wenn nicht eine göttliche Einsprechung oder besondere Gründe da sind, wäre sie eine Übertreibung.
Doch anderseits bin ich überzeugt, dass Priester, die gewohnheitsmäßig nur im Abstand von einigen Wochen oder gar Monaten beichten, es an übernatürlicher Klugheit fehlen lassen. Ich spreche hier nicht von einer strengen Verpflichtung, sondern von dem, was ein feinfühlendes priesterliches Gewissen eingibt. Wenn der Priester nur selten beichtet, beraubt er sich kostbarer Gnaden, die seiner Heiligung dienen würden, und setzt sich der Gefahr aus, in Lauheit zu verfallen.
1. Die Wichtigkeit der Akte des Pönitenten
Das Bußsakrament wendet der Seele immer ex opere operato - aus dem vollzogenen Werk heraus die Sühneleistung und die Verdienste des Erlösers zu: «Das Blut Jesu Christi macht uns von jeder Sünde rein» (1 Joh 1, 7).
Wenn der Christ durch eine schwere Sünde das übernatürliche Leben verloren hat, wird ihm zugleich mit der Verzeihung der Schuld die heiligmachende Gnade und die Liebe wiedergegeben. War die Freundschaft mit Gott nicht zerstört, so gewährt Gott mit dem Nachlass der lässlichen Sünden eine Vermehrung dieser Gnade.
Die Verzeihung und die Eingießung der Gnade, die Früchte der Verdienste Jesu Christi sind, vollziehen sich durch die Gabe des Heiligen Geistes; sie verherrlichen den Herrn in seiner Barmherzigkeit, und zwar in höherem Maße, als unsere Sünden seine Majestät beleidigt haben.
Bei dieser Mitteilung des übernatürlichen Lebens spielt die innere Haltung des Christen eine ausschlaggebende Rolle.
Warum das? Weil nach dem Willen Christi und nach der Natur des Sakramentes die Gnade zur inneren Erneuerung und Heiligung der Seele auf die Akte des Sünders gewissermaßen aufgepfropft wird, auf das Bekenntnis der Sünden, das in der Hoffnung auf Verzeihung abgelegt wird, - auf den Abscheu vor der Sünde, der von dem festen Vorsatz zur Besserung begleitet ist -, auf den Willen, jedes Bußwerk zu tun, das von der Kirche auferlegt wird.
Diese Akte nennt man das Bekenntnis, die Reue und die Genugtuung. Das Konzil von Trient bezeichnet sie als die «quasi-materia» und als wesentlichen Bestandteil des Bußsakramentes (Sess. XIV, 3. Kap., Can. 4). Wenn sie zur Absolution des Priesters hinzukommen, sind sie nach thomistischer Auffassung durch die Kraft des Sakramentes erhöht und erlangen die Fähigkeit, die Sünde in uns zu tilgen und die Gnade zu verleihen. Sie gehören demnach zum Wesen des Sakramentes.
Leider werden diese Akte oft in unvollkommener Weise vollzogen. Infolgedessen kann das Sakrament der Seele nicht jene reiche Frucht vermitteln, die sie davon erwarten dürfte. Das ist eine traurige Erfahrungstatsache. Der eigentliche Grund für den geringen Gewinn beim häufigen Empfang dieses Sakramentes ist die mangelhafte Vorbereitung.
Zwei Gründe erklären meines Erachtens bei denen, die nur lässliche Sünden zu beichten haben, die mehr oder weniger große Fruchtlosigkeit der Beichte.
Zunächst ist das Bekenntnis selbst mangelhaft. Es hat nicht genug den Charakter einer «schmerz erfüllten» Anklage, die mit den Verdemütigungen Christi vereint wird.
Ferner steht nach der Beichte der feste Vorsatz zur Besserung nicht lebendig genug im Bewusstsein.
Was den ersten Punkt betrifft, so ist es sicher, dass das Bußsakrament schon seiner Natur nach der Seele die Sühneleistung zuwendet, die Christus der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes dargebracht hat. Doch wir müssen auch unsern Anteil an der Sühne übernehmen.
Auf Golgotha zeigte sich Christus seinem Vater gleichsam mit unseren Sünden beladen: «Der Herr hat alle unsere Sünden auf ihn gelegt» (Jes 53, 6). Er war «das Lamm, das hinwegnimmt die Sünden der Welt» (Joh 1, 29). Christus kannte alle unsere Sünden, er ermaß die Beleidigung, die durch sie der unendlichen Heiligkeit zugefügt wurde, er hat alle Schmach, alle Leiden, die wir für unsere Schuld verdient hätten, auf sich genommen, um uns zu retten.
Im Bußsakrament überlässt er uns einen Teil der Sühneleistung; das wird gefordert als Voraussetzung dafür, dass seine Verdienste uns zugewendet werden. So müssen wir uns beim Gericht der Barmherzigkeit mit unsern Sünden, unserm Undank, unserm Elend beladen wissen; die Erbärmlichkeit, das Verletzende unserer Sünden und unserer Treulosigkeit muss uns auf der Seele brennen und unser Bekenntnis muss «schmerzerfüllt» sein.
Als Glieder Christi vereinigen wir die Demütigung, die in diesem freiwilligen Bekenntnis liegt, mit der vielfältigen Schmach, die Jesus in seiner Passion erduldete; gehen wir ein in seine Gesinnung, damit die Unermesslichkeit seiner Sühne unsere Seele bis in die tiefsten Falten läutere. Hüten wir uns vor Formulierungen, die die Hässlichkeit unserer Sünden verbergen und unsere Eigenliebe schonen. Wenn man schon kein unwahres Bekenntnis ablegt, so möchte man doch zuweilen die Verzeihung auf billige Weise erlangen.
Wir müssen auch mit bereitwilligem Herzen die sakramentale Buße annehmen, die der Priester uns auferlegt, und in dieser Absicht alle Handlungen unseres Lebens aufopfern: «was du Gutes getan und Böses ertragen …»
Empfangen wir das Bußsakrament in dieser Gesinnung, dann vollzieht sich in uns wirklich allmählich das geistige Sterben kraft des Sühneopfers Jesu Christi.
In dieser Weise sollten wir Priester für gewöhnlich unsere Beichte ablegen.
Ferner kommt es vor, dass die Beichte wenig Frucht bringt, weil der Wille zur Besserung im Alltag nicht mit genügend Entschiedenheit festgehalten wird.
Wenn wir uns schuldig erkannt haben, sei es auch nur geringer Fehler, ist es von größter Wichtigkeit für das innere Leben, treu den Vorsatz zu beobachten, sich nicht mehr gehen zu lassen, die Nachlässigkeiten und alles, was Gott missfällt, zu meiden.
Gewiss, wenn kein «ob ex» vorliegt, wirkt das Sakrament im wesentlichen von selbst. Dennoch müssen wir uns bemühen, den ganzen Gnadenschatz zu verwerten, den das Sakrament in sich birgt, wenn wir aufrichtig wünschen, dass unsere Beichten uns im Vollkommenheitsstreben fördern. Deshalb müssen wir stets den festen Vorsatz vor Augen haben, nicht wieder in die Fehler zurückzufallen, die wir bekannt haben, auch nicht in die unbedeutenderen. Man hat sich z. B. der Ungeduld gegen Personen seiner Umgebung angeklagt, oder unfreundlicher Worte, oder der Nachlässigkeit in der Erfüllung der verschiedenen Standespflichten, oder des Egoismus, da man lästige Arbeit auf andere abwälzte ... und nach der Beichte vergisst man Reue und Vorsatz und handelt so, als ob man nicht gebeichtet hätte.
Aus Liebe zu Christus sollen wir den Willen zur Besserung wachhalten. Kommt dann wieder eine Gelegenheit zur Sünde, werden wir sie schnell abzuweisen vermögen.
Viele Menschen bleiben stets schwach im Dienste Gottes. In der Beichte betrachten sie ihre Fehler nicht mit dem aufrichtigen Wunsch, sie abzulegen. Sie wissen zwar, dass jeder Schritt im geistlichen Leben eine Erhebung der Seele und eine Freudenquelle darstellt, aber sie vergessen, dass dies die Frucht innerer Loslösung und vollkommenster Selbstverleugnung, eines völligen Verzichtes ist. Hier auf Erden entsteht nichts Großes ohne Opfer.
Noch eines ist anzuraten, damit die Beichte mehr ausgesprochen wurde (Sess. XXII, Kap. 2). Und bemühen wir uns dann im Lauf des Tages bei all unsern Beschäftigungen, Reue über unsere Sünden zu erwecken.
2. Der Geist der Zerknirschung
Unsere Weihe an Gott bei der Taufe und der Priesterweihe bedingt von rechtswegen einen totalen und unwiderruflichen Bruch mit der Sünde: «Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde» (Röm 6, 10). Nach der Auffassung des hl. Paulus ist dieses «der Sünde gestorben sein» nicht so sehr ein vorübergehender Akt, als vielmehr ein definitiver Zustand: «Ihr seid ja gestorben» (Kol 3, 3).
Wie die Erfahrung lehrt, ist dieses Sterben, soweit es sich um die lässliche Sünde handelt, bei vielen Seelen höchst unvollständig. In ihrem Leben wechseln Rückgang und Fortschritt ab; die Sünde herrscht noch zu sehr in ihnen.
Es gibt außer dem Bußsakrament noch ein Mittel, das unsere geistliche Loslösung sehr wirksam unterstützen kann: der Geist der Zerknirschung, die Herzensreue. Je älter ich werde, desto klarer erkenne ich, dass unsere geringe Beständigkeit und unser geringer Fortschritt in der Tugend sehr oft die Folge davon ist, dass uns der Geist der Zerknirschung fehlt (Siehe: Un maître de la vie spirituelle, SS. 466-468, 518).
Worin besteht der Geist der Zerknirschung? Es ist ein habituelles Gefühl des Schmerzes darüber, die göttliche Güte beleidigt zu haben. Diese Haltung hat ihren Ursprung in reuiger Liebe. Sie weckt in der Seele Abscheu vor der Sünde, weil sie Gott missfällt und uns schadet. Wenn die Seele im Bußsakrament durch einen flüchtigen Akt unvollkommener Reue der Gnade erschlossen und gegen Rückfälle gestärkt wird, so bewirkt eine Reue, die aus Liebe hervorgeht und im Bewusstsein lebendig erhalten wird, einen Zustand unüberwindlichen Widerstandes gegen jede Hinneigung zur Sünde. Wir wissen dann, dass es absolut unvereinbar ist, einerseits die Sünde zurückweisen zu wollen, anderseits fortzufahren, sie zu begehen. Wird eine solche Haltung zur Gewohnheit, so ist sie ein sicheres Mittel gegen die Lauheit.
Die ständige Reue über vergangene Sünden: «Meine Sünde steht stets vor meinen Augen» (Ps 50, 5), soll ihre Ursache nicht in den Umständen der einzelnen Sünde haben, sondern in der Tatsache, dass sie eine Beleidigung Gottes ist. Also hat es keinen Sinn, die konkreten Einzelheiten der Sünde ins Gedächtnis zurückzurufen - das ist sogar zuweilen gefährlich -, sondern wir sollen bereuen, unsern menschlichen Willen dem Willen Gottes entgegengesetzt, uns gegen seine Herrschaft aufgelehnt, seine Liebe verkannt und den kostbaren Schatz der Gnade vernachlässigt, vergeudet oder verloren zu haben.
So verstehen wir, dass die heiligen Seelen, die eine klare Erkenntnis von der Majestät Gottes, von der Erhabenheit der übernatürlichen Gaben und von der Schwere jeder Beleidigung Gottes haben, vom Geist der Zerknirschung erfüllt sind. Wer könnte erraten, welches Gebet die hl. Theresia von Avila ständig auf ihrem Arbeitstisch hatte? Man würde erwarten, dass es ein Lobpreis der göttlichen Liebe ist, wie er so oft über ihre Lippen kam. Doch nein, es ist ein Psalmvers, den auch der größte Sünder wählen könnte; «Herr, geh nicht ins Gericht mit deiner Magd» (Ps 142,2) (Histoire de sainte Therese d'après les Bollandistes, II, S. 27). Diese tiefe Zerknirschung war ihr notwendig. Jedes andere Fundament hätte bei einem solch außerordentlichen Aufstieg versagt. Die hl. Katharina von Siena wiederholte auf ihrem Sterbebett ständig das Wort, das sie während ihres ganzen Lebens so oft gebetet hatte: «Ich habe gesündigt, Herr; erbarme dich meiner» (Drane O. P., Histoire de sainte Catherine de Sienne, SS. 54-55).
Viele werden vielleicht finden, das seien fromme Übertreibungen. Doch der hl. Johannes schreibt: «Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns ... so stellen wir ihn (Gott) als Lügner hin, und sein Wort ist nicht in uns» (1 Joh 1,8-10).
Und gleichen wir nicht tatsächlich alle mehr oder weniger dem verlorenen Sohn, da wir uns durch die Sünde oder durch geistige Verschwendung vom Vater trennen? Müssen nicht wir alle im Gedanken an unsere Unzartheit und Undankbarkeit sprechen: «Vater, ich habe gesündigt ... ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen» (Lk 15, 21) ? Auch wenn wir nur einmal Gott beleidigt hätten und am Leiden Jesu mitschuldig geworden wären, so müsste dies eine liebende Seele schon schwer belasten. Und der Priester, der niemals eine schwere Sünde begangen hat, wird - wenn er vor Gott in der Wahrheit leben will - umso klarer seine Fehler erkennen, je mehr er von der Gnade behütet wurde.
Sind wir nicht vom Vater erwartet worden, wie der Verlorene Sohn in Gleichnis? Hat uns der Vater nicht die Arme seines Erbarmens weit entgegengestreckt? Hat er nach unserer Heimkehr nicht unserer Sünden vergessen und uns seine Freundschaft wiedergeschenkt ?
Der Geist der Zerknirschung bewahrt in uns nicht nur das Andenken an unsere Sünden, sondern auch an die göttliche Verzeihung. Deshalb ist er eine Quelle des Friedens, des Vertrauens und auch der Freude, einer demütigen, aber tiefen Freude. Er verhindert, dass wir in der Sünde und in dem, was zur Sünde führt, Befriedigung finden, schließt Leichtfertigkeit und Sich-gehen-Iassen aus und weitet das Herz in der Freude des Vaters. So wird das Wort des Psalmisten an uns erfüllt: «Deines Heiles Wonne lass neu mich erfahren» (Ps 51, 14).
3. Die Bedeutung der Zerknirschung für den Priester
Der Geist der Zerknirschung verstärkt in der Seele den Wunsch, Gott zu gefallen, er bewahrt ihn vor vielen Versuchungen und hilft ihm, die auftauchenden Schwierigkeiten zu überwinden. Das ist eine der wertvollsten Früchte dieser Geisteshaltung.
Das gilt vor allem für den Priester, denn er ist zur Heiligkeit berufen und lebt inmitten der Verderbnis dieser Welt, wo drei Feinde ihn bedrängen: das Fleisch, die Welt, der Teufel. Diese Feinde verfolgen ihn von seiner Weihe an bis zum Grab und trachten danach, ihn des wahren Lebens zu berauben, das er in Jesus Christus besitzt.
«Die Begierlichkeit des Fleisches.» - Der Mensch ist von Natur aus darauf angelegt, eine Familie zu gründen. Wenn sein Leben in der Einsamkeit des Zölibates verläuft, so vermag er nur kraft der Gnade durchzuhalten. Für manche ist dieser Verzicht sehr hart, denn der Feind, gegen den sie zu kämpfen haben, ist die eigene Natur. Weder das Alter noch eine Würde noch eine Stellung schützen vor seinen Angriffen.
Selbst Heilige, die ein sehr strenges Leben führten, mussten die Angriffe dieses «inneren Feindes» erdulden. Vom hl. Joseph von Cupertino wird erzählt, er habe nach den erhabensten Ekstasen den demütigenden Aufruhr der Leidenschaften erlebt (Acta Sanctorum, septembris, V, 1019).
Auf diesem Gebiet ist immer Wachsamkeit geboten, mag unser vergangenes Leben noch so rein sein. Glauben wir ja nicht, wir seien unverwundbar. Jede Selbstüberschätzung ist gefährlich, auf was immer sie sich beziehen mag. Auch die innigste Verbindung mit Gott, auch ein hoher Grad der Heiligkeit kann uns nicht von der Verpflichtung zu demütiger Vorsicht dispensieren.
Der zweite Feind ist die Welt. - Wir leben inmitten von Ideen, Grundsätzen und Bestrebungen, die denen Christi völlig entgegengesetzt sind: «Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin» (Joh 17, 14, 16). Zweimal sagte Jesus dies von seinen Aposteln in der Stunde, in der er sie zu Priestern weihte. Diese Worte müssen sich auch an uns bewahrheiten. Wenn wir nicht vom Geist des Evangeliums erfüllt sind, dann wird der Geist der Welt unser Denken bestimmen und uns allmählich auf sein Niveau herabziehen; dann interessieren wir uns nicht mehr für religiöse Dinge, sondern nur noch für profanes Wissen und Wohlleben.
Man nennt diese Erde zuweilen ein Tränental. Im Grunde ist das ganz richtig; aber es gibt dennoch Tage, an denen die irdischen Genüsse großen Reiz auf unsere arme Natur ausüben. Die Welt scheint Glück zu bieten. Ihre Freuden, das Lachen, die Schönheit, die Annehmlichkeiten, tausend Kleinigkeiten, die den Sinnen schmeicheln, die Leidenschaften wecken, sind viel angenehmer als das Gebet und die Strenge der Enthaltsamkeit.
Auch große Heilige haben die Macht dieses Blendwerkes kennengelernt : «Faszination ... Nichtigkeit» (Weish 4, 12). Sie bekennen, dass sie im Kontakt mit der Welt, selbst wenn er zur Erfüllung ihrer Pflicht notwendig war, die Versuchungen der dreifachen Begierlichkeit, die dort herrscht, zu erleiden hatten: Fleischeslust, Augenlust und Hoffart des Lebens (1 Joh 2, 16). Die Staubwolken der Welt trüben leicht das Auge des Glaubens und hindern uns, den Blick allein auf Gott und seine Liebe gerichtet zu halten. Der hl. Karl Borromäus, dieses Vorbild von Kraft und männlicher Tugend, erkannte, dass sein geistliches Leben Schaden litt, wenn er sich in seinem Vaterhaus mit dem herrschaftlichen Luxus aufhielt (Juissano, Vie de saint Charles, aus dem Italienischen übersetzt von Cloyseault, Lyon 1685, S. 737). Wir sind nicht heiliger und nicht stärker als dieser große Bischof, und wenn wir bei den Besuchen und Beziehungen, zu denen uns unser Amt verpflichtet, nicht vorsichtig sind, laufen wir Gefahr, mitgerissen zu werden.
Der dritte Feind ist der Teufel. - Wie wir schon sagten, lebt sogar im verkommensten Menschen neben dem Hass ein wenig Menschlichkeit. Nur selten wird ein Herz so verhärtet, dass es ganz teilnahmslos für fremdes Leid ist. Der satanische Hass hingegen ist mitleidslos. Da die gefallenen Geister immateriell sind, kennt ihre Natur weder Müdigkeit noch Ruhe; so sind sie immer bereit zu schaden. Der Teufel hasst Gott, aber da er ihn selbst nicht erreichen kann, wendet er sich gegen seine Geschöpfe, vor allem gegen seine bevorzugten Geschöpfe, die Priester, die ein lebendiges Abbild Christi sind.
Durch unsere Berufung, durch unsere Aufgabe und die Pflichten, die sich aus ihr ergeben, sind wir Priester ganz besonders den offenen oder versteckten Angriffen dieser Feinde ausgesetzt.
Wenn wir ihre Stärke und unsere Schwäche erwägen, erinnern wir uns des Wortes, das die Apostel einst an Jesus richteten: «Wer kann da gerettet werden?» (Mt 19, 25). Der göttliche Meister antwortet uns wie seinen Jüngern: «Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich» (Mt 19, 26). Es ist gut, wenn wir uns dieses Wort einprägen. Mit rein natürlichen Kräften ist es unmöglich, das Verlangen des Fleisches, den Rausch weltlicher Erfolge, die hochmütige Selbstzufriedenheit zu überwinden.
Erkennen wir in heiliger Zerknirschung unsere Schwäche an, wachen und beten wir, wie der Herr uns rät (Mt 26,41).
Wachet. Jeder denkende Mensch weiß aus persönlicher Erfahrung und aus der Erfahrung seiner Mitmenschen, welche Umstände zu sittlicher Erschlaffung führen. Der Priester muss mehr als jeder andere erkennen, welche Nachlässigkeiten in seinem Stand den Fall in Sünde vorbereiten. Die Gelegenheiten sind für jeden andere, je nach seinen Neigungen, seinen Schwächen, seiner Umgebung; aber die Möglichkeit des Falles ist für alle gegeben. Seien wir überzeugt: es gibt keine Sünde, die je ein Mensch begangen hat, zu der nicht auch ein anderer Mensch fähig wäre.
Zur Wachsamkeit muss das Gebet kommen, die Hinwendung zu ihm, dem «alles möglich» ist, zu unserm göttlichen Meister. Er ist es, der uns erwählt hat; ebenso wie für seine Apostel bittet er auch für uns den Vater, er möge uns «nicht aus der Welt hinwegnehmen, aber uns vor dem Bösen bewahren» (vgl. Joh 17, 15). Dem hl. Paulus entringt sich die Klage: «Wer erlöst mich von diesem todgeweihten Leib?» Und er antwortet: «Die Gnade Gottes durch Jesus Christus» (Röm 7, 24. 25). Es ist dies die Antwort, die Jesus selbst ihm gab, als der Apostel, von Satan bedrängt, ihn dreimal gebeten hatte, er möge ihn befreien. «Meine Gnade genügt dir. Die Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung» (2 Kor 12,9). So wird es auch bei uns sein. Lesen wir den Psalm 91, den wir jeden Abend beten. Er gibt uns Vertrauen im Kampf. Unter eindrücklichen Bildern sind dort die verschiedenen Arten der Versuchung beschrieben, aber Gott verheißt dem Gebet den Sieg: «Wenn Tausende fallen zu deiner Linken, Zehntausende zu deiner Rechten, dich wird das Unheil nicht ereilen ... Er ruft zu mir, und ich erhöre ihn; in jeder Not bin ich ihm nahe ... Ich will ihn schauen lassen einst mein Heil.» (In dem Buch «Christus in seinen Geheimnissen», im Kapitel «Die Versuchung des Christen», hat Dom Marmion diesen Gedanken ausgeführt).
4. Die Zerknirschung in der Messliturgie
Die Kirche ist die Braut Christi; niemand weiß so gut wie sie, wie ihr Bräutigam geehrt und Gott Verherrlichung erwiesen werden soll; überdies ist sie bei Festsetzung der liturgischen Vorschriften vom Heiligen Geist geleitet. Wir wissen niemals mit so großer Sicherheit, dass wir in der Wahrheit sind, als wenn wir in ihrem Geiste beten: «Lex orandi, lex credendi.» (Das Gesetz des Betens entspricht dem Gesetz des Glaubens: Diese Formel ist eine kurze Zusammenfassung der bekannten Sentenz: «Ut legem credendi statuat lex supplicandi.» Denzinger, Nr.139). Und welche Worte legt die Kirche beim wesentlichsten Akt unseres Priesteramtes, dem heiligen Messopfer, auf unsere Lippen? Welche Haltung sollen wir nach ihrer Absicht haben? Welche Gesinnung will sie in uns hervorrufen ?
Beim Priester, der das Messopfer darbringt, kann man voraussetzen, dass er in Freundschaft mit Gott lebt. Und doch, kaum ist er zum Altar getreten, da beugt er sich tief, schlägt an seine Brust wie der Zöllner im Evangelium und bekennt sich als Sünder: «dass ich viel gesündigt … meine übergroße Schuld ...» Mag er noch so heilig sein, er kann nicht dem Herrn nahen, ohne dieses demütige Bekenntnis abzulegen. Durch den Mund des Messdieners klagt sich hierauf das Volk an, und dann kommt auf die ganze christliche Familie die Verzeihung Gottes herab: «Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der allmächtige und barmherzige Herr ...»
Und wenn der Priester die Stufen zum Altar empor schreitet, lässt die Kirche ihn sprechen: «Herr wir bitten Dich … nimm unsere Sünden.» Ja, man muss wirklich rein sein, um in das Allerheiligste einzugehen.
Wenn der Priester den Altarstein küsst, will er seine Vereinigung mit Christus andeuten, dessen Sinnbild der Altar ist, und auch seine Einheit mit der Kirche in der Person ihrer Martyrer, deren Reliquien dort eingeschlossen sind. Durch ihre Verdienste erbittet er «Verzeihung aller seiner Sünden».
Nach dem Introitus ruft der Zelebrant neunmal den Herrn an; er bittet, Gott möge sich aller menschlichen Not erbarmen, deren niederdrückendste die Sünde ist: Kyrie eleison. .. Wenn wir wollen, dass Gott uns gnädig annimmt, müssen wir uns stets an seine Barmherzigkeit wenden.
Das «Gloria in excelsis» ist ein Echo des Engelsgesanges. Doch wenn menschliche Lippen ihn wiederholen, schließt sich an den Lobpreis ein Flehen an : «Der du hinwegnimmst die Sünden der Welt ... der du sitzest zur Rechten des Vaters ... erbarme dich unser.»
Wir können nicht das Evangelium lesen, ohne zuvor Gott gebeten zu haben, er möge unsere «Lippen reinigen».
Hier stehen wir noch in der Vormesse und wir verstehen, dass die Kirche uns eindringlich diese Gesinnung empfiehlt, um uns würdiger auf das Opfer vorzubereiten. Aber das genügt ihr nicht; je mehr die heilige Handlung fortschreitet, desto mehr drängt sie uns zur Zerknirschung.
Beim Offertorium nehmen wir die Hostie in die Hände, die zur heiligen Opfergabe wird. Mit welchen Worten bieten wir sie dem Vater dar? «Nimm an .. , diese makellose Opfergabe .. , ich, dein unwürdiger Diener, opfere sie auf für meine unzähligen Sünden, Fehler und Nachlässigkeiten ...» So entsprechen wir dem Rat des hl. Paulus : «Wie für das Volk, so muss er auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen» (Hebr 5,3). Das ist ein großer Trost für den Diener Christi. Jeden Tag darf er das göttliche Schlachtopfer als Genugtuung für seine persönlichen Sünden, für seinen Mangel an Zartgefühl gegen Gott aufopfern.
Nach der Darbringung der Opfergaben schreibt die Rubrik dem Priester vor, sich in einer Haltung der «Demut und Zerknirschung» zu neigen: «Lass uns, o Herr, im Geist der Demut und mit zerknirschtem Herzen bei Dir Annahme finden.» Er opfert Gott seine Arbeit, seine Leiden, sein ganzes Leben auf, damit sie durch Jesus dem Vater angenehm werden. «Ein Opfer, das Gott gefällt, ist ein reuiger Geist», «Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist» (Ps 51, 19); doch wenn wir, mit Christus vereint, die heilige Hostie in dieser Gesinnung aufopfern, dann vergisst Gott die Sünden und die Undankbarkeit unseres vergangenen Lebens, mögen sie noch so groß gewesen sein.
Der Kanon besteht aus erhabenen Gebeten. Der Priester naht sich ehrfurchtsvoll dem unendlich erhabenen, aber auch unendlich gütigen Gott: «Dich gütiger Vater.» Durch Jesus Christus kann er vertrauend zum Vater gehen: «d�urch Jesus Christus Deinen Sohn». Und die Haltung, in der er betet, bekundet wiederum tiefe Ehrfurcht: er neigt sich, küsst den Altar und fährt fort: «Nimm wohlgefällig an ...»
Vor der Konsekration breitet der Priester die Hände über die Opfergaben aus, wie im Alten Testament der Hohepriester über das Opfer, das stellvertretend für das sündige Volk geopfert wurde (Diese Interpretation ist die gewöhnliche, obwohl der Ritus des Händeausbreitens erst spät in den Kanon eingefügt wurde, im 16. Jahrhundert). Aus dem Gebet, das diese Handlung begleitet, ist erkennbar, dass die Sünder die Schuldigen sind, die Strafe verdient hätten. «An ihrer Stelle nimm, o Herr, eine heilige, makellose Opfergabe an ; nimm sie gnädig auf, du liebst sie ja, denn es ist Jesus selbst.» Und was ist es, was der Priester durch die Verdienste Christi erbittet? «Vor der ewigen Verdammnis bewahrt und in die Zahl der Auserwählten aufgenommen zu werden.» In diesem feierlichen Augenblick wird er nicht von einer Ekstase, nicht von Entzücken erfasst, sondern von dem Gefühl tiefster Zerknirschung.
Bei der Wandlung tritt der Priester völlig zurück. Wir sehen in ihm nur noch Christus. Er sagt nicht: «Das ist der Leib... das Blut des Erlösers», sondern: «Das ist mein Leib . .. das ist mein Blut, das vergossen wird ... zur Vergebung der Sünden.» Damit ist der Zweck des Sühnopfers ausgesprochen. Dieses Wort weckt in uns grenzenloses Vertrauen, dass kraft der Hinopferung Jesu alle unsere Sünden verziehen werden.
Bald darauf bricht der Priester das Schweigen des Kanon mit den Worten: «Auch uns Sündern»; er schlägt an seine Brust und bittet den Herrn, nicht auf Grund seiner eigenen Verdienste, sondern durch die göttliche Güte in die Gemeinschaft der Martyrer und Heiligen aufgenommen zu werden. Auch da ist die Seelenhaltung, die die Worte der Liturgie fordern, eine tiefe, aber vertrauensvolle Zerknirschung.
Alle großen Päpste, die wir verehren, Ambrosius, Leo, Gregor, haben ganz oder teilweise diese Formeln gebetet (Im Laufe der ersten Jahrhunderte wurde der Text des Kanon verändert und erweitert; erst in der Zeit des hl. Gregor wurde er festgelegt). Moderne Heilige, Franz von Sales, Alphons von Liguori, der Pfarrer von Ars und viele andere haben sie ebenfalls ausgesprochen.
Und wenn der Augenblick der Kommunion kommt, in dem der Priester sich mit Christus vereinigen will, ruft er ihn an als «Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt». Erwägen wir auch die Worte: «Schau nicht auf meine Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche ... Erlöse mich von allen meinen Sünden.» Und betrachten wir vor allem die Wahrheit, die im dreimaligen «Herr, ich bin nicht würdig» ausgedrückt ist.
Das ist der Geist der Kirche. Nicht nur einmal, sondern während der ganzen heiligen Handlung mahnt die Kirche jeden ihrer Priester zu demütiger Gesinnung. Die wesentlichen Huldigungen der Anbetung, des Lobes, der Danksagung verbindet sie unaufhörlich mit Akten tiefer Zerknirschung. Wenn der Herr in seiner unendlichen Herablassung uns seiner Gegenwart würdigt und unsere Bitten annimmt, fordert seine Gerechtigkeit, dass wir auch unsere Sündhaftigkeit anerkennen.
Vor dem Thron Gottes singen die Engel unaufhörlich: «Sanctus (Heilig), Sanctus, Sanctus.» Das ist die Huldigung, die sie der unendlichen Majestät Gottes erweisen. Für uns besteht in der Zeit der Verbannung unsere Verherrlichung Gottes vor allem darin, dass wir die Grenzenlosigkeit des ewigen Erbarmens durch das demütige Bekenntnis unseres Elends und unserer Sünden preisen.
Jedes Gebet kann in uns den Geist der Zerknirschung vertiefen. Nicht nur bei der Darbringung des heiligen Opfers, sondern auch beim Beten des Stundengebetes finden wir viele Stellen, die heilige Zerknirschung ausdrücken.
Wie viele Psalmen drücken Gott unsern Schmerz darüber aus, dass wir seine Güte beleidigt haben! Doch zur Klage des zerknirschten Herzens gesellt sich immer die Hoffnung und der Glaube an die Verzeihung: «Erbarme dich meiner ... in deiner Güte, o Gott ...» «Erbarme dich meiner, denn in dir sucht meine Seele Zuflucht» (Ps 51, 3 und 57,2). Das tiefe Sehnen des Psalmisten geht dahin, ein reines Herz zu haben: «Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott» und von der Kraft des Geistes gestärkt zu werden: «Gib mir einen beständigen Geist».
Wenn wir andächtig das Stundengebet rezitieren, wird uns der Heilige Geist Verständnis für diese Psalmverse geben, so dass durch ihre Erwägung die Gesinnung in uns erweckt wird, die sie ausdrücken.
5. Der Kreuzweg, eine Quelle der Zerknirschung
Aus langer Erfahrung weiß ich, dass die Kreuzwegandacht eines der wirksamsten Mittel ist, um den Geist der Zerknirschung in uns lebendig zu halten (Die Anregung, das Leiden Christi durch die Kreuzwegandacht zu verehren, empfing Dom Marmion im Priesterseminar von seinem Seelenführer, dem heiligmäßigen Lazaristenpater Gowan, und er blieb dieser Übung bis zu seinem Tod treu. - Siehe: Un maître de la vie spirituelle, S. 20 und SS. 494-499).
Wie ist die heiligende Wirkung der Kreuzwegandacht zu erklären? Sie beruht darauf, dass Christus sich uns da in ganz besonderer Weise als den zeigt, dessen Vorbild, Verdienst und Wirken die Ursache der Heiligkeit ist. In seinem Leiden offenbart sich Jesus als Idealbild aller Tugend. Mehr als sonst erkennen wir hier seine Liebe zum Vater und zu den Seelen, seine Geduld und Sanftmut, sein hochherziges Verzeihen. Aus seinem Gehorsam schöpft er die Kraft, auf dem Schmerzensweg auszuharren bis zum «Es ist vollbracht».
Durch die Betrachtung der inneren Leiden Jesu lernen wir, seinen Abscheu vor der Sünde teilen, und wir bringen mit ihm sein Opfer dar, um den Abgrund der Weltsünde auszufüllen. Das ist eine unschätzbare Gnade.
Man kann das Beispiel Jesu nicht von außen nachahmen, ohne an seinem Leben teilzunehmen. In jeder Phase seiner Passion erwarb er uns die Fähigkeit, durch seine Gnade die Angleichung an die Tugenden zu erlangen, die wir an ihm betrachten: «Es ging eine Kraft von ihm aus» (Lk 6, 19). Eines Tages berührte eine arme kranke Frau den Herrn und ward geheilt. Auch wir können, wie der hl. Augustinus sagt, Christus durch den Glauben an seine Gottheit gleichsam «berühren»: «Wer an Christus glaubt, der berührt ihn. Willst du Christus in gebührender Weise berühren? Glaube, dass Christus gleichewig ist wie der Vater, und du hast ihn berührt.» (Sermo 243, 2, P. L. 38, Sp.1144).
Betrachten wir Jesus auf seinem Schmerzensweg. Er liefert sich aus, er leidet für uns; glauben wir, dass er Gott ist und dass er uns liebt. So öffnen wir unsere Seele seinem heiligenden Wirken (Dom Marmion hat diesen Gedanken im Kapitel: «Vom Prätorium bis Kalvaria» des Buches «Christus in seinen Geheimnissen» ausgeführt. Er fügte eine Betrachtung über jede Kreuzwegstation hinzu. Dieses Kapitel wurde als Sonderdruck in Form einer Broschüre veröffentlicht: «Le chemin de la croix»).
An dieser Gnadenmitteilung haben die Sinne keinen Anteil. Die fühlbaren Regungen dürfen niemals die Basis oder das Motiv oder der Gradmesser unserer Frömmigkeit sein. Dennoch sind sie, wenn unsere Frömmigkeit sich ganz auf den Glauben stützt, uns eine Hilfe, Zerstreuungen zu vermeiden und unsere Gedanken auf Gott zu konzentrieren.
Die Kirche ermahnt alle Christen, die Passion Christi zu betrachten; doch vor allem fordert sie ihre Priester dazu auf. Sie will dadurch zweifellos erreichen, dass wir teilnehmen an den Leiden Christi und seine Tugenden nachahmen; überdies sollen wir nach ihrer Absicht erlangen, dass durch diese Geheimnisse die göttlichen Verdienste uns und jenen, für die wir beten, in überreichem Maße zugewendet werden.
Der Priester ist der eigentliche «Ausspender der Erlösungsfrüchte» («Dispensatores mysteriorum Dei») (1 Kor 4,1). Wenn - nach einem Wort des hl. Paulus - jeden Tag der Tod des Herrn auf unsern Altären verkündet wird, so geschieht es durch den Priester. Hier ist er in Verbindung mit dem Quell der Gnaden, denn sie gehen vom Kreuz aus. Darum muss er vor allem den Wert des göttlichen Blutes zu erfassen suchen und auf seine Verdienste hoffen.
Doch wie ist es zuweilen in Wirklichkeit? Wir bleiben inmitten dieser Reichtümer geistig sehr arm, wir bleiben hungrig inmitten dieses Überflusses. Die Kreuzwegandacht kann helfen, unsern geringen Eifer zu beleben, und soll so für uns zu einer «Quelle lebendigen Wassers werden, das fortströmt ins ewige Leben» (Joh 4, '14). Bei jeder der vierzehn Stationen vereinigen wir uns durch einen Akt der Liebe mit dem Erlöser und erfrischen unsere Seele in den Fluten der Gnade, die aus dem Herzen des Herrn hervorgehen.
Die Kreuzwegandacht kann man zu jeder Zeit üben; aber es entspricht in hohem Maße ihrer Eigenart, sie als Danksagung nach der Heiligen Messe zu beten. Während Gott noch unter den sakramentalen Gestalten gegenwärtig ist, folgt man vereint mit ihm dem Weg, den er vorangeschritten ist. Wenn wir so mit Jesus Schritt für Schritt den Kreuzweg gehen, bekennen wir dadurch unsern Glauben an den unermesslichen Wert seines Leidens, das auf den Altären unaufhörlich aufgeopfert wird.
Bei dieser Andacht wird kein mündliches Gebet gefordert; es genügt, wenn Geist und Herz ganz dabei sind.
Priester haben mir zuweilen gesagt: «Wir machen keine Betrachtung mehr; sie ist zu schwierig für uns geworden; wir haben kein inneres Leben.» Und ich antwortete ihnen: «Aber haben Sie schon versucht, den Kreuzweg betrachtend zu beten ?»
An welchem Zeichen erkennen wir, ob der Geist der Zerknirschung in uns lebt? Dafür gibt es ein unfehlbares Kriterium.
Die Zerknirschung lässt die Fehler der andern mit Milde beurteilen; das Gefühl der eigenen Unwürdigkeit beherrscht uns.
Fragen wir uns, ob wir streng, anspruchsvoll und hart gegen andere sind, ob wir leichtfertig oder ironisch die Fehler und Mängel der andern aufdecken, ob wir sie tadeln, ohne ein Recht dazu zu haben, ob wir leicht Anstoß nehmen. Wenn ja, dann ist es ein Zeichen, dass wir nicht unser eigenes Elend vor Augen haben und nicht der Beleidigungen gedenken, die Gott uns verziehen hat.
Eine Parabel des Evangeliums illustriert sehr gut diese Wahrheit. Zwei Männer gehen in den Tempel, der Pharisäer und der Zöllner. Sie beten. Der Pharisäer sieht die Fehler der andern; deshalb hält er die Augen offen; seinen Nächsten beobachtet und beurteilt er mit Strenge, aber seine eigene Schuld übersieht er. Von seinem Lebenswandel, dessen Elend vor Gott offenliegt, erinnert er sich an nichts als an sein Fasten und seine Almosen. Seine Sünden sind ihm nicht bewusst. Fast möchte er zu Gott sagen: «Du kannst stolz auf mich sein.» Sein Gebet ist selbstgefällig. Und wenn er sagt: «Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser da», so rechtfertigt ihn die Danksagung nicht, obwohl seine Selbsteinschätzung einen gewissen Schein von Berechtigung hat. Warum? Weil seine Seele nicht von Zerknirschung durchdrungen ist; es fehlt ihm gänzlich an Demut.
Der Zöllner hingegen schaut nicht auf den Pharisäer. Er kennt sein Elend und kümmert sich nicht um das des Nächsten. Er schlägt an die Brust und spricht: «Gott, sei mir Sünder gnädig!» (Lk 18, 13). Der Sünder, der in Zerknirschung betet, wird von Jesus vor Gott gerechtfertigt.
VII. ER ERNIEDRIGTE SICH UND WARD GEHORSAM
Die Zerknirschung ist immer eine Gefährtin der Demut. Die Bedeutung der Demut für die Heiligung des Priesters ist so groß, dass wir dabei verweilen müssen.
Wir alle neigen dazu, uns Gott auf menschliche Weise vorzustellen. Wir können uns z. B. nicht leicht ein Wesen denken, dass nicht ärmer wird, wenn es gibt; wenn ein Mensch Wohltaten spendet, vermindert sich sein Besitz. Nur Gott wird durch seine Gaben nicht ärmer. Er ist die wesenhafte Güte, da er die unendliche Liebe ist; und es liegt in seiner Natur, die Geschöpfe an seinem Reichtum teilnehmen zu lassen, ihnen seine Seligkeit mitzuteilen, sich selbst zu schenken: «Das Gute will sich verströmen» («Bonum est diffusivum sui).» Deshalb gefiel es Gott, den Menschen an seinem eigenen Leben teilnehmen zu lassen, ihn zu seinem Erben und zum Miterben Christi einzusetzen (Röm 8, 17). Menschwerdung, Erlösung, Eucharistie, Gründung der Kirche, Wohltaten ohne Ende sind die Offenbarung dieser grenzenlosen Güte.
Wenn Gott wirklich so sehr die Heiligung der Menschen wünscht - wird man einwenden -, warum ist es uns dann so schwer, im Übernatürlichen zu leben? Wie kann es da geschehen, dass der Diener Gottes, der den Quellen der Gnade so nahesteht und ihr Ausspender ist, zuweilen der Verbindung mit Gott beraubt ist? Was ist es, das sozusagen die Hand Gottes verschließt?
Der Hochmut. Wären wir ganz demütig, so wären der göttlichen Freigebigkeit keine Grenzen gesetzt. Das Evangelium spricht da eine sehr entschiedene Sprache: «Wer sich erhöht, wird erniedrigt, und wer sich erniedrigt, wird erhöht werden» (Lk 18, 14). - Die Apostelbriefe sprechen nicht weniger kategorisch. Zweimal lesen wir den überraschenden Satz: «Gott widersteht den Stolzen, dem Demütigen aber gibt er seine Gnade» (1 Petr 5, 5; Jak. 4,6).
Diese schlichten Worte sagen uns sehr viel. Wenn wir uns zu Gott erheben wollen, müssen wir uns demütigen.
1. Das Geschöpf vor dem Schöpfer
Die christliche Demut ist vor allem eine Seelenhaltung, nicht den Menschen gegenüber, nicht uns selbst gegenüber, sondern vor Gott. Ohne Zweifel fordert die Demut Nachgiebigkeit gegen den Nächsten und zuweilen Unterwerfung; im inneren Urteil, das der Mensch über sich selbst ausspricht, wird sie ihn stets zu einer gesunden Bescheidenheit bestimmen.
Doch das sind die Auswirkungen einer Einstellung, die tiefer begründet ist. Die Grundhaltung der demütigen Seele ist das Verlangen, sich vor Gott zu beugen und in Übereinstimmung mit seinen Forderungen zu leben; d. h. sie wünscht so zu denken und zu handeln, wie der Herr es will und von ihr erwartet. Die Demut stellt die Seele in ihrem Elend, in ihrem Nichts, so, wie sie ist, vor Gott. Man kann sie definieren als die Tugend, die den Menschen geneigt macht, in der Gegenwart Gottes den ihm zukommenden Platz einzunehmen. Was sind die Menschen auf Erden? Wesen auf dem Weg zur Ewigkeit; sie gehen nur vorüber. In der Schöpfungsordnung und mehr noch in der übernatürlichen Heilsordnung besitzt der Mensch nichts, was er nicht empfangen hätte: «Was hast du, das du nicht empfangen hast ?» Und der Apostel fügt hinzu: «Was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen?» (1 Kor 4, 7).
Die Demut besteht nicht darin, diese Abhängigkeit theoretisch anzuerkennen, sondern sie freiwillig zu bekennen durch eine praktische Unterwerfung unter Gott und die göttliche Ordnung. In dem Wunsch, seiner wahren Situation entsprechend zu leben, weist der demütige Mensch die Vielfalt ungeordneter Wünsche zurück, die ihn drängen, sich selbst zur Geltung zu bringen, außerhalb der Gesetze, die Gott und die Natur festgelegt haben.
Wie der hl. Thomas sagt, ist die Demut eine Tugend des Willens. Doch sie wird geleitet durch das Wissen: «Normam habet in cognitione» (S. th. lI-lI, q.161, a.2 u. 6). Durch welches Wissen? Das um die Souveränität Gottes einerseits und die Nichtigkeit des Menschen anderseits. Das sind zwei klar erkennbare Abgründe, die die Seele erblickt, aber nie ergründen kann.
Die Gegenüberstellung des Menschen und der Größe Gottes muss sich vor allem im Schweigen des Gebetes vollziehen. Die Heilige Schrift sagt: «Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer» (Hebr 12, 29). Je mehr man ihm in Glaubensgesinnung naht, desto mehr wird er sich der Seele bemächtigen. Das gleiche Licht, das den Menschen die Größe Gottes erkennen lässt, enthüllt ihm seine totale Unwürdigkeit.
Die Demut ist eine Haltung der Wahrheit. Der hl. Augustinus sagt: «Mit gutem Recht sagt man gern, die Demut halte es mit der Wahrheit und nicht mit dem Irrtum» (De natura et gratia, 34. P. L. 44, Sp. 265).
Der Hochmut hingegen beruht immer in erster Linie auf einem irrigen Urteil. Der Hochmütige gefällt sich in ungeordneter Weise in seiner eigenen Vortrefflichkeit, und das so sehr, dass er darüber die unumschränkte Herrschaft Gottes über ihn vergisst, verkennt oder sogar leugnet. Kein Hang zur Sünde ist so zäh, so tief, so gefährlich wie der zum Hochmut.
Gewiss, dieser Fehler hat die verschiedensten Auswirkungen; aber die innerste Haltung des Hochmütigen ist doch die, zu leben, ohne für die Wohltaten zu danken, die er empfängt. Er hält die natürlichen und sogar die übernatürlichen Gaben für etwas ganz Selbstverständliches. Der Mensch, der von Stolz beherrscht ist, geht durchs Leben, ohne an die Rechte Gottes und die Beweise seiner Liebe zu denken; deshalb überlässt Gott, der sich voll Güte zu dem Demütigen neigt, den Hochmütigen der Selbstherrlichkeit, die er verlangt: «Er lässt die Reichen leer ausgehen» (Lk 1,53)
Beim Priester ist der Hochmut nicht in so krasser Form zu finden; doch er kann seine völlige Abhängigkeit vom Herrn vergessen, kann Freude daran finden, Autorität zu besitzen und Gutes zu tun, als ob dies ihm selbst zuzuschreiben sei. Jeder Mensch muss demütig sein, aber vom Diener Christi wird es auf das entschiedendste gefordert.
Doch glauben wir nur ja nicht, dass durch die Demut Initiative und Einsatz gelähmt würden. Im Gegenteil, sie ist eine Quelle geistiger Energie. Wenn die demütige Seele ihre Schwachheit oder ihre Unwürdigkeit bekennt, tut sie es nicht, um die Hände müßig in den Schoß zu legen, sondern um in Gott und in der Erfüllung seines Willens machtvollen Antrieb für ihre Energie zu finden. So verhielten sich die Heiligen. Betrachten wir den Völkerapostel; was ist das Geheimnis seines unermüdlichen Wirkens? Er selbst sagt es uns: «Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark» (2 Kor 12, 10). Und warum? «Ich vermag alles in dem, der mich stärkt» (Phil 4, 13). Echte Demut geht immer Hand in Hand mit Hochherzigkeit und Gottvertrauen.
2. Demut und geistlicher Fortschritt
Obwohl die Aspekte, die wir bisher betrachteten, von großer Wichtigkeit sind, reichen sie doch nicht hin, um uns die Bedeutung der Demut für das innere Leben voll erfassen zu lassen.
Die Sünde hat in uns eine Neigung zum Bösen erzeugt; Gott hingegen will jede Seele heilen, erheben, stützen und vervollkommnen. Welche Aufgabe kommt in dieser Situation der Demut zu ?
Sie erschließt die Seele dem Wirken der Gnade und macht sie bereit, den Herrn auf die von ihm selbst bestimmte und ihm wohlgefällige Weise zu verherrlichen, nämlich durch den Lobpreis seines göttlichen Erbarmens.
So kann man die Demut ergänzend definieren als «die Tugend, die die Seele bestimmt, praktisch und ständig vor Gott ihr Elend zu bekennen».
Worin besteht dieses Elend?
Wie wir alle wissen, bleibt keinem Geschöpf die schmerzliche Erfahrung erspart, dass es aus eigener Kraft völlig unfähig ist, sich zum Bereich des Übernatürlichen zu erheben und darin auszuharren. «Nicht durch eigene Kraft können wir etwas ausdenken; unsere Fähigkeit kommt von Gott» (2 Kor 3, 4), sagt Paulus. Diese Unfähigkeit erkennt der Mensch erst allmählich und nur durch die Wirkung der Gnade.
Schlummert in der Tiefe unserer Seele nicht der Hang zu niedrigem Genuss, die Neigung, im Hochmut und in der Sünde Befriedigung zu suchen?
Ferner sind in dieser Welt die Aufgaben unseres Standes und die Arbeit ernste Verpflichtungen; so edel die tapfere Erfüllung der täglichen Pflichten ist, sie fordert Anstrengung, und diese unaufhörlich erneuerte Anstrengung bedeutet für viele eine wahre Pein.
Denken wir überdies an die körperlichen Übel: Krankheiten, Alter, Tod. Dazu kommen seelische Leiden: Angst, Misserfolge, Enttäuschungen, Traurigkeit erdrücken uns schier. Und wie oft wird durch Gleichgültigkeit, Undank, Bosheit unsere Last noch erschwert. Job hatte recht, als er sprach: «Der Mensch, von der Frau geboren, lebt kurze Zeit und wird mit Leiden überschüttet» (Job 14, 1).
Um diese Übel zu überwinden und uns durch sie zu heiligen, genügen unsere Willenskraft und unsere natürlichen guten Anlagen nicht. Das Herz muss sich Gott zuwenden und im Bekenntnis seiner Ohnmacht Gnade erflehen. In dieser Hinwendung des Herzens, das seine Dürftigkeit eingesteht und sich dem Übernatürlichen erschließt, besteht die Grundhaltung der christlichen Demut. Sie macht den Menschen fähig, die Gabe Gottes zu empfangen, ohne Gefahr zu laufen, sie sich selbst zuzuschreiben. Sie stellt ihn an den ihm zukommenden Platz und bereitet ihn auf das Wirken Gottes vor.
Es gibt Seelen, die ihre Unwürdigkeit nicht erkennen und daher nicht die Hilfe des Herrn erflehen; so sind sie auch nicht aufnahmefähig für die Gnade.
In dieser demütigen Gesinnung ruft der hl. Paulus aus: «Ich will mich gern meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi in mich einzieht» (2 Kor 12, 9). Diese Worte sind allbekannt, doch man erfasst nicht immer ihren Sinn. Was will der Apostel damit sagen? «Ich bin kein vollkommenes Wesen wie die Engel; ich bin ein Mensch voll Schwachheiten; doch ich rühme mich ihrer, denn durch sie rühre ich das Herz Gottes, und je mehr ich mir meiner Schwachheit bewusst bin, desto mehr übergebe ich meine Seele der Kraft Christi, die in mir wohnt.»
Doch verwechseln wir unsere menschlichen Schwachheiten, deren demütiges Eingeständnis für den geistlichen Fortschritt so wichtig ist, nicht mit «Treulosigkeiten». Weit davon entfernt, das übernatürliche Leben günstig zu beeinflussen, sind sie ein Hindernis für das Wirken Gottes; wir können uns nicht auf sie berufen, wenn wir Gnade erlangen wollen. Hingegen sind die Reue und der feste Vorsatz, die auf unser Versagen folgen, sicher ein Bekenntnis unseres Elends, das der Herr annimmt.
Eine zweite Aufgabe, die die Demut zu erfüllen hat, ist unerlässliche Vorbedingung für die Harmonie des geistlichen Lebens: nur die Demut ermöglicht es dem Menschen, Gott in der Grenzenlosigkeit seines Erbarmens zu verherrlichen.
Diese göttliche Vollkommenheit ist identisch mit der unendlichen Liebe, denn sie wirkt aus reiner Güte, aus Gnade dahin, die Schäden der Sünde zu heilen und der menschlichen Armseligkeit zu Hilfe zu kommen.
Die Menschwerdung des Gottessohnes, der «in der Gestalt des sündigen Fleisches» uns ähnlich geworden ist (Röm 8, 3), sein erlösendes Sterben, unsere Annahme an Kindes Statt, die Verzeihung der Sünden, die uns so oft gewährt wird, sind erschütternde Offenbarungen der Tiefe dieser Liebe. Der hl. Paulus lehrt ausdrücklich, das ganze Werk Christi wolle die Größe und Unverdientheit der göttlichen Güte enthüllen: «Dann hat Gott, so reich an Erbarmen, seine große Liebe uns erwiesen und hat uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus zum Leben geführt ... So wollte er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns ... zeigen» (Eph 2, 4-5, 7). Und ferner: «Gott hat alle dem Ungehorsam überantwortet» Warum? «Um sich aller zu erbarmen» (Röm 11,32). Und im Himmel werden wir als «Gefäße der Barmherzigkeit» erscheinen (Röm 9,23), das heißt, wir sind bestimmt, im himmlischen Jerusalem ewig den Sieg der Gnade über unsere Schwachheit und über die Sünde zu verkünden.
Wenn wir die Aufgabe Jesu auf dieser Erde in wenigen Worten zusammenfassen wollen, wagen wir zu behaupten, ohne einen Irrtum zu befürchten: «Jesus ist die Botschaft von dem unendlichen Erbarmen Gottes mit dem menschlichen Elend» (Dom Marmion betont diesen Gedanken besonders in seinen geistlichen Briefen; siehe; Die Gottverbundenheit, SS. 170-198).
Wenn wir also verpflichtet sind, eine göttliche Vollkommenheit mehr als die andern zu preisen, dann ist es sicher die Barmherzigkeit. Alle Wege des Herrn in Hinsicht auf uns sind nichts als erbarmungsvolle Liebe. In der Erlösungsordnung, in die wir gestellt sind, hat Gott sich zu unserer Not herabgeneigt, um uns bis zur Teilnahme an seinem Leben zu erhöhen.
Kann die Haltung des Menschen angesichts dieser wunderbaren Erweise der göttlichen Liebe eine andere sein als die tiefster Demut? Durch das Eingeständnis seines vielfältigen Elends gibt der Mensch zu, dass er keinerlei Rechtsanspruch auf die Güte Gottes hat; Gnade erhoffen kann er nur von dem steten Bekenntnis seiner Armseligkeit, verbunden mit dem Wunsch, das ewige Erbarmen zu verherrlichen, das ihm in Jesus Christus gegeben ist: «Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?» (Röm 8, 32). So wunderbar ist seine Vorherbestimmung, die «die Herrlichkeit seiner Gnade offenbart, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn begnadet hat» (vgl. Eph. 1,6).
Nichts verherrlicht Gott so sehr, als wenn wir in der vollen Erkenntnis unseres Elends unerschütterlich auf seine Liebe hoffen.
3. Jesu Demut und Gehorsam
In Jesus war die Demut eine Grundhaltung. Seine Seele, die vom Licht der Glorie erleuchtet war, sah sich als Geschöpf und zugleich auf wunderbare Weise in die Personeinheit des göttlichen Wortes hineingenommen. Diese Erkenntnis veranlasste Christus, sich völlig zu erniedrigen, seine Abhängigkeit hinsichtlich seines Wesens und seiner Aufgabe als Erlöser vorbehaltlos anzunehmen. Diese Demutshaltung vor dem Antlitz des Vaters wurde für Jesus zur Quelle aller Tugenden: Sanftmut im Umgang mit den Mitmenschen, Geduld und Verzeihen, wenn er beleidigt wurde, und vor allem kindlicher Gehorsam gegen den Willen Gottes. Diese Eigenschaften zeigen die Grundeinstellung der Abhängigkeit, in der die Seele des Erlösers stets verharrte.
Jede Seite des Evangeliums enthüllt uns die Milde des Herrn, und er will, dass wir uns ein Beispiel daran nehmen: «Lernet von mir, denn ich bin sanft und demütig von Herzen» (Mt 11,29).
Warum ist er in die Welt gekommen? «Nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen», um sich für jeden einzusetzen bis zur Hingabe seines Lebens als Lösegeld (vgl. Mk. 10,45). Verrät diese Hinopferung seiner selbst nicht tiefste Demut? Und Christus will, dass alle, vor allem seine Priester, von gleicher Gesinnung beseelt seien: «Wer unter euch der erste sein will, der sei der Diener aller» (Mk 10, 44).
Beim Letzten Abendmahl wäscht der Meister die Füße seiner Jünger. Damit vollzog er einen Akt aufrichtiger Demut und wollte uns ohne Zweifel ein Beispiel geben: «Wenn ich euch die Füße gewaschen habe, ich, der Herr und Meister, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben» (Joh 13, 14-15).
Diese Handlungsweise stimmt völlig mit der Predigt Jesu überein. Die Seligpreisungen, in denen er seine Lehre zusammenfasst, stehen in schroffem Gegensatz zu den Neigungen des menschlichen Hochmutes: Selig die Armen ... die Sanftmütigen... die Friedfertigen... die Barmherzigen ... die Verfolgten ... (Mt 5, 3-12).
Ein anderes Ereignis zeigt uns ebenfalls die Demut des göttlichen Meisters. Er kam mit seinen Aposteln auf dem Weg nach Jerusalem durch Samaria. Die Bewohner eines Dorfes weigerten sich, die Pilger zu beherbergen. Jakobus und Johannes ergrimmten und gingen in ihrem Wunsch nach Vergeltung so weit, dass sie vernichtendes Feuer vom Himmel auf die Samariter herabwünschen wollten. Doch der Erlöser denkt anders. Seine Antwort lautet: «Ihr wisst nicht, welchen Geistes ihr seid; der Menschensohn ist nicht gekommen, um die Menschen zu verderben, sondern um sie zu retten» (Lk 9, 55-56).
Betrachten wir ferner die Sanftmut Jesu in seiner Passion: «Er wird mit Schmach gesättigt werden» (Klgl 3, 30). Was bedeuten diese Worte? Christus wollte seinem Vater diese Demütigungen als Sühne für unsern Hochmut aufopfern. Er ist das göttliche Wort, aller Anbetung würdig, und steht als Angeklagter vor seinen Richtern. Und was für Richter! Kaiphas, Pilatus, Herodes. Herodes, ein verweichlichter Lüstling, hat nur «Verachtung» für ihn: «zeigten ihm offen ihre Verachtung» (Lk 23, 11). Dieser da will als Prophet geehrt werden? Nun gut, zieht ihm ein weißes Kleid an und verspottet ihn. Und wie verhielt sich Christus? Er hat alles angenommen. Wer von uns hätte sich eine solche Schmach vorstellen können? Die ewige Weisheit als Narr behandelt! Und das alles war in den Plänen des Ewigen vorausgesehen und festgelegt worden. Sodann wurde der Herr mit Barrabas verglichen, den römischen Soldaten ausgeliefert: verrohten Gesellen, denen es Spaß machte, mit einem Todgeweihten ihr Spiel zu treiben, ihm eine Dornenkrone aufs Haupt zu setzen und ihn zu verhöhnen: «indem sie riefen: Heil dir, König der Juden!» (Mt 27, 29). Sie machten ihn lächerlich, als ob er ein Betrüger wäre, der Verachtung verdiente. Wenn je ein Mensch gedemütigt wurde, dann war er es! Er wollte zunichte werden, sich demütigen bis zum Tod am Kreuz.
Muss nicht der Priester, der am Altar das Opfer von Kalvaria fortsetzt, die Demut Jesu nachahmen? Nichts stößt das christliche Empfinden so sehr ab wie ein hochmütiger Priester, der die Demütigungen des Erlösers vergisst, obwohl er im heiligen Opfer ihr Andenken begeht. Welcher Kontrast besteht doch zwischen einem solch anmaßenden, dünkelhaften, ungeduldigen, hochfahrenden Menschen und der Güte und Milde Christi !
Wachen wir darum, dass sich nicht Hochmut in unsere Seele einschleiche, auch nicht in der Form eitler Selbstgefälligkeit.
Die äußere Demut ist dem Priester sogar wegen seiner Autorität notwendig. Er steht im Licht der Öffentlichkeit; «man stellt es (ihn) auf den Leuchter» (Mt 5, 15); seine Worte, seine Handlungen, sein Verhalten werden beobachtet. Gibt er zu Tadel Anlass, sind seine Handlungen von Eigenliebe bestimmt, dann enttäuscht er die Gläubigen, die im Priester zwar die Würde sehen wollen, die dem Diener Christi zukommt, aber auch die tiefe Demut des göttlichen Meisters.
Die Haltung der Demut, in der Jesus unter der ständigen Einwirkung der Gottheit verharrte, veranlasste ihn zu einer vorbehaltlosen Annahme des Willens seines Vaters, zu vollkommenem Gehorsam. Das lehrt der hl. Paulus. «Er erniedrigte sich und ward gehorsam» (Phil 2, 8). Jesus versichert oft, dass seine Unterwerfung unter den göttlichen Willen all sein Handeln erklärt. «Ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat ... Meine Speise ist es, den Willen (des Vaters) zu tun» (Joh 6, 38; 4,34).
Von der Menschwerdung an liefert er sich allen Ratschlüssen des Vaters aus, nimmt sie voll und ganz an in grenzenloser Hingabe. «Siehe, ich komme ... deinen Willen zu tun» (Hebr 10, 7). Mit einem einzigen Blick überschaute er die Opfer und Leiden, die sein Leben ausfüllen sollten. Und er nahm alle an und «barg sie im innersten Herzen» (Ps 39, 9). Der Gedanke, alles zu erfüllen, «was von ihm geschrieben stand» (Mk 14,49), hat wohl den Herrn während seines ganzen Lebens begleitet.
In dieser Hinsicht duldete Jesus bei seinen Aposteln, denen er doch sonst mit so großer Milde begegnete, nicht den leisesten Zweifel. Als er ihnen einst sein Leiden und seinen bevorstehenden Tod ankündigte, rief Petrus in seiner impulsiven Art: «Gott bewahre, Herr! Das bleibe fern von dir!» Und was antwortet Jesus? «Weg von mir, Satan! Du bist mir zum Ärgernis. Du hältst es nicht mit Gott, sondern mit den Menschen» (Mt 16, 22-23). Das war ein strenger Verweis, der den Jünger betrübte. Doch Christus war nach dem Willen des Vaters in die Welt gekommen und konnte die Seinen nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass alles Geschehen in seinem Leben die Verwirklichung eines göttlichen Planes war. Auch in der Nacht, da seine Feinde ihn ergriffen, sprach er zu Petrus, der ihn verteidigen wollte: «Soll ich nicht den Kelch trinken, den der Vater mir gereicht hat?» (Joh 18, 11). Dieser Kelch war schon längst vorbereitet worden. Der Vater wusste, dass er auf die Unterwerfung seines Sohnes zählen konnte, dass Christus ihn bis zur Neige leeren werde: kein Leiden, keine Bedrängnis, keine Demütigung hat Jesus getroffen - das werden wir im Himmel sehen -, die nicht in den Plänen Gottes gelegen war. Und Jesus gehorchte in allem.
Ist es nicht beachtenswert, dass der hl. Paulus, wenn er von dem Erlösungsopfer spricht, besonders den Gehorsam hervorhebt? «Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht» (Röm 5, 19). Diese ergreifende Gegenüberstellung war von der göttlichen Weisheit gewollt. Obwohl Adam von Anfang an zum übernatürlichen Sein erhoben worden war, vergaß er die erste Kindespflicht, die, dem Vater zu gehorchen. Um diese Beleidigung zu sühnen, unterwarf sich Jesus voll und ganz dem Willen des Vaters: «Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen» (Lk 22, 42). «Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater mir aufgetragen hat» (Joh 14,31). Und dieser Gehorsam hat nicht nur die Übertretung Adams wiedergutgemacht, sondern durch ihn wurde dort, «wo die Sünde zugenommen hatte, die Gnade überschwänglich» (Röm 5, 20).
So sieht der Apostel Jesus, der am Kreuz die Erlösung vollbrachte, wie vernichtet im Gehorsam, da er sich nicht nur irgendwie unterwarf, sondern «gehorsam ward bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz» (Phil 2, 8). Der schrecklichste Auftrag, den Christus vom Vater empfangen konnte, war der, am Kreuz zu sterben. Dies aber ist nach St. Paulus die äußerste Gehorsamstat: einzuwilligen, selbst den Fluch auf sich zu nehmen, um uns vom Fluch loszukaufen: «denn es steht in der Schrift: Verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt» (Gal 3, 13).
Sterbend schaute Jesus das Antlitz des Vaters; das war das Geheimnis seiner Kraft. Auch während des Todeskampfes blieb er ihm in höchster Liebe verbunden, gehorsam bis zum «Es ist vollbracht» (Joh 19,30).
Jedes Mal, wenn wir das heilige Opfer feiern, erneuern wir vor Gott sakramental den Gehorsamstod seines Sohnes und stellen uns so das höchste Vorbild der Demut und Liebe vor Augen, Jesus: «Jedes Mal ... verkündet ihr den Tod des Herrn» (1 Kor 11, 26). Beim Offertorium opfern wir mit der Hostie unser ganzes Dasein auf; in Vereinigung mit der Hingabe Christi wird auch unser Leben ein Opfer des Gehorsams und der Liebe, das Gott wohlgefällt : «Opfer …, das Gott gefällt» (Röm 12,1).
4. Der priesterliche Gehorsam
Wie sich die Demut Jesu während seines ganzen Lebens im Gehorsam kundtat, so soll es auch bei uns, seinen Priestern, sein. In dieser Hinsicht ist er ganz besonders unser Vorbild.
Gehorchen heißt im allgemeinen, sein Handeln einer höheren Autorität unterstellen.
Gehorsam kann auf zwei verschiedene Weisen geübt werden: rein menschlich oder übernatürlich.
Der Arbeiter gehorcht dem Werkmeister; das ist im Interesse des Arbeitsganges notwendig; andernfalls gäbe es in der Werkstatt oder in der Fabrik keine Ordnung. Wenn er seine Arbeit leistet, ist man mit ihm zufrieden, und er hat Anspruch auf seinen Lohn, auch wenn er sich innerlich gegen seinen Arbeitgeber auflehnt.
Der Soldat gehorcht, damit er nicht eingekerkert oder erschossen wird. Hat er edlere Gesinnung, dann handelt er aus Liebe zu seinem Beruf und seinem Vaterland. Doch er behält sich das Recht vor, seine Vorgesetzten zu kritisieren und zu tadeln, sie unfähig oder ungerecht zu finden. Diese Disziplin ist sicher nützlich und lobenswert, doch es ist eine rein menschliche Form des Gehorsams.
Unser priesterlicher Gehorsam soll hingegen wesentlich übernatürlich sein, sich auf den Glauben und die Liebe stützen. Er soll aus innerster Seele kommen, eifrig, freudig geleistet werden aus Liebe zu Christus und den Seelen.
Durch den übernatürlichen Gehorsam unterwirft man sich dem Willen Gottes und den Befehlen derer, die seine Stellvertreter sind; durch ihn huldigt man der erhabenen Majestät Gottes.
Nach der Priesterweihe verspricht der Neugeweihte dem Bischof Gehorsam. Dieses feierliche Versprechen legt er in der bedeutungsvollsten Stunde seines Lebens ab. Er verpflichtet sich dazu in der Gegenwart Gottes und vor dem Altar, auf dem er gleich darauf gemeinsam mit dem Konsekrator zum ersten Mal das heilige Opfer darbringen wird.
Durch diese Verpflichtung bindet er sich gewiss nicht so wie der Religiose, der dem Oberen nach einer approbierten Regel ewigen Gehorsam gelobt. Die Kirche betrachtet diese Handlung als ein freigewähltes Mittel der Heiligung; durch vollen Verzicht weiht der Ordenschrist seine Person und alle seine Handlungen für immer Gott.
Das Gehorsamsversprechen des Weltpriesters hat einen andern Charakter. Die Kirche verlangt es von ihm vor allem, um das «Allgemeinwohl» («bonum commune») einer Diözese zu sichern.
Denn wenn der Bischof als rechtmäßiger Seelenhirte seine Mitarbeiter mit einer Aufgabe betraut, muss er auf volle Unterwerfung unter seine Befehle und Richtlinien zählen können.
Dieses Opfer, das der Weltpriester auf sich nahm, ist außerordentlich verdienstlich und gottgefällig, denn nichts ist dem Menschen so eigen wie das Verlangen nach Freiheit, nach Selbstbestimmung, danach, so zu handeln, wie es ihm gut scheint. Gott selbst achtet bei seinem Wirken in den Seelen dieses Recht; auch die größten Gnaden lassen die menschliche Freiheit unversehrt.
Der Priester hat gleichsam einen Vertrag mit dem himmlischen Vater abgeschlossen: «Mein Gott, aus Liebe zu dir und im Interesse der Kirche lege ich meine Fähigkeiten und mein Wirken in die Hände des Bischofs. Durch seinen Mund wirst du mir sagen, was ich tun soll (Apg 9, 6). Die Ämter und Aufgaben, die mein Bischof mir anvertrauen wird, will ich als von Dir kommend betrachten. Ich bin sicher, dass Du dann mein Wirken und mein ganzes priesterliches Leben segnen wirst.»
Das ist übernatürliche Auffassung. Ein Priester, der sich so im Geist des Glaubens hingibt, wird steten Frieden haben, auch in den größten Schwierigkeiten, denn er ist dort, wo Gott ihn haben will. Und Gott ist mit ihm. «Und wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns?» (Röm 8, 31). Als der Herr Moses zu Pharao sandte, um das hebräische Volk von seinem Joch zu befreien, erschrak Moses über diesen Auftrag. Der Herr aber sprach zu ihm: «Ich bin mit dir» (Ex 3, 12). Und wir wissen, durch welche Wunder Gott den Gehorsam seines Gesandten belohnte.
Der Ordenschrist, der durch persönliche Berechnung seine Zukunft selbst in die Hände nehmen und seinen Obern seine Ansichten aufdrängen will, wird nicht zur Heiligkeit gelangen. Das gleiche gilt in gewissem Sinn von dem Priester, der die Bedeutung seines Gehorsamsversprechens verkennt.
Ich bestreite durchaus nicht, dass der Priester in bestimmten Fällen das Recht hat, in aller Ehrfurcht und zur gegebenen Zeit seinen Standpunkt darzulegen; doch dies darf niemals einer Gehorsamsverweigerung gleichkommen. Was aber ist zu tun, wenn der uns unangenehme Auftrag aufrechterhalten wird? Wir müssen ihn in übernatürlicher Gesinnung annehmen. «Der Untergebene sei überzeugt, dass die Sache ihm zum Besten gereicht, und er gehorche aus Liebe, im Vertrauen auf die Hilfe Gottes.» Diese Richtlinie, die der hl. Benedikt seinen Söhnen gibt (Regel, 68. Kap.), ist sicher für alle wertvoll.
Wenn Gott uns erschiene und sagte: «Es ist mein Wille, dass ihr dies oder jenes tut», dann wäre der Gehorsam leicht. Oder wenn Gott uns Engel oder andere vollkommene Wesen als Vorgesetzte gegeben hätte, ginge da nicht alles ganz prächtig? Sicher ist das nicht. Und Gott hat einen andern Weg gewählt: «Du hast Menschen über uns gesetzt» (Ps 65, 12). Menschen, Menschen mit begrenzter Einsicht, die selbst Fehler haben, müssen wir gehorchen. So hat es der Herr in seiner unendlichen Weisheit bestimmt. Christus hat durch Unterwerfung in kindlicher Liebe die Welt erlöst; wenn wir Priester an der Rettung der Seelen mitarbeiten wollen, müssen wir uns in unserer Arbeit mit diesem Gehorsam vereinigen. Deshalb kann man von einer Institution - sei es eine Diözese oder eine religiöse Gemeinschaft - sagen, ihre Kraft beruhe auf dem Gehorsam ihrer Glieder.
In dem Wort des Propheten Isaias: «Der Herr ... machte mich zu einem spitzen Pfeil; er barg mich in seinem Köcher» (49,2), darf man ein Bild des gehorsamen Priesters sehen, der nach gründlicher fachlicher und aszetischer Schulung dort eingesetzt werden kann, wo die Ehre Gottes und die Verteidigung der Kirche es fordern. Der Pfeil gehorcht der Hand, die ihn abschießt; durch diese Fügsamkeit erlangt er Kraft und Wirksamkeit; aus sich vermag er nichts, wäre er auch noch so gut gearbeitet. Die Priester gleichen Pfeilen in einer mächtigen Hand: «Wie Pfeile in der Hand des Kriegers» (Ps 126, 4). Wenn sie bei der Ausübung ihres Amtes aus übernatürlichen Motiven gehorchen, dann sind sie in der Kraft Gottes Werkzeuge der Gnade und des Sieges.
Der große Feind des Gehorsams ist das Murren, die Äußerung der inneren Unzufriedenheit. Das Murren ist die Entschädigung, die sich unsere ohnmächtige Eigenliebe der Autorität gegenüber leistet. Es ist eine oft ganz erbärmliche Kompensation. Ich spreche nicht von den Klagen, durch die sich unsere arme Natur Luft macht, wenn sie Niedergedrücktheit und Leiden zu ertragen hat. Auch Maria klagte, als sie zu Jesus sprach: «Mein Kind, warum hast du uns das getan?» (Lk 2, 48). Sie hat keinen Vorwurf erhoben, sondern einfach ihrem Schmerz Ausdruck gegeben. Und am Kreuz stieß der Erlöser den Ruf aus: «Mein Gott ... , warum hast du mich verlassen ?» (Mt 27, 46). Jesus hat nicht gemurrt; nur die Grenzenlosigkeit seines Leidens wollte er uns enthüllen.
Murren ist immer von Kritiksucht begleitet, von Widerspruchsgeist; und darin besteht seine Bosheit. Der Priester, der sich zum Murren hinreißen lässt, betrachtet seinen Vorgesetzten nicht als mit der Autorität Gottes ausgestattet. Wäre der Bischof nicht der Stellvertreter des Herrn, bestünde für den Priester kein Grund, ihm zu gehorchen. Als Mensch hat er keinerlei Recht, ihm zu befehlen; ein Mensch gilt so viel wie der andere. Doch seine Macht hat ihren Ursprung in seinem kanonischen Amt und in seiner Weihe. Als Gesandter Gottes besitzt er einen Teil der göttlichen Autorität. Der wahrhaft gehorsame Mensch unterwirft sich Gott allein, und da diese Unterwerfung vom Geschöpf absieht, erweist er dadurch dem Höchsten eine Huldigung der Liebe. Das vergisst der Kritiksüchtige.
In schweren Stunden - sie werden keinem Menschen erspart bleiben -, wenn uns der Gehorsam zur Last wird und wir mehr Freiheit und Unabhängigkeit haben möchten, richten wir unsere Blicke auf den Gekreuzigten. Er ist unser Vorbild. Wenn wir ihm ganz verähnlicht werden wollen, müssen wir wie er Opfergabe sein. Ich weiß gut, was ein solches Opferleben kostet; es kann sogar sehr hart werden. Doch wurde es wohl Jesus leicht, seinen Feinden ausgeliefert, von den Pharisäern beschimpft und ans Kreuz genagelt zu werden? Das alles erfüllte ihn mit Entsetzen. Und er nahm es aus Liebe dennoch auf sich, und durch seine Leiden hat er nach dem Wort des hl. Paulus «Gehorsam gelernt»: «hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt» (Hebr 5, 8).
Das - nach dem Geheimnis der Trinität - wichtigste Dogma, aus dem der Priester auf Erden leben muss, ist das Geheimnis eines menschgewordenen Gottes, der die Menschheit durch seinen Gehorsam rettet und zum Vater führt.
Bei jeder Messe wollen wir kurz unser Tagewerk überblicken und die Gesamtheit unserer Pflichten bejahen. Sprechen wir zum Herrn: «Du hast mich geliebt, o Jesus, und dich für mich hingegeben» (Gal 2, 20); «auch ich gebe alles und mich selbst für Dich hin» (2 Kor 12, 15).
Das ist für den Priester die beste, am meisten seiner Berufung und seinem Amt entsprechende Art, seine Seele dem heiligenden Wirken der Gnade geöffnet zu halten.
VIII. DIE TUGEND DER GOTTESVEREHRUNG
Jegliche Tugendübung in der Kirche hat ihren Ursprung in der Gnade Christi. Er ist das Vorbild und die lebendige Quelle aller Vollkommenheit; wir verdanken sie seinen Verdiensten. Die Heiligkeit der Glieder ist der Gnadenfülle des Hauptes zu verdanken: «Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade» (Joh 1, 16). Jede Tugend Jesu: seine Liebe zum Vater, seine Hingabe an die Menschen, sein Gehorsam, seine Keuschheit, seine Geduld leben in den verschiedenen allgemeinen und besonderen Berufungen fort, die sich in der Kirche entfalten. Sie sind im Herzen der Jünger verewigt, die den göttlichen Meister nachahmen.
Diese bewundernswerte Mannigfaltigkeit der Gnade bildet die Schönheit des mystischen Leibes. Die Braut des Erlösers ist «geschmückt wie eine Königin», «Königstöchter gehen dir entgegen, die Braut steht dir zur Rechten im Schmuck von Ofirgold» (Ps 45, 10). Die «golddurchwirkten Kleider» der Braut symbolisiert die heiligmachende Gnade, die über die ganze Kirche ausgegossen ist; die Vielfalt des Schmuckes versinnbildet die verschiedenen Tugenden, die ihren Ursprung in Jesus haben und ihre Glieder zieren. Die Heiligkeit Christi lebt so in seinem mystischen Leib stets fort.
Betrachten wir eine der Tugenden, von der das ganze Leben Jesu, jede seiner Handlungen bestimmt war: die Ehrfurcht vor dem Vater.
In jedem Diener Christi soll diese Seelenhaltung fortleben.
Durch seine Weihe wurde er wie Jesus selbst «dem geweiht, was des Vaters ist» (Lk 2, 49), den Interessen des Gottesreiches unter den Menschen. Diese religiöse Einstellung soll jede seiner Regungen kennzeichnen, sein Leben heiligen und es zu einem wahrhaft priesterlichen gestalten.
Bei jedem Christen - und noch stärker beim Priester muss die Übung der Gottesverehrung übernatürlich sein. Wir verkennen nicht den moralischen Charakter dieser Tugend; wir wissen, dass sie in erster Linie auf der unverbildeten Vernunft und dem Naturrecht beruht; dennoch vermag der Mensch nur durch das Licht des Glaubens die Erhabenheit Gottes, die Größe seiner Wohltaten und die Verpflichtung, ihn zu verherrlichen, voll zu erfassen. Die Gottesverehrung hat im Glauben ihre festeste Stütze.
Ferner muss beim Christen die Gottesverehrung von der Liebe beherrscht sein. Sie ist die Königin der Tugenden; von ihr geht aller Ansporn aus. In der Seele Jesu hatte die Liebe stets die Vorherrschaft. Er selbst tat es uns in dem Augenblick kund, da er den höchsten Akt der Gottesverehrung vollbrachte, das Kreuzesopfer: «die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat» (Joh 14,31).
So sollte es auch bei uns sein; wie die Gnade auf die Natur aufgepropft wird, sie heiligt und gleichsam besiegt, so ist die Gottesverehrung im Reiche der Liebe beheimatet. Und ohne ihrer Eigenart Abbruch zu tun, erhebt und erhöht sie alle ihre Akte, verleiht ihnen übernatürlichen Charakter. Im Christentum ist es wesentlich, dass die theologischen Tugenden bestimmend sind.
1. Die Tugend der Gottesverehrung in der christlichen Heilsökonomie
Als Moses Jahwe nach seinem Namen fragte, antwortete der Herr: «Ich bin, der ich bin» (Ex 3,14). Es macht das Wesen Gottes aus, das, was er ist, durch sich selbst zu sein. Wir hingegen sind nur in ihm: «Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir» (Apg 17,27). Als Geschöpfe sind wir völlig abhängig von ihm: «Deine Hände haben mich gemacht und geformt» (Ps 119, 73). Er ist unser Herr und Meister. Die Tugend der Gottesverehrung drängt uns, das Knie vor seiner unendlichen Majestät zu beugen und zu sprechen: «Du bist alles, o mein Gott, und ich bin nichts.»
Nicht eine flüchtige Gefühlsregung soll die Frömmigkeit in uns sein, sondern eine Haltung, die in der Tiefe unserer Seele verwurzelt ist: eine Tugend, die den «Menschen geneigt macht, durch Kulthandlungen die Rechte Gottes als Erstursache und Endziel aller Dinge anzuerkennen».
Der Begriff der Gottesverehrung wird von der unbedingten Hinordnung auf Gott und der Treue gegen ihn beherrscht. Im Wissen um die absolute Souveränität des Schöpfers bejahen wir unsere Abhängigkeit und bekunden sie durch unsere Unterwerfung.
Die Gottesverehrung gehört nicht zu den theologischen Tugenden, obwohl sie die Bestimmung hat, die Verbindung zwischen dem Menschen und Gott herzustellen; ihr Gegenstand ist nicht Gott selbst. Sie ist eine moralische Tugend; sie veranlasst uns, Gott zu huldigen, nicht ausdrücklich aus Liebe oder aus Wohlgefallen an seiner Vollkommenheit, sondern weil er ein Recht auf Unterwerfung hat. Der Mensch erfüllt durch sie eine Pflicht, die ihm sogar vom Naturgesetz auferlegt ist. Die Ehrenhaftigkeit, die uns dazu drängt, Gott gegenüber die Forderungen der Gerechtigkeit zu erfüllen, gehört zu den berechtigsten Motiven unseres HandeIns.
Die Kirche verkündet immer diese Wahrheit. In unserer Liturgie, die sehr nüchtern ist, muss jedes Wort durchdacht werden, wenn man seinen Lehrgehalt ausschöpfen will. Welches Motiv betont die Kirche zu Beginn der Präfation, wenn sie uns zur Danksagung gegen Gott anleitet? Angemessenheit, Gerechtigkeit, Billigkeit: «Es ist in Wahrheit würdig und recht … dass wir Dir immer u�nd überall danken...» Welches Fest auch gefeiert werden mag, das Grundrnotiv, das uns zum Gotteslob veranlassen soll, bleibt immer das gleiche.
Beachten wir auch den Ausdruck, mit dem im Ordo missae unsere Haltung dem Herrn gegenüber bezeichnet wird. Sie wird «ein Dienst» genannt: «Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener …» und ferner: «Es möge Dir, heilige Dreifaltigkeit, der Dienst Deiner Diener gefallen.» Wir sind die Diener Gottes. Man wird fragen: «Sind wir nicht auch seine Kinder?» Gewiss, doch trotz unserer Annahme an Kindes Statt bleiben wir, was wir unserm Wesen nach sind: Diener.
Jeder Mensch, vor allem jedoch der Priester, muss die innere Bereitschaft lebendig halten, sich stets großmütig der Erfüllung der Aufgaben zu widmen, durch die Gott geehrt wird. Diese Willensbereitschaft, die Pflichten der Gottesverehrung zu erfüllen, nennt der hl. Thomas «devotio»: «Voluntas quaedam prompte tradendi se ad ea quae pertinent ad Dei famulatum ... ad opera divini cultus.» (S. th. lI-lI, q. 82, a. 1. ).
In den Christen als Adoptivkindern muss die Gottesliebe diese «devotio» hervorrufen, dieses Verlangen, sich hinzugeben, sich mit allen Kräften dem Dienst des Herrn zu widmen.
Durch welche Akte wird die Tugend der Gottesverehrung betätigt?
Der wesentlichste ist die Anbetung; der Mensch demütigt sich und erkennt dadurch sein Nichts vor der absoluten Souveränität Gottes an. Anbeten heißt auch den Blick auf Gott richten und sich vor ihm in den Staub niederwerfen.
Die Darbringung des Opfers ist im eigentlichen Sinn der sichtbare und gemeinschaftliche Akt der Anbetung. Tatsächlich wird durch die Tötung oder Zerstörung eines sinnlich wahrnehmbaren Dinges, die zur Verherrlichung Gottes vollzogen wird, die Oberherrschaft des Herrn über das Wesen, über Leben und Tod bezeugt. Die Bedeutung des Aktes und die Absicht, in der er vollzogen wird, macht ihn zu einem wesentlich latreutischen, d. h. zu einem Akt der Anbetung, die Gott allein erwiesen wird.
Die äußere Form des Opfers hat die Bedeutung eines Symbols; sie ist nach dem hl. Augustinus ein sichtbares Zeichen der inneren Gesinnung des Menschen, der Gott huldigt: «Sacrificium visibile, invisibilis sacrificii sacramentum» (De civitate Dei X, 5. P. L. 41, Sp. 282). Die geistige Haltung ist das Wichtigste bei der Darbringung des Opfers; in ihr liegt der eigentliche Akt der Gottesverehrung. Bei der Ablegung von Gelübden, beim Leisten eines Schwures, bei Lobpreis und mündlichem Gebet sollen die Worte und Gesten Ausdruck der religiösen Gesinnung und Absicht sein. Wo die Übereinstimmung zwischen Handlung und Gesinnung fehlt, sind die äußern Akte bloße Fiktionen ohne Tugendwert.
Um besser die ausschlaggebende Bedeutung zu erkennen, die der Tugend der Gottesverehrung im geistlichen Leben zukommt, müssen wir uns klarmachen, dass es ihre Aufgabe ist, alle guten Werke des Menschen - gleichgültig, in welcher Tugend sie ihren Ursprung haben - auf die Verherrlichung Gottes auszurichten. Deshalb schreibt der hl. Jakobus: «Reine, makellose Frömmigkeit vor Gott dem Vater ist es, sich der Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis anzunehmen und sich rein zu bewahren von der Welt» (Jak 1, 27). So wird auch die treu bewahrte Keuschheit, die Erfüllung der Standespflichten und jede andere Handlung, gleichviel, welche Tugend in ihr zur Auswirkung kommt, zu einer Huldigung an Gott, wenn sie ihm in der rechten Gesinnung aufgeopfert wird.
Im Alten Bund stützte sich die Tugend der Gottesverehrung bekanntlich vor allem auf die Furcht. Nur einmal im Jahr trat der Hohepriester nach vielfachen Reinigungszeremonien ins Allerheiligste ein und sprach zitternd den Namen Gottes aus. Das war die Frömmigkeit der Knechte.
Uns jedoch verlieh Jesus, durch die Gnade das zu sein, was er von Natur aus ist: Kind. Unser Schöpfer hat sich gewürdigt, seine Diener als Kinder anzunehmen. Deshalb wird die Tugend der Gottesverehrung, ohne die tiefe Ehrfurcht zu vergessen, stets mit kindlicher Liebe Hand in Hand gehen.
Der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund besteht somit darin, dass in dem Bund, den Jesus mit seinem Blut besiegelt hat, die Liebe vorherrscht. So bewahrt zwar die Tugend der Gottesverehrung ihre Eigenart, wird aber beim Christen durch die übernatürliche Liebe überhöht und erlangt dadurch größeren Wert.
Wie beglückend ist doch für uns das Wissen, dass Gott, unser Herr, wirklich unser Vater ist. Als solchem gebührt ihm nicht nur unsere größte Ehrfurcht, sondern auch unsere innigste Liebe.
2. Die Frömmigkeit Jesu
Obwohl der Logos in der Menschwerdung Gott blieb, begann er in diesem Augenblick den Vater auf eine neue Weise zu verherrlichen, auf geschöpfliche Weise. Seiner göttlichen Natur nach, «war Er Gott gleich» (Phil 2, 6), ist er ganz auf den Vater ausgerichtet; in seiner Menschheit, «er wurde wie ein Sklave» (Phil 2, 7), war seine Seele gleichsam mitgerissen und hineingenommen in den Lobpreis der zweiten göttlichen Person. Das Leben des Göttlichen Wortes gehört ganz dem Vater; so ist auch das menschliche Leben Jesu unaufhörlich auf den Vater ausgerichtet: «Ich lebe durch den Vater» (Joh 6, 57). Tatsächlich erweist der Erlöser durch alle Erniedrigungen, die er auf sich nahm, dem Vater Verherrlichung und übt in hervorragendster Weise die Tugend der Gottesverehrung.
Gewiss, als Logos kann Christus sich nicht vor der Majestät des Vaters demütigen; er verherrlicht sie dadurch, dass er ihr gleicht: «Der Vater und ich sind eins» (Joh 10,30). Doch als Mensch spricht er: «Der Vater ist größer als ich» (Joh 14,28). Um den Vater im Namen der sündigen Menschheit zu verherrlichen, kann er sich nicht damit begnügen, ihn anzubeten, sondern muss sühnen, leiden, als Schlachtopfer hingeopfert werden.
Die Frömmigkeit des Gottessohnes hat sicher nicht ihresgleichen.
Ihr erster Vorzug besteht in ihrem priesterlichen Charakter. Bei jeder seiner Handlungen war sich der Erlöser bewusst, dass er «der allgemeine Priester zur Verherrlichung des Vaters» war, wie Tertullian es ausdrückt (Tertullian, Adversus Marcionem IV, 9. P. L. 2, Sp. 406). Wenn er sagte: «Ich verherrliche meinen Vater» (Joh 8, 49), so wollte er dies zweifellos tun als Priester, der beauftragt war, die Welt durch das Kreuzesopfer zu retten. Die Darbringung dieses heiligen Opfers war der höchste Kultakt.
Seien wir überzeugt, die Erlösung war in den Augen Jesu nicht ausschließlich sein Werk. Sie erschien ihm als zeitliche Verwirklichung eines ewigen Planes der Barmherzigkeit, der seinen Ursprung im Himmel hatte. Christus betrachtete sich als Hohenpriester des Neuen Bundes. Er bejahte den Willen des Vaters und führte den im voraus gefassten göttlichen Ratschluss aus. Das ist sicher der Sinn des Herrenwortes : «Ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat» (Joh 6, 38). Und ferner: «Soll ich den Kelch nicht trinken, den der Vater mir gereicht hat?» (Joh 18, 11).
Weil Christus den Willen des Vaters erfüllte, war sein ganzes Leben ein unvergleichlicher Akt der Gottesverehrung. Er selbst bezeugt es im hohenpriesterlichen Gebet nach dem Letzten Abendmahl: «Vater . .. ich habe dich auf Erden verherrlicht; ich habe das Werk vollbracht, das zu vollbringen du mir aufgetragen hast» (Joh 17,4).
Ein anderer Wesenszug der Frömmigkeit Jesu ist, dass sie aus der unmittelbaren Schau des Vaters hervorging, die ihm allein eigen war.
Er erfasste die Größe der göttlichen Heiligkeit und erkannte, wie sehr der Mensch verpflichtet ist, Gott Ehre und Verherrlichung zu erweisen. «Heiliger Vater», so sprach er, «die Welt hat Dich nicht erkannt; ich aber habe Dich erkannt» (Joh 17,25). Und ferner: «Ich kenne den Vater, denn ich stamme von ihm» (Joh 7, 29).
Diese innere Betrachtung weckte in der Seele unseres göttlichen Meisters das stete Verlangen, sich vor der Majestät des Unendlichen zu demütigen. Die Tätigkeit seines Geistes bestand vor allem in einer unaussprechlichen Anbetung. «Der mich gesandt hat, ist mit mir» (Joh 8, 29). Und die ständige Verbindung mit der Gottheit bewirkte in ihm nicht nur eine Haltung tiefer Demut, sondern flößte ihm auch sehnliches Verlangen ein, sich für jeden von uns zu opfern. Die ganze Frömmigkeit Jesu geht aus dieser inneren Schau hervor. Durch sie erlangt sie eine unvergleichliche Erhabenheit.
Ein drittes Merkmal der Frömmigkeit Jesu ist die Selbsthinopferung.
Tatsächlich erlangt die Frömmigkeit ihre Vollendung erst in der Ganzhingabe seiner selbst in den Akten der Gottesverehrung. Die Gesinnung der Ganzhingabe bestimmte Jesus, all sein Tun auf den Vater auszurichten. «Ich suche nicht meine Ehre, sondern die Ehre dessen, der mich gesandt hat» (Joh 8, 50). Nach den Absichten Gottes war sein ganzes Leben von der Werkstatt zu Nazareth bis zum Letzten Abendmahl der Aufgabe gewidmet, die Menschen zu lehren, den Vater zu verherrlichen und zu lieben. Wohl vollzog er in der Stunde seines Opfers die höchste Hingabe, doch schon in Erwartung «seiner Stunde» bot Jesus sich dem Vater als Opfergabe dar.
Dazu kommt, dass das Herz Christi ein brennender Herd der Liebe war. Wenn er wünschte, dass der «Name des Vaters geheiligt werde, dass sein Reich komme, sein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden», so zweifellos deshalb, weil die Gerechtigkeit diese Verherrlichung des Vaters fordert; aber er wünschte sie auch aus Liebe zu der unendlichen Vollkommenheit.
Im harmonischen Spiel der inneren Kräfte Jesu herrschte die Liebe vor, und unter dem Einfluss der Liebe erlangte seine Frömmigkeit die höchste Vollendung.
Wenn wir die Heilige Schrift lesen, stellen wir fest, dass jede Phase des Lebens Jesu durch das Verlangen, den Vater zu verherrlichen, gekennzeichnet ist: Die erste Regung seiner Seele bei der Menschwerdung war ein erhabener Akt der Gottesverehrung, die Hingabe seines ganzen Lebens an Gott (Hebr 10, 5-7).
Das erste Wort des Knaben Jesus, das die Evangelien aufgezeichnet haben, spricht von der Weihe seines Lebens an das Werk und die Rechte des Vaters: «Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist?» (Lk 2, 49). In den Jahren des verborgenen Lebens war der Herr von der gleichen Gesinnung beseelt; er suchte nichts als die Ehre des Vaters. Damals und später erfüllte er in jedem Augenblick seinen heiligen Willen: «was ihm gefällt, tue ich immer» (Joh 8,29).
In seinen vertrauten Unterredungen mit Gott übte Jesus in vollkommenster Weise die Tugend der Gottesverehrung. «Der Vater sucht Anbeter im Geist und in der Wahrheit» (Joh 4, 23). Ist er nicht selbst der erste dieser Anbeter? Niemand vermag den Schleier des Geheimnisses zu lüften, der über den Zwiesprachen des Erlösers mit dem Vater ruht, als er in der Wüste vierzig Tage betete und wenn er ganze Nächte auf einem Berg verbrachte: «er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott» (Lk 6, 12). Anbetung war ihm eine innere Notwendigkeit.
In seinen Predigten am Ufer des Sees, auf dem Berg oder im Tempel, wenn er die Kranken heilte oder die Pharisäer beschämte, kommt stets zum Ausdruck, dass er sich zutiefst der Gottessohnschaft bewusst war. Er ist auf die Erde gekommen, um die Menschen zu lehren, den Vater zu verherrlichen und seine unumschränkte Herrschaft anzuerkennen. Wenn er fordert, man solle «dem Kaiser geben, was des Kaisers ist», so verlangt er umsomehr, dass man die Rechte des Allerhöchsten achte. «Gebt Gott, was Gottes ist» (Mk 12, 17).
Der Höhepunkt im Leben Jesu, die Darbringung des Kreuzesopfers, bildet auch den Höhepunkt seiner Gottesverehrung, seiner Frömmigkeit. Als Hoherpriester des Neuen Bundes, als Lamm Gottes, als Schlachtopfer, das die Sünden der Welt trug, war seine innere Haltung von Gott eingegeben: «der sich selbst kraft ewigen Geistes Gott als makelloses Opfer dargebracht hat» (Hebr 9, 14). Seine Hinopferung war die vollendetste Huldigung, der erhabenste Akt der Verehrung, der jemals der Gottheit dargebracht wurde.
Bei jeder Messe - das dürfen wir nie vergessen - wird dieser Akt der Gottesverehrung fortgesetzt, wenn wir Gott die heilige Hostie aufopfern, «die reine, heilge und makellose Opfergabe» («hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam». Und Jesus ist hier wie am Kreuz in seiner Hinopferung nicht allein. Seine Kirche ist mit ihm vereint, «sie ist sein Leib, erfüllt von ihm» (Eph 1, 23). Als Haupt des mystischen Leibes leben wir in Jesus und nehmen teil an den Akten unaussprechlicher Verehrung, die er dem Vater erweist.
Jetzt ist unser Erlöser im Himmel, «in der Herrlichkeit Gottes des Vaters». Gott sei dafür ewig gepriesen. Jesus ist eingegangen in die Herrlichkeit, die ihm zukommt. Und doch neigt sich seine heilige Menschheit stets in Anbetung vor dem Vater.
3. Der Priester verewigt die Gottesverehrung Jesu
Die große Aufgabe des Priesters auf Erden besteht darin, die Huldigung der Ehrfurcht, der Anbetung, des Lobes, die Hingabe seiner selbst an das Werk des Vaters, die wir in der Seele Jesu sehen, zu verewigen. Deshalb tragen seine Handlungen auch unter den alltäglichsten Umständen priesterliches Gepräge.
Die Gewohnheit, durch die Ausrichtung auf die Verherrlichung Gottes in der Gegenwart Gottes zu leben, ist für die Ausübung der priesterlichen Funktionen von größter Bedeutung. Durch sie erlangt der Diener Christi Vertrautheit mit Gott. Wenn sich der hl. Johannes beim Letzten Abendmahl an die Brust Jesu lehnen durfte, sollte es da nicht auch dem Priester bei der Feier der Heiligen Messe gestattet sein, wenn seine Seele von ehrfürchtiger Liebe erfüllt ist ?
Wenn hingegen die Tugend der Gottesverehrung in ihm abnimmt, erkaltet sein Herz. Am Altar ist er zerstreut, freudlos. Die Viertelstunde Danksagung scheint ihm eine Ewigkeit; er weiß Jesus nichts zu sagen. Im Verkehr mit den Gläubigen geht keine wirklich segensreiche Wirkung von ihm aus. Die sich an ihn wenden, um Hilfe in seelischen Schwierigkeiten zu finden, werden enttäuscht. Und warum? «Das Salz hat seine Kraft verloren» (Mt 5, 13); die Gnade der Priesterweihe ist fast «erloschen»: «sonst gehen unsere Lampen aus» (Mt 25, 8).
Wenn die innere Gesinnung nicht mehr in Einklang mit der heiligen Handlung steht, werden die Vorschriften der Rubriken leicht zu einer bloßen Formsache.
Lieben wir in allem die Wahrheit: «von der Liebe geleitet, an die Wahrheit halten» (Eph 4, 15). Durch unsere Priesterweihe haben wir uns in ganz besonderer Weise verpflichtet, die Tugend der Gottesverehrung zu üben. Zu diesem Zweck hat unsere Seele das unauslöschliche Merkmal des sakramentalen Charakters empfangen: unser tiefstes Wesen ist dem Gottesdienst geweiht. Sehen wir uns so, wie wir sind, und leben wir aus dem Geiste des Priestertums, indem wir beharrlich die Tugend der Gottesverehrung üben.
Zu diesem Zweck sind zwei ganz einfache Übungen zu empfehlen.
Die sittlichen Tugenden entwickeln sich in uns durch die Wiederholung der Akte, aus denen sie hervorgehen. Die erste gute Gewohnheit, die wir uns aneignen sollten, ist die, niemals irgendeine sakrale Funktion auszuführen, ohne uns zuvor zu sammeln, wenigstens einen Augenblick.
Sich sammeln heißt, im Innern an die Bedeutung der Handlung denken, die wir vollziehen wollen. Bevor wir Beichte hören, Religionsunterricht erteilen, einen Kranken besuchen, beten lehren, wollen wir die Bedeutung unserer Worte und unserer Handlungen für das ewige Heil der Seelen erwägen. Bitten wir den Heiligen Geist, er möge unsern Verstand erleuchten und unser Herz entflammen. Vereinigen wir uns mit Christus: wir sind seine Stellvertreter bei den Menschen von heute, Werkzeuge der Gnade und des Heiles.
Die Absicht, einzig für Gott und das Heil der Seelen zu wirken, muss oft erneuert werden, sonst wird unsere Tätigkeit von Routine, von Eigenliebe in ihren verschiedensten Tarnungen und unter den verschiedensten Vorwänden bestimmt. Ein Stoßgebet, ein Blick auf das Kruzifix dauern kaum eine Sekunde, aber uns, die wir so wenig gesammelt sind, wird dadurch die Fähigkeit gegeben, besser die göttliche Kraft unserer Handlungen zu erkennen.
Und das zweite: Machen wir zum Inhalt unseres Lebens, was Gott selbst beim ganzen Erlösungswerk erstrebt: die Verherrlichung seines Sohnes. Was war «der große Plan Gottes»? Jesus selbst beantwortet diese Frage: «Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat» (Joh 6, 29). Der Vater will, dass unser Leben damit ausgefüllt sei, an seinen Sohn zu glauben, ihn zu ehren, ihn anzubeten wie ihn selbst, «damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren» (Joh 5, 23) und «alle Zungen sollen zur Ehre Gottes des Vaters bekennen: Jesus Christus ist der Herr» (Phil 2,11).
Muss dieses Ideal uns nicht ein Ansporn zu täglichem Bemühen sein?
Bei den eigentlich priesterlichen Funktionen soll ein lebendiger Glaube in uns den Gedanken an die Gnade wachhalten, die Christus durch uns den Seelen spendet, denn wir handeln dann in «der Person Christi». Denken wir daran, wenn wir taufen, die heilige Ölung spenden oder das gegenseitige Versprechen der Brautleute entgegennehmen; dieser Gedanke wird in uns den Geist der Gottesverehrung wachhalten. Noch wichtiger ist dies bei der Verwaltung des Bußsakramentes: hier nimmt das Herz Jesu durch uns die zerknirschten Sünder auf und öffnet ihnen die Reichtümer seiner Barmherzigkeit.
Vor allem aber müssen wir an den Altar schreiten mit der Absicht, dem Willen des Vaters gemäß den Sohn zu verherrlichen. In der Eucharistie verbirgt sich Jesus unserm Blick, doch wenn der Priester vom Geist der Frömmigkeit erfüllt ist, erzeigt er dem verborgenen Herrn ebenso viel Ehrfurcht, als wenn er ihn mit seinen Augen sähe. Würden wir ihm nicht zu Füßen fallen, wenn wir ihn in seiner Herrlichkeit erblickten wie die Engel und Heiligen ?
Welche Seelenhaltung erwartet die Braut Christi von den Dienern der Eucharistie? Die Ehrfurcht: «Lasst uns tief gebeugt verehren» («Tantum ergo sacramentum veneremur cernui»). Wenn die Tugend der Gottesverehrung uns drängt, dem Vater die schuldige Huldigung zu erweisen, wie sehr hat da Jesus Christus, der Sohn Gottes, ein Recht auf unsere Anbetung, unsere Dankbarkeit! Ist er nicht unser Erlöser, Jesus, den wir beim Letzten Abendmahl sehen, bei seinem Leiden, bei der Auferstehung, der Hohepriester, der Ursprung unseres Priestertums ist? Und seine Menschheit ist untrennbar mit dem Logos verbunden. Der Logos aber, der von Ewigkeit her aus dem Vater hervorgeht, ist dem Vater wesensgleich und verlässt ihn nicht.
Und der Heilige Geist, der aus ihrer gegenseitigen Liebe hervorgeht, verbindet sie noch miteinander. So ist also die heiligste Dreifaltigkeit in der Hostie gegenwärtig.
Tiefe Ehrfurcht, ja Anbetung ist die einzige Haltung, die dem Menschen in Gegenwart des allerheiligsten Sakramentes zukommt. Diese Verehrung ist die Bedingung, die Gott stellt, wenn er uns durch die Eucharistie seine Gnaden schenken will.
Deshalb lehrt die Kirche uns sprechen: «Herr ... , lass uns das heilige Geheimnis Deines Leibes und Blutes so verehren, dass wir unaufhörlich der Erlösungsfrüchte teilhaft werden.»
Und außerhalb der Heiligen Messe drängt uns die Tugend der Gottesverehrung, Jesus in der Stille des Tabernakels anzubeten: «In Demut bet' ich Dich, verborg'ne Gottheit an . .. Mein Herz ist ganz Dir untertan». Jesus wohnt unter uns mit der Fülle seiner göttlichen Macht, wie damals, als er die Kranken heilte und den Lazarus von den Toten auferweckte. Er ist da, lebendige und lebenspendende Hostie, erfüllt von der Tugend und der Gnade, die in jedem seiner Geheimnisse ruht, vor allem im Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung. Er wartet auf uns in grenzenloser Liebe, sehnt sich danach, uns seine Gaben mitzuteilen, uns zu seinen Freunden zu machen. Die Gesinnung barmherziger Liebe, die Christus dereinst den Menschen kundtat, hat sich nicht geändert. Glauben wir nur, dass Jesus uns unter den sakramentalen Gestalten ebenso liebt wie beim Abendmahl, als er die Worte sprach: «Sehnlichst habe ich danach verlangt, dieses Ostermahl mit euch zu halten, bevor ich leide» (Lk 22,15).
Die Tugend der Gottesverehrung verlangt vom Priester, dass sein äußeres Verhalten mit seiner Würde in Einklang stehe. Das Konzil von Trient sagt: «Es geziemt sich, dass die Geistlichen, die berufen sind, sich ganz dem Herrn zu weihen, in ihrer Lebensführung ernst und maßvoll sind, dass ihr Äußeres, ihre Gesten, ihr Gang, ihre Gespräche und alles vom Geist der Frömmigkeit beherrscht sei» (Sess. XXII, de reformatione, 1). Das alles muss ohne jede Geziertheit geschehen, ganz aufrichtig und echt.
Die Augen des Priesters sollen alle schlechtangebrachte Neugierde vermeiden; im Gespräch soll seine übernatürliche Einstellung und seine Güte einen wohltuenden Einfluss ausüben, auch auf die Gleichgültigen und die Ungläubigen.
Bei der Darbringung des heiligen Messopfers beachten wir sorgfältig die Rubriken. Sie sind die Schicklichkeitsregeln, die die Braut Christi im Verkehr mit dem König der Könige vorschreibt. Ist es nicht angemessen, bei der Feier dieser Geheimnisse, die unser Begreifen unendlich übersteigen, unser Verhalten den Bestimmungen der Kirche anzupassen? Wenn wir aus Ehrfurcht vor dem sakralen Charakter des Ritus den Rubriken gehorchen, selbst denen, die eine einfache Verneigung vorschreiben, vollbringen wir einen bewussten Akt der Gottesverehrung.
Die Treue in der Erfüllung dieser Pflicht vermehrt den Eifer und bewahrt den Priester vor der großen Gefahr des Hastens. Übertriebene Schnelligkeit in den Bewegungen und im Rezitieren kann nur zu leicht der Andacht abträglich sein. Bei der Kniebeugung sei es unsere Absicht, den Heiland in aller Wahrheit anzubeten. Wenn wir das Kreuzzeichen über die «Opfergabe» und besonders über den Leib Christi machen, soll diese Geste von tiefer Ehrfurcht getragen sein. Manche Priester verhalten sich am Altar so, dass man an ihrem Glauben zweifeln möchte. Werden hingegen die liturgischen Gebete gesammelt, wenn auch ohne übertriebene Langsamkeit, gesprochen, so wirkt die ehrfurchtsvolle Haltung des Priesters mehr als die beste Predigt.
Das gleiche gilt von den andern Funktionen. Wenn der Priester z. B. eine Beerdigung vornimmt, wird sein ernstes, würdiges Verhalten den Teilnehmern zeigen, dass er von lebendigem Glauben an die übernatürliche Bedeutung der Riten, die er vollzieht, und der Worte, die er ausspricht, beseelt ist.
Tragen wir auch Sorge für das Ziborium, den Tabernakel, für die Sauberkeit der Kirche. Mag eine Kirche auch keinerlei Prunk besitzen, so verletzt das Jesus nicht; hat er nicht in Bethlehem, in Nazareth, am Kreuz äußerste Armut erwählt? Doch die Kirche soll geziemend instandgehalten sein. Gott kann nicht zugeben, dass man es gegen seinen Sohn, der in der heiligsten Eucharistie seine Hingabe an die Menschen fortsetzt, an Ehrfurcht fehlen lässt.
Es ist nicht nötig, alle Vorschriften und Rubriken mit allzu skrupelhafter Ängstlichkeit zu befolgen. In Zweifelsfällen mag ein Priester, ein kluger Freund befragt werden. Und wenn sich ein Mitbruder die Freiheit nimmt, uns auf einen Fehler oder ein Versehen bei der Darbringung des heiligen Opfers aufmerksam zu machen, und wenn dieser Tadel berechtigt ist, dann nehmen wir ihn an, richten wir uns danach. Seien wir sogar dankbar für jeden Hinweis, der uns hilft, unsere liturgischen Pflichten besser zu erfüllen. Diese Dankbarkeit ist ein Zeichen dafür, dass die Tugend der Gottesverehrung in uns lebendig ist.
Um dem Priester zu zeigen, mit welcher Ehrfurcht er seine priesterlichen Funktionen vollziehen soll, führt der hl. Johannes Chrysostomus (De sacerdotio III, 4. P. G. 48, Sp. 642) einen Vergleich an. Er erinnert an die Szene aus dem Alten Testament, wo der Prophet Elias das Opfer darbrachte. Er steht vor dem Altar, auf dem die Opfergaben liegen, und bittet Gott, er möge Feuer vom Himmel senden, dass es sie verzehre, um so zu zeigen, dass ihm dieses Opfer angenehm sei. Und sofort bricht Feuer aus den Wolken hervor. «Diese Dinge», so fährt der Heilige fort, «sind staunenerregend; doch denke daran, dass sie nicht nur damals geschahen, sondern auch jetzt, in unsern Tagen, vorsichgehen (auf unsern Altären). Es sind nicht nur staunenerregende Dinge, die du da bewundern kannst, sondern eine Realität, die jede Bewunderung übersteigt. Der Priester steht da. Er trägt kein Feuer, sondern den Heiligen Geist. Lange betet er, nicht, dass eine Flamme vom Himmel die vorbereiteten Opfergaben verzehre, sondern dass die Gnade Gottes auf dem Opfer ruhe und durch dieses die Seelen ergreife.»
IX. DAS HAUPTGEBOT
Am Tag der Priesterweihe hat uns die Kirche den Kelch anvertraut, der bestimmt ist, das Blut des Erlösers aufzunehmen. Dafür verlangte sie ein Opfer von uns: das, in jungfräulicher Einsamkeit zu leben.
Wenn wir unserer Aufgabe treu bleiben und uns im Eifer für unser Amt erhalten wollen, müssen wir von großer Liebe zu Gott erfüllt sein.
Unser Herz ist zum Lieben erschaffen; wir haben ein unermessliches Verlangen nach Liebe; ohne sie können wir nicht leben. So groß ist die Macht der Liebe, dass durch sie unsere armselige Natur Kummer, Leiden und selbst den Tod zu überwinden vermag: «Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen» (Hld 8, 7). Je reichere Gaben ein Mensch empfangen hat, desto mehr sehnt er sich nach einer edlen Liebe. Wenn wir uns nicht hochherzig Gott zuwenden, werden wir unweigerlich von den Geschöpfen angezogen.
Seien wir überzeugt: nichts auf Erden ist so schön, so mächtig, vermag so viel Segen zu spenden wie ein priesterliches Herz, das demütig und von Gottesliebe erfüllt ist. Und es gibt deren viele. Aber es gibt auch nichts Beklagenswerteres als ein Priesterherz, das durch ungeordnete Zuneigung zu den Geschöpfen entheiligt ist. Wurden doch in der Priesterweihe unsere Herzen Gott geweiht. So haben wir nicht das Recht, unsere Liebe zu vergeuden.
Es gehört viel Tugendkraft dazu, sich auf der Höhe der Berufung zu halten. Dies wird uns nur möglich sein, wenn wir versuchen, zu einer innigen Freundschaft mit dem göttlichen Meister zu gelangen. Unsere Fehler sind dafür kein Hindernis. Ein wahrer Freund wird uns seine Freundschaft nicht entziehen, weil er unsere Fehler kennt, wenn er nur weiß, dass wir darunter leiden und wünschen, dass er uns hilft, sie zu überwinden.
Freundschaft besteht in Übereinstimmung der Herzen: «con-cordes». Das ist es, was der Herr von uns verlangt: Liebe, Vereinigung unseres Herzens mit ihm. Wenn wir diese Vertrautheit nicht suchen, so bedeutet dies für uns Priester eine Treulosigkeit, zumindestens eine teilweise, und durch diese Nachlässigkeit wird eine große Leere in unserer Seele entstehen.
1. Der sakramentale Ursprung der Liebe
Die christliche Liebe ist, selbst in ihren erhabensten Formen, die Entfaltung der göttlichen Gaben, die wir in der Taufe empfangen. Das ist eine Wahrheit von grundlegender Bedeutung.
Dieses Sakrament bewirkt eine geheimnisvolle, aber wirkliche Verbindung zwischen dem Tod und der Auferstehung Christi einerseits, und der getauften Seele anderseits. Kraft dieser Verbindung vollzieht sich ein geistiges Sterben und eine geistige Auferstehung. Durch die Taufgnade werden wir nicht nur von der Erbschuld befreit, sondern sie weckt in uns auch die Bereitschaft, jeder übertriebenen Liebe zu Irdischem, zu Menschlichem, die in unserm Leben dem Göttlichen entgegen ist, zu sterben.
Dieses «Der-Sünde-sterben» ist nicht Selbstzweck; es ist die unerlässliche Vorbedingung für die volle Entfaltung des neuen Lebens in Christus: «für Gott leben in Christus Jesus» (Röm 6, 11). Der Apostel sagt dazu: «Wenn ihr mit Christus auferweckt seid, so sucht, was droben ist» (Kol 3, 1).
Im Geheimnis des begrabenen und dann glorreich auferstandenen Christus besitzen wir ein eindrucksvolles Sinnbild des doppelten Aspektes der Taufgnade. Doch wir dürfen darin mehr sehen als ein Symbol. Haben wir, wie der Apostel sagt, Glauben in die «Kraft der Auferstehung». Durch die Auferstehung ist Christus für uns zum Lebensspender geworden: «wegen unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt» (Röm 4, 25). Er wurde verherrlicht wegen der Verdienste, die er durch sein Sterben erworben hat, und wurde zur Wirkursache, die in seinem mystischen Leib unaufhörlich alle Gnade der Rechtfertigung oder der Heiligung hervorbringt: «Ich bin der wahre Weinstock ..., ihr die Rebzweige» (Joh 15,1.5). -
Obwohl es scheint, als sei die Taufgnade bei vielen Christen unwirksam geworden, besitzt sie doch tatsächlich ihrem Wesen nach einen wunderbaren Dynamismus, der sich darin äußert, dass er den ganzen Menschen innerlich auf Gott und die Gerechtigkeit ausrichtet, die Seele auf ihr letztes, übernatürliches Ziel hinlenkt, und sie zu einem Leben der Liebe anspornt. Gewiss, dieses Werk wird nicht auf einmal vollbracht und nicht ohne die Mitwirkung des Menschen; aber eines ist sicher: auf Grund der Gabe der Liebe, die uns in der Taufe zusammen mit dem Glauben und der Hoffnung eingegossen wurde, ist es uns möglich, Gott über alles zu lieben und alle unsere Handlungen vom Geist des Evangeliums bestimmen zu lassen.
Das Flämmchen der Liebe, das in uns lebt, hat also seinen Ursprung nicht in unserer Naturanlage; wenn wir das annähmen, vergäßen wir, dass die Liebe eine der erhabenen Gaben ist, die Gott seinen Adoptivkindern gewährt hat. Sie wird der Seele auf übernatürliche Weise mitgeteilt.
Betrachten wir sie von diesem Gesichtspunkt aus: sie kommt von Gott, sie macht uns ihm ähnlich: «Gott ist die Liebe» (1 Joh 4, 8). Der Vater zeugt den Sohn und betrachtet ihn voll Liebe. Der Sohn betrachtet den Vater, und aus ihrer gegenseitigen Liebe geht der Heilige Geist hervor.
Durch die Übung der Liebe wird unser Erdenleben immer mehr ein Abglanz des göttlichen Lebens. «Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns verliehen wurde» (Röm 5, 5).
In unserm Priesterleben, das ganz Gott und den Seelen geweiht ist, soll grenzenlose Liebe das beherrschende Element sein; dann sind wir nicht mehr von den wechselnden Eindrücken unserer Sinne abhängig. Abgesehen von der Eigenwirkung der Sakramente werden wir die Seelen nur insoweit beeinflussen können, als wir ihnen übernatürliche Liebe entgegenbringen. Wie könnten wir auch Gott zu den Menschen tragen, wenn wir nicht selbst an dem Anteil hätten, was Gott seinem Wesen nach ist, an der Liebe?
Sorgen wir dafür, dass unsere Liebe aus diesem göttlichen Ursprung hervorgehe, dass sie übernatürlich, männlich, erleuchtet sei, sich auf den Glauben und die Heilige Schrift stütze und so zuverlässig sei wie diese.
2. Die Erhabenheit der Liebe
Um die Bedeutung der Liebe besser zu verstehen, fragen wir uns: Welcher Platz kommt der Liebe von rechtswegen in dem Gebäude der christlichen und priesterlichen Vollkommenheit zu ?
Der Gegenstand der theologischen Tugend der Liebe ist bekanntlich die erhabene Vollkommenheit Gottes, die im Vater und im Sohn und im Heiligen Geist wesensgleich ist. Im Himmel beseligt diese Vollkommenheit die Engel und die Heiligen. Wir auf Erden müssen uns ihr zuwenden, indem wir sie um ihrer selbst willen lieben über alles, ohne Maß. Durch Jesus Christus wird sie den Gläubigen geoffenbart und mitgeteilt. In ihm, dem Haupt des mystischen Leibes, ist uns Zugang zum Innern des Vaters gewährt.
Diese Liebe ist daher das erhabenste und beglückendste Geschenk, das wir in der Annahme an Kindes Statt empfangen haben.
Wir können das Recht, Gott als seine Kinder lieben zu dürfen, gar nicht hoch genug schätzen.
Jesus war von unendlicher Liebe beseelt; diese Liebe galt zunächst dem Vater und dann in ihm und um seinetwillen allen Menschen. Wir wissen es: seine Gottesverehrung, sein Leben des Gehorsams sind Früchte der Liebe. Bezeugt er doch selbst, «er tue allzeit, was dem Vater wohlgefällt» (vgl. Joh 8, 29). Und sein Leiden ist nichts als eine höchste Bekundung seiner Liebe zum Vater. «Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe» (Joh 14,31).
Unsere Bestimmung ist es, Christus nachzuahmen im totalen Einsatz für die Verherrlichung des Vaters.
Deshalb sagt St. Thomas in seinem Traktat «Über die Vollkommenheit des christlichen Lebens», die Heiligkeit bestehe nicht in der Abtötung, nicht im Gebet, sondern in der Liebe. Und der hl. Franz von Sales schreibt: «Jeder denkt sich die Vollkommenheit auf seine Art: der eine sieht sie in einem strengen Leben, der andere im Almosengeben, andere sehen sie im häufigen Empfang der Sakramente. Ich aber kenne keine andere Vollkommenheit als die, Gott von ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten wie sich selbst» (Hamon, Vie, VII, 5.).
Warum besitzt die Liebe so überragenden Wert?
Vor allem, weil der Akt der Liebe eine Hinwendung des Willens zu Gott ist mit dem Ziel, sich um seinetwillen in ihm zu freuen. Diesem Akt kommt eine hervorragend einigende Wirkung zu: «Die Liebe ist die einigende Kraft» («Amor est vis unitiva» -Pseudo-Dyonisius, Göttliche Namen, IX.). Nur durch ihn vollzieht sich die liebende Vereinigung der Seele mit der unendlichen Heiligkeit.
Ferner, da der Wille die beherrschende Kraft im Menschen ist, leitet und bestimmt er auch die andern Kräfte. Alle unsere bewussten und freien Handlungen stehen unter seiner Befehlsgewalt. Wenn der Wille sich unter dem Einfluss der Liebe Gott schenkt, will er sich nicht nur mit ihm vereinigen, sondern ihm alles geben, was zu seinem Bereich gehört. Deshalb ist er die «Form» aller Tugenden; auf Grund seines Impulses wird die Übung aller Tugenden zu einer Huldigung der Liebe und verdient das ewige Leben.
«Das ist das größte Gebot im Gesetz: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, … Das ist das wichtigste und erste Gebot» (Mt 22, 37-38). Da sich der Priester der Liebe geweiht hat, setzt er wie Jesus alle seine Kräfte, alle Regungen seines Geistes und seines Herzens für die Aufgabe ein, den Vater zu verherrlichen.
Die Liebe besitzt also den besondern Vorzug, die Betätigung aller Tugenden auf Gott auszurichten (Die Tugend der Gottesverehrung bietet Gott die Übung der anderen Tugenden als Huldigung unserer Dienstbarkeit an, die wir dem Herrn wegen seiner Oberherrschaft schulden. Die Liebe bietet Gott das gleiche dar, aber als Huldigung unserer Zuneigung. Sie freut sich so sehr an der Heiligkeit Gottes und wünscht so sehr, dem göttlichen Willen gleichförmig zu werden, dass sie den Menschen zur Übung aller Tugenden anspornt, um in ihrer Übung das Mittel einer ständigen und selbstlosen Vereinigung mit Gott zu finden.).
Es ist interessant, festzustellen, dass in einem wunderbaren Austausch die übrigen theologischen und sittlichen Tugenden zum Wachstum und zur Vorherrschaft der Liebe in uns beitragen.
Wenn nicht die entsprechenden Tugenden eine Gegenwirkung ausübten, würde das Verlangen des Fleisches, der Hochmut, die Eitelkeit, Anhänglichkeit an Irdisches unsern Schwung hemmen und die Vorherrschaft der Liebe vernichten; gewohnheitsmäßige Klugheit, Ordnungsliebe, Pünktlichkeit, Gerechtigkeit, Keuschheit, Starkmut, Geduld und Beharrlichkeit müssen mithelfen, die Liebe zu erhalten und zu entfalten.
Wenn wir Fehlern, die wir erkennen, nicht den Kampf ansagen, dann werden wir zahllose Fehltritte begehen und so die Liebe in unserm Leben vermindern oder sogar auslöschen.
Arbeiten wir doch an unserer Selbsterziehung weit mehr aus Liebe zu Gott und zum Nächsten als aus Sorge um unsere eigene Vollkommenheit. Schleifen wir unsere Ecken und Kanten ab, nicht aus eitler Selbstgefälligkeit, sondern vor allem, um Gott zu gefallen, um seinem heiligen Willen gleichförmig zu werden, um die Liebe voll und ganz in unserm Innern herrschen zu lassen.
Es gibt ein vorzügliches Mittel, das Wachstum der Gottesliebe zu fördern: sich bemühen, ganz ruhig, ohne gewaltsame Anstrengung jede Handlung in reinster Absicht zu verrichten, damit «der Name Gottes geheiligt werde, damit sein Reich komme, damit sein Wille geschehe». So werdet «ihr des Herrn würdig wandeln, ganz so, wie es ihm wohlgefällt. Ihr werdet an allen guten Werken fruchtbar sein» (Kol 1, 10).
Die überragende Bedeutung der Liebe wird uns noch schneller klar, wenn wir uns der großen theologischen Wahrheiten erinnern, deren Gesamtheit die wesentliche Lehre vom übernatürlichen Leben darstellt.
Die heiligmachende Gnade vergöttlicht die Seele, macht sie gottförmig, bewirkt, dass die heiligste Dreifaltigkeit in ihr wohnt.
Die theologischen Tugenden gesellen sich zur heiligmachenden Gnade; sie ermöglichen es dem Christen, gemäß seiner übernatürlichen Erhöhung zu handeln, und verbinden die Seele auf Grund ihres Kindesverhältnisses in wirksamer Weise mit Gott. Durch sie steht die Seele in der richtigen Haltung vor dem Herrn, der sich offenbart (Glaube), der sich ihr als letzte Beseligung zeigt (Hoffnung), und als die höchste Vollkommenheit, die um ihrer selbst willen geliebt wird (Liebe).
Überdies schließt die Liebe alle eingegossenen sittlichen Tugenden irgendwie keimhaft in sich. «Wie aus der einen Wurzel die verschiedenen Zweige des Baumes hervorgehen», sagt der hl. Gregor, «so ist die Liebe Ursprung der verschiedenen Tugenden», «Multae virtutes ex una caritate generantur» (Homil. 27 in Evang. P. L. 76, Sp. 1205).
Außer der Liebe und den Tugenden senkt Gott auch die Gaben des Heiligen Geistes in unsere Seele ein und verleiht uns durch sie eine dauernde Haltung, die die Seele fähig macht, den Eingebungen von oben zu folgen.
Die Gesamtheit dieser Gnaden führt in den Besitz der Früchte des Heiligen Geistes. Sie zeigen sich in der Seele, sobald der Habitus eines heiligen Lebens zur Reife gelangt ist; sie offenbaren die harmonische und vollendete Entfaltung der verschiedenen Tugenden. Zu diesen Früchten gehören vor allem Friede und geistliche Freude, Nachgiebigkeit und Sanftmut.
Diese übernatürliche Entwicklung ist in ihrem Ausdruck menschlich, der Quelle nach aber göttlich. Die Gnade erhebt von innen her die menschliche Natur und ihre Tätigkeiten. Ursprung dieses göttlichen Lebens ist Jesus Christus.
Der Grad der habituellen Liebe, die wir im Lauf unseres Lebens erlangt haben, ist ausschlaggebend für den Grad unserer Glorie im Himmel. Die gleiche Liebe, mit der wir Gott hienieden lieben, wird uns mit ihm vereinigen und unsere ewige Seligkeit ausmachen. Sorgen wir also dafür, dass die Flamme der Liebe in unserm Herzen stets lebendig sei.
Am Abend des Lebens wird es für den Christen, und vor allem für den Priester, ein schmerzlicher Gedanke sein, dass er im Besitz so großer, übernatürliche Reichtümer gewesen ist und sie so wenig benützt hat.
3. Die doppelte Form der Liebe: die affektive und die effektive
Betrachten wir die Übung der Liebe.
Alle ihre Akte können bekanntlich auf zwei verschiedene Arten vollzogen werden: auf affektive und auf effektive Weise. Diese beiden Formen der Liebe schließen sich ganz und gar nicht aus, sondern stützen und ergänzen einander. Echte Liebe schließt beide in sich.
Die affektive Liebe, die ihren Ursprung im Gemüt hat, ist die erste Hinwendung der Seele zu einem Gut.
Wenn im Glauben die unendliche Liebenswürdigkeit Gottes erkannt wird, erwacht die latente Liebe und wendet sich Gott zu; die Seele sehnt sich nach der Vereinigung mit ihm. Diese übernatürliche Liebe ist tatsächlich ein Keim, der bei der Taufe in das Innere des Christen eingesenkt wurde. Sie ermöglicht es dem Menschen, sich an der göttlichen Vollkommenheit zu freuen; sie richtet sich auf Gott aus und will ihm gefallen. Diese inneren Regungen sind Akte der affektiven Liebe.
Der hl. Franz von Sales behandelt in seinem «Traktat über die Gottesliebe» vor allem drei dieser Regungen: das Wohlgefallen an der göttlichen Vollkommenheit, das Wohlwollen, das uns drängt, den Herrn zu loben, ihm zu dienen, unsere Kräfte für seine Verherrlichung einzusetzen; und schließlich die Liebe der Gleichförmigkeit, die uns veranlasst, in voller Hingabe unser selbst alles zu bejahen, was Gott von uns will und erwartet.
Diese Akte sind ihrem Wesen nach selbstlos; wir vollziehen sie, ohne davon einen Vorteil für uns zu erhoffen, «aus reiner Freundschaft zu Gott», «Caritas amicitia quaedam est hominis ad Deum» (S. th. lI-lI, q. 23, a. 1), sagt der hl. Thomas. Die Formel für den Akt der Liebe, die der Katechismus lehrt, die ersten Bitten des Vaterunsers, die Präfation der Heiligen Messe, die Anrufung «Mein Gott und alles» und viele Stoßgebete, die aus den Psalmen oder anderswoher stammen, bieten uns ausgezeichnete Beispiele für Akte der affektiven Liebe. Vergessen wir jedoch nicht, dass wir Gott, den wir mit reiner Liebe umfangen, auch durch die theologische Tugend der Hoffnung ersehnen dürfen und sollen, insofern er die Seele beglückt und ihr volle Befriedigung schenkt: «Tunc me de te satiabis satietate mirifica.» (Römisches Messbuch,Vorbereitung auf die Heilige Messe, Samstag. 2 Homil. 30 in Evang. P. L. 76, Sp. 1220).
Schenken wir Gott sowohl die Liebe des Wohlwollens als auch die Liebe der Hoffnung; diese Gesinnung ist ihm sehr wohlgefällig. Sie tilgt unsere lässlichen Sünden, erhält uns in der Vereinigung mit Gott und vermehrt unsere Verdienste. Glücklich die Seele, die spürt, wie in der Sammlung tiefe Sehnsucht erwacht, die ihren Ursprung in der Liebe hat!
So förderlich die Akte der affektiven Liebe auch sind, wir müssen ihr die der effektiven Liebe hinzufügen. Nur diese bürgen für die Aufrichtigkeit, die Stärke und den Wert der Regungen und des Strebens unserer Seele. Der hl. Gregor drückt diese Tatsache mit den Worten aus: «Die Erprobung unserer Liebe ist das Zeugnis unserer Werke» (Homil. 30 in Evang. P. L. 76, Sp. 1220). Der große Lehrer spricht da nur aus, was auch das Evangelium sagt: «Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt» (Joh 14, 21).
Betrachten wir die Grade der effektiven Liebe.
Der erste ist die Erfüllung des göttlichen Willens, der sich in den Zehn Geboten kundtut. Der Bischof verlangt am Tage der Priesterweihe von uns: «Beobachtet die Gesetze des Dekaloges.»
Diese Unterwerfung ist notwendig, um in das Himmelreich einzugehen. Ohne sie können Gefühle, Gebete, religiöse Übungen nicht genügen. Der Herr hat es ausdrücklich gesagt: «Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut» (Mt 7, 21). Dieser Wille offenbart sich aber vor allem in den Zehn Geboten.
Vielen wird es scheinen, es sei überflüssig, eine so grundlegende Wahrheit zu betonen. Doch denken wir ans Evangelium: die Pharisäer beobachteten die meisten Vorschriften des mosaischen Gesetzes, dennoch gefiel ihre Treue Gott nicht. Warum wohl? Sie vernachlässigten einige der wichtigsten Gebote.
So könnte es auch vorkommen, dass ein Christ äußerlich seine religiösen Übungen sorgfältig macht, aber die Pflichten der Gerechtigkeit vernachlässigt. Wie kann man dem Herrn gefallen, wenn man das Ansehen des Nächsten schädigt, wenn man sich in wenig ehrliche Geldgeschäfte einlässt und sogar seine Schulden nicht pünktlich zahlt, wenn man seine tägliche Arbeit nicht gewissenhaft tut?
Es ist gut, von Zeit zu Zeit im Gebet die Gebote zu durchdenken und sich zu prüfen, ob wir auch in kleinen Dingen jedes von ihnen erfüllen, und uns dann aus Liebe dem göttlichen Willen unterwerfen, der sich in ihnen ausspricht. Das ist eine vorzügliche Art der Betrachtung.
Die echte Liebe fordert von uns nicht nur die Beobachtung der Zehn Gebote und der unter Sünde verpflichtenden Vorschriften der Kirche, sondern sie drängt den Christen, auch die Räte zu befolgen. Nicht in der gleichen Weise wie die Ordensleute, sondern in einer, die seinem Stand entspricht. Diese Räte sind nicht verpflichtend; aber da sie die wichtigsten Hindernisse für die volle Entfaltung der Liebe beseitigen, haben sie unschätzbaren Wert für den geistlichen Fortschritt. Sie wollen uns zu einem höheren Grad der göttlichen Liebe führen und machen uns Gott wohlgefälliger.
Bei der Priesterweihe wurden dem Weihekandidaten besondere Pflichten auferlegt, er hat große Opfer auf sich genommen, damit er durch die Weihe zugleich ein vollkommener Jünger Christi werde. Diese Verzichte können ihn zur Heiligkeit führen, wenn er sie nicht gewohnheitsmäßig erfüllt, sondern aus Liebe.
Der Priester verzichtet vor allem weitgehend auf seine persönliche Unabhängigkeit. Er verspricht dem Bischof Gehorsam, erklärt sich bereit, seine Aufträge und Richtlinien als Ausdruck des göttlichen Willens in Bezug auf seine Person anzunehmen. Wenn er sein Leben lang in dieser Hinsicht treu bleibt, wird diese Unterwerfung ein wirksames Mittel zu seiner Heiligung und zur Befruchtung seines Wirkens.
Der Priester hat freiwillig Keuschheit gelobt. So ist er ganz Christus geweiht. Er sprach zum Herrn: «O Jesus, ich wünsche Dich aus ganzem und ungeteiltem Herzen zu lieben. Ich verzichte in diesem Leben auf jede andere große Liebe außer die Deine. Ich will meinen Nächsten vor allem um Deinetwillen und in Dir lieben.» Dieses Opfer ist großmütig und verdient Bewunderung. Ein Versprechen, das man einem Menschen macht, ist schon etwas Bedeutsames; doch eine Verpflichtung, die man Gott gegenüber eingeht, ist heilig; sie ist ein Kultakt, ein Akt der Gottesverehrung, der eine unverletzliche Bindung schafft. Da wir aus Liebe zu Jesus auf die erlaubte Freude, ein Heim zu gründen, verzichtet haben, dürfen wir nicht mehr mit Bedauern an diese Lebensform denken. Wenn wir ein solches Bedauern freiwillig festhielten, könnte es verhängnisvoll werden. Erneuern wir oft die Weihe unserer Keuschheit an Gott. Wenn wir diesen Akt mitten in Versuchungen und im Widerstreben der Natur vollziehen, ist er ein freiwilliges Zeugnis für unsere Treue zum Herrn und stärkt uns für die Zukunft.
Der Priester hat Keuschheit gelobt und Gehorsam versprochen; Armut hingegen hat er weder gelobt noch versprochen. Dennoch kann er diesen Rat des Evangeliums nicht unbeachtet lassen.
Die materiellen Lebensbedingungen sind oft regional verschieden; man kann nicht Regeln aufstellen, die für alle anwendbar sind. Aber wir gehen sicher nicht zu weit, wenn wir die Notwendigkeit betonen, sich vor zwei Neigungen zu hüten, die unserm Ideal entgegengesetzt sind.
Hüten wir uns vor allem davor, uns zu viele Sorgen um unsere Besoldung zu machen; seien wir streng gegen uns, wenn sich Habsucht regen will. Wenn die Gläubigen sehen, dass ein Priester geldgierig ist, sind sie nicht nur enttäuscht, sondern nehmen Anstoß daran.
Dulden wir nicht, dass der Wunsch nach den Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens in uns herrsche. Die vielen Priester, die ein bescheidenes, ja sogar ein hartes Leben führen, erwerben große Verdienste. Bethlehem, Nazareth, Kalvaria sind ihnen eindrucksvolle Lehren; so kommen sie ihrem göttlichen Vorbild immer näher.
Das Wort des hl. Paulus: «Ich weiß mich in die Not zu schicken, ich weiß auch mit Überfluss umzugehen» (Phil 4, 12), zeigt, dass der Priester sich den äußeren Verhältnissen anpassen soll.
Wenn wir den Geboten gehorchen und die Räte befolgen, wie es eben dargelegt wurde, so ist dies schon eine hervorragende Betätigung der Liebe. Doch um diese Tugend in ihrer Vollendung zu erlangen, müssen wir noch einen höheren Grad erstreben: den der Hingabe.
Was versteht man darunter? Eine völlige Auslieferung an Gott durch vertrauensvolle und liebende Annahme aller seiner verborgenen Absichten in Bezug auf uns; eine Hingabe des Menschen an das göttliche Wohlgefallen, nicht nur für die Schwierigkeiten des gegenwärtigen Augenblicks, sondern auch für alle Möglichkeiten, die die Zukunft birgt.
Diese Seelenhaltung, die ein letzter Ausdruck der Liebe ist, setzt lebendigen Glauben und grenzenloses Vertrauen in die Güte Gottes voraus, dessen Weisheit alles Geschehen lenkt, damit es uns näher zu ihm führe.
Wer von uns vermag zu erkennen, was auf dem Gebiet des Übernatürlichen das Beste für ihn ist? Erfassen wir immer, wie sehr Misserfolg, Prüfungen, Leiden dazu beitragen, uns zu läutern, uns Erkenntnisse zu geben, uns mit Gott zu vereinigen? Er allein sieht die Seele in unvergleichlicher Klarheit; er allein weiß sie zu heilen, zu befreien, zu stärken, ihr auf ihrem Weg zu helfen. Durch die Hingabe nimmt der Mensch den gegenwärtigen Augenblick mit seinen Widrigkeiten und Schwierigkeiten an: «Dominus est - Es ist der Herr» (Im Jahre 1912 wurde Dom Marmion vom Heiligen Vater Pius X. in Privataudienz empfangen. Am Schluss der Unterhaltung bat er den heiligen Papst, er möge sich würdigen, ihm «ein Wort für seine Seele» mitzugeben. Pius X. überlegte einen Augenblick, nahm ein Bild und schrieb auf die Rückseite die Worte: «In allen Widrigkeiten denken Sie daran: Es ist der Herr. Und der Herr wird Ihnen ein mächtiger Helfer sein.» Dom Marmion betrachtete von da an oft diesen Text; man findet den Niederschlag davon in seinen geistlichen Tagebüchern und in seinen Briefen.); doch auch seine Zukunft, wie die Vorsehung sie auch gestalten mag. Vertrauensvoll bejaht er das Unbekannte, das seiner wartet, auch die Stunde und die Umstände seines Todes. Dadurch verherrlicht er Gott in seiner Allmacht, in seiner Weisheit und in seiner Liebe; so verstärkt er die Bande, die ihn mit dem Vater im Himmel verbinden.
Die Hingabe bedeutet im geistlichen Leben einen Höhepunkt; ohne sie kann die Liebe nicht zur vollen Auswirkung kommen.
Sprechen wir oft mit dem Psalmisten: «Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln . .. Auch wenn ich wandle in Todesschatten, fürcht' ich kein Unglück, denn Du, Herr, bist bei mir» (Ps 23, 4).
4. Unsere Liebe zu Christus
Unser Innenleben hängt zu einem Großteil von unserm Gottesbild ab. Die Vorstellung, die wir von Gott haben, ist entscheidend für unser geistliches Leben; sie bestimmt unsere Haltung in der Berührung mit dem Übernatürlichen. Das ist ein aszetischer Grundsatz von größter Bedeutung.
In der absoluten Transzendenz ihrer Einheit schließt die Gottheit die höchste Vollkommenheit in sich. Doch obgleich alle Vollkommenheiten Gottes eine große Einheit bilden, kann unser Geist sie nicht als solche erfassen. Unser Denken betrachtet Gott nacheinander unter verschiedenen Aspekten. Auch bei den Akten der Gottesverehrung richtet der Mensch seinen Blick für gewöhnlich auf eine oder die andere Vollkommenheit Gottes.
Im Alten Bund hatte sich Gott den Israeliten vor allem in den Blitzen des Sinai geoffenbart; er war der furchterregende Herr, den man im Staub anbetete, ein Richter, an den man nur mit Zittern denken konnte. Die Juden hatten nach einem Pauluswort «den Geist der Knechtschaft empfangen, um in Furcht zu leben» (Röm 8,15).
Christen, die keine große Liebe besitzen, sehen in Gott nur den Allmächtigen, der sie entweder strafen oder ihre Wünsche erfüllen kann. Sie dienen ihm in dem Wunsch, der Hölle zu entgehen oder seine Gaben zu empfangen. Ein solches religiöses Leben ist unvollkommen.
Man kann den Herrn auch in erster Linie als Gott der Liebe betrachten und ihm mit freiem Herzen dienen, aus reiner Liebe oder Freundschaft. Christus hat uns im Neuen Bund gelehrt, Gott in seiner väterlichen Güte zu sehen; er vermittelt uns nicht den Geist der Furcht, sondern «den Geist der Kindschaft, in dem wir rufen, Abba, Vater» (Röm 8,15). Wie man Gott im Alten Bund den Herrn, den Gott der Rache nannte, so nennen die Christen ihn: Unser Vater, lieber Gott, die unendliche Liebe.
Doch diese Schönheit, diese Güte, die uns in ihrer Reinheit und Herrlichkeit in der Ewigkeit entzücken werden, übersteigen so sehr unsere Fassungskraft, dass viele Seelen meinen, sie könnten keine Liebe in uns wecken; eine Vereinigung in solchen Höhen scheint ihnen kalt, die Liebe ohne Leidenschaft. Man muss die tiefgehenden Läuterungen durchgemacht haben, von denen der hl. Johannes vom Kreuz spricht, und in der dunklen Nacht der Sinne und des Geistes in Treue ausharren, um zur Ruhe der Liebe in diesem göttlichen Geheimnis zu gelangen. Gewiss, die Liebe Gottes ist so unbegreiflich wie die Gottheit selbst; denn Gott ist für immer und ewig die Liebe: «Gott ist die Liebe» (1 J oh 4,8).
Der Herr kannte uns und ist in seiner Güte zu uns gekommen; er ist auf diese Erde herabgestiegen, um bei uns zu sein. Seit der Menschwerdung vermag das Göttliche Wort mit menschlicher Liebe zu lieben. Es hat ein Menschenherz. Jesus wurde erschüttert beim Tod seines Freundes Lazarus; er litt qualvolle Angst vor seiner Passion; die Undankbarkeit der Jünger schmerzte ihn tief; am Kreuz wurde sein Herz von der Lanze durchbohrt und zeigte uns, wie sehr es uns geliebt. Dieses Herz verlangt nach unserer Liebe, wie auch wir wünschen, zu lieben und geliebt zu werden.
Wer von uns, mag er auch keine besonders beschauliche Seele sein, wäre nicht ergriffen von der unendlichen Liebe des Erlösers, die sich in Bethlehem, auf Kalvaria, in der Kirche und ihren Sakramenten, vor allem in der Eucharistie kundtut!
Wenn die Liebe des Vaters von Geheimnis umgeben schien, so wird die des Herzens Jesu offenbar und lindert alle menschliche Seelennot. Der Herr wollte unserer Gebrechlichkeit eine Stütze geben, den Trost, dessen wir bedürfen, um auf dem Weg durch dieses Tränental auszuharren.
So verstehen wir, warum die Kirche in ihren Kindern die Liebe zu Christus dadurch vertiefen will, dass sie ihnen, gemäß dem Wunsch ihres Bräutigams, die Verehrung des göttlichen Herzens empfiehlt.
Diese Verehrung gilt dem menschgewordenen Logos, in seiner menschlichen Liebe betrachtet, deren Symbol das Herz ist. In der Predigt sollte viel öfter betont werden, dass sich jeder religiöse Kult notwendigerweise an die Person wendet. Doch das Herz Jesu kann wirklich Gegenstand der Verehrung und der Anbetung werden, die Gott allein gebührt. Und warum? Weil es zur heiligen Menschheit gehört, ist es stets durch die hypostatische Union mit dem Logos verbunden. Das Herz Christi muss also in seiner Einheit mit der menschgewordenen zweiten göttlichen Person verehrt werden: «Es ist sicher anbetungswürdig, nicht aus sich selbst, sondern weil es mit der Person des Logos untrennbar verbunden ist.» Diese theologische Formulierung, die von dem hl. Johannes von Damascenus und dem hl. Thomas geprägt wurde (S. th. III, q. 25, a. 2), stimmt genau mit der Lehre der Kirche über die Anbetung, die der Menschheit Christi gebührt, überein.
So ist auch die Verehrung der Wunden Jesu zu verstehen. Sie gilt der Person des göttlichen Erlösers, deren Leiden und Liebe man betrachtet, wie sie sich in der Passion offenbaren. Die Wunden zeugen ja von diesen Leiden und dieser Liebe, sind ihr Ausdruck. Deshalb verehren wir sie und dürfen sie anbeten, doch stets in Verbindung mit der Person des Gottessohnes.
So aufgefasst, ist die Herz-Jesu-Verehrung überaus fruchtbar. Durch sie erlangen wir Verständnis für eine zentrale Glaubenswahrheit, für das innerste Geheimnis des Lebens Jesu, der ganz Liebe ist. Die Erniedrigung von Bethlehem, die Selbstlosigkeit seines öffentlichen Wirkens, die Schmach von Kalvaria, der Tod am Kreuz, die Stiftung der Kirche wie die der Eucharistie werden uns zu Offenbarungen seiner unaussprechlichen Liebe. Christus ist Liebe - in allen seinen Geheimnissen, in der Fülle seiner Vollkommenheit, in seiner ganzen Sendung. Sein Werk entspringt voll und ganz der Liebe und führt die Menschen zur Liebe.
So verstehen wir, wenn der hl. Paulus ausruft: «Die Liebe Christi drängt uns» (2 Kor 5, 14). Und ferner: «Er hat mich geliebt und sich für mich dahingegeben» (Gal 2,20). Angesichts solcher Liebe fühlt der Apostel sich untrennbar mit dem Herrn verbunden: «Wer vermag uns zu scheiden von der Liebe Christi?» (Röm 8, 35).
Die Herz-Jesu-Verehrung hat noch einen andern Aspekt, den vor allem wir Priester im Hinblick auf unsere Aufgabe an den Seelen nie übersehen dürfen.
In der Menschwerdung seines Sohnes hat «Gott, der voll Erbarmen ist, hat [uns]], die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht» (Eph 2,4-5).
Wir sind so sehr der Welt der Sinne verhaftet, dass wir das Göttliche nicht erfassen können, ohne uns menschlicher Mittel zu bedienen. So wollte der Vater durch die sichtbare Liebe Jesu die Größe seiner herablassenden Güte uns gegenüber kundtun. Jesus sagt: «Wer mich sieht, der sieht den Vater» (Joh 14, 9). Er hätte auch sagen können: «Wer meine Liebe sieht, sieht die Liebe des Vaters.»
Ohne das unmittelbare und sichtbare Objekt dieser Verehrung außer Acht zu lassen, wird uns dieses verwundete und durchbohrte Herz zur Offenbarung der unfassbaren Liebe des Vaters zu uns Menschen: «So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab» (Joh 3,16).
Diese Liebe des Vaters lebt auch im Sohn und im Heiligen Geist: «Ich und der Vater sind einss» (Joh 10,30). Die heiligste Dreifaltigkeit ist ein Meer der Liebe, und die menschliche Liebe des Herzens Jesu ist ein treues Abbild davon, eine Bekundung dieser Liebe, die unserer Schwachheit angepasst ist.
Der Grund für die völlige Gleichförmigkeit der Liebe in Gott und der im Herzen Jesu ist die hypostatische Union, d. i. die Einheit der menschlichen Natur des Erlösers mit der zweiten göttlichen Person. In ihr wurde durch das Wirken des Heiligen Geistes jede menschliche Handlung Jesu, vor allem seine Liebe, so erhoben, dass sie der Würde des Gottessohnes vollkommen entsprachen.
Wenn es wahr ist, dass die Güte Jesu uns gegenüber die Offenbarung der unendlichen göttlichen Liebe ist, muss da nicht die Güte des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes immer mehr Gegenstand unserer Liebe werden? Wohlverstanden: Wenn wir Christus Liebe für Liebe geben, sollten wir da nicht dazu gelangen, uns zur Unendlichen Liebe zu erheben, die der Ursprung von Jesu Güte ist?
Gott will sicher, dass wir am Herzen Christi Zuflucht finden; aber es ist auch die Absicht Gottes, dass wir uns nicht mit dieser menschlichen Liebe begnügen, sondern durch sie und in ihr den Zugang zum ewigen Geheimnis der verborgenen Liebe Gottes finden.
Jesus hört nie auf, «Mittler» zu sein. Deshalb lernen wir in der Liebe zum Erlöser die unendliche Liebe verherrlichen, deren Tiefe wir in seinem Menschenherzen ahnen: «damit der Vater im Sohn verherrlicht wird» (Joh 14, 13).
Am Tabor sprach der Vater: «Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören» (Mt 17, 5). Mit diesen Worten befiehlt er uns, dass wir nicht nur die Worte Jesu gläubig aufnehmen, sondern auch in seinen Handlungen die Offenbarung der göttlichen Liebe erkennen. «Was das menschgewordene Wort tat», sagt der hl. Augustinus, «ist für uns ein Wort, eine Lehre» (Tractatus in Joan. 24. P. L. 35, Sp. 1593). In der Liebe, die sich in Jesus kundtut, sehen wir einen wirklichen Abglanz der ewigen Liebe.
Angesichts der Sünde und der menschlichen Leiden kann nur der Blick auf die Liebe des gekreuzigten Christus uns eine Antwort auf unsere bangen Fragen finden lassen; er allein zeigt uns allem entgegengesetzten Schein zum Trotz mit unzweifelhafter Gewissheit, dass die Haltung Gottes uns gegenüber die grenzenloser Liebe und Barmherzigkeit ist.
5. Per ipsum, cum ipso, in ipso (durch Ihn und mit Ihm und in Ihm)
Wie kann man mit Christus vereint leben? Die erhabenen Schlussworte des Messkanons lehren es uns.
«Per ipsum.» - Wir Priester wollen für Zeit und Ewigkeit mit Leib und Seele Gott gehören. Durch die Sakramente der Taufe und der Priesterweihe haben wir uns ihm geweiht; wir sind für immer sein Eigentum. Doch es ist sehr wichtig, dass wir tagtäglich durch einen freiwilligen Akt diese Hingabe unserer selbst bestätigen. Die Erneuerung dieser Weihe ist ein kostbarer Akt der Liebe. Das Offertorium in der Messe und die Danksagung sind die geeigneten Augenblicke, um unsere Hingabe zu erneuern. Durch Jesus selbst erlangt dieser Akt seinen vollen Wert.
Das gleiche gilt für den Willen, durch ein ganz Christus geweihtes Leben die Beleidigungen, die der göttlichen Liebe zugefügt werden, zu sühnen. Die Liebe drängt uns, unsere Opfer und Mühen mit den Leiden und Sühneakten Christi zu vereinen; und kraft dieser Vereinigung leisten unsere Handlungen und Mühen Genugtuung für unsern Undank, für unsere und anderer Sünden. Auch da ist das Messopfer die hervorragendste Wiedergutmachung. Christus «ist das Sühnopfer für unsere Sünden, und nicht bloß für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt» (1 Joh 2, 2).
Wir können kaum voll erfassen, wie viel übernatürlicher unser Gebet, aber auch unsere Arbeit, unser Leiden, unser ganzes Leben durch die Betrachtung Christi wird. Zur Armseligkeit unserer Verdienste fügt Jesus stellvertretend die Überfülle der seinen. Vergessen wir nicht: seine Verdienste sind die unsern; das gilt von ihnen in einem viel wahreren Sinn, als uns Dinge auf Erden zu eigen sind; denn sie gehören uns für die ganze Ewigkeit. Im Herzen Jesu steht uns der Zugang zu den Schätzen der Gnade stets offen. Unablässig können wir dort aus der Fülle schöpfen, um Licht und Kraft zu erlangen. Wie groß auch unser Elend sein mag, in Christus haben wir immer das Recht, Gott zu nahen: «Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen» (Hebr 4, 16).
«Cum ipso.» - Wir, die wir voll Unvollkommenheiten sind und manchmal uns selbst und andern zur Last werden, wir können Christus zu unserm Freund erwählen! Er gestattet es, er wünscht es, er fordert uns dazu auf.
Diese Aufforderung, Freundschaft mit Jesus zu schließen, ergeht von allen Seiten an uns: durch die Taufe, durch unsere Berufung zum Priestertum, durch unser tägliches Messopfer, durch die Gegenwart des Herrn im Tabernakel. Jede Seite des Evangeliums kündet uns davon, jedes liturgische Fest erinnert uns daran.
Schritt Jesus nicht an der Seite der Emmausjünger, bis ihr Herz «in ihnen brannte»? Glauben wir nur, dass er uns auf den oft steinigen Wegen unseres Lebens ganz nahe ist. Er ist mehr als irgendein anderer unser Weggefährte, der verzeihende Freund, auf dessen Freundschaft wir bauen können.
«In ipso.» - Diese Worte drücken unsere Vereinigung mit dem Mystischen Leib aus. Das ganze Leben der Liebe, das der Priester führt, soll einen lebendigen Glauben an diese wunderbare Einheit in Christus zur Grundlage haben. Wenn wir die Heilige Messe feiern, erinnern wir uns daran, dass wir das Opfer inmitten dieser Einheit, die die Kirche ist, darbringen und dass wir in ihrem Namen beten. Bei der Verwaltung der Sakramente, bei der Predigt, bei jedem caritativen Werk müssen wir als getreue Ausspender in Verbindung mit dem Haupt dieses Leibes und zum Nutzen seiner Glieder wirken.
Doch das hervorragendste Mittel, «in Christo» zu bleiben, ist die heilige Kommunion. Durch sie vereint sich der Priester in Liebe mit dem Erlöser: «Wer mein Fleisch isst ... der bleibt in mir und ich in ihm» (Joh 6, 57). Nach der Kommunion lebt er weiterhin im Strahlungsbereich des göttlichen Herzens, in der Atmosphäre seiner Liebe und Gnade. Bleibt der Priester ständig mit dem Herrn vereint, dann wird die Gottesgabe in ihm reiche Frucht tragen: «Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt viele Frucht» (Joh 15,5).
Der Diener Christi, der in dieser Gesinnung gearbeitet und gelitten hat, wird dem Tod ohne Bangen entgegensehen. Nachdem er «in Christus» gelebt hat, wird er seinen letzten Atemzug in den Armen und am Herzen Jesu aushauchen. Sein Tod und alle seinen Peinen werden mit denen Christi vereint und gleichsam in ihnen aufgehen; die Verdienste des Erlösers werden sein Reichtum und seine Hoffnung sein. Mit ihm wird er sprechen: «Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist» (Lk 23, 46).
Unsere wahre Freude besteht also darin, unsere Seele unaufhörlich auf das Übernatürliche auszurichten. Salomon hatte in dem Prunk seiner Paläste alle Freuden genossen und fand darin nur Ekel und Überdruss: «Eitelkeit der Eitelkeiten» (Koh 1,2). Wenn die Seele leidenschaftlich menschliche Befriedigung sucht, erkennt sie bald deren Nichtigkeit. Die Freuden, die außerhalb der göttlichen Ordnung stehen, lassen eine völlige Leere im Herzen zurück. Deshalb empfinden die Menschen in den Städten, die einen großen «Vergnügungsbetrieb» haben, am stärksten die Leere und Nichtigkeit des Lebens; und gerade in diesen Städten gibt es die meisten Selbstmorde.
Die einzige tiefe, dauernde Freude in diesem Leben ist die Vereinigung mit Gott. Das gilt für alle, doch für den Priester gilt es tausendfach. Vergeblich wird er versuchen, seinen Durst nach Glück an fremden Quellen zu stillen; sein Herz ist Christus geweiht und kann nur in der Liebe Frieden finden.
Wenn man den Herrn im Herzen trägt, so hieße es, ihn beleidigen, wenn man den Freuden dieser Welt nachtrauern würde und eitlen Wünschen und damit der Traurigkeit Einlass in die Seele gewährte. Das ist, als ob man ihm sagte: «Du genügst mir nicht, Herr.» Und Jesus ist doch unser alles.
Da wir für das Glück erschaffen sind, erstreben wir es notwendigerweise. Und wir gehen nicht in die Irre, wenn wir es suchen. Doch wir würden uns sehr täuschen, wenn wir glaubten, es dort zu finden, wo es uns sicher nicht begegnen wird. Gott will schon hienieden unsere Freude sein und dies, weil sein freier Wille uns auserwählte und diese Wahl immer wieder erneuert.
Liebe und Heiligkeit haben viele verschiedene Stufen. Begnügen wir uns nicht damit, mittelmäßig zu leben. Möge vielmehr unter dem Einfluss des Heiligen Geistes «die Flamme ewiger Liebe unaufhörlich in uns brennen», «Der Herr entzünde das Feuer seiner Liebe und die Flamme ewiger Liebe !»
X. DAS IST MEIN GEBOT
1. Die Einstellung Jesu zu den Menschen: Hingabe seiner selbst
«Bei der Geburt wird er unser Freund; beim Abendmahl gibt er sich uns zur Nahrung; durch seinen Tod wird er unser Lösegeld; in seinem Reich gibt er sich uns zum Lohn» («Se nascens dedit socium, convescens in edulium, se moriens in pretium, se regnans dat in praemium» (Hymnus «Verbum supernum prodiens»).
In diesem liturgischen Text kommt ausdrücklich oder angedeutet immer wieder der Begriff der Hingabe vor: «se dedit.» se dat ...»
Dieses Wort kennzeichnet die Haltung Jesu den Menschen gegenüber während seines Erdenlebens und auch jetzt noch, im Himmel, in vollendeter Weise. Jesus schenkt sich und er hört nicht auf, sich zu schenken; er teilt sich vorbehaltlos mit; er liefert sich aus, immer und überall, in grenzenloser Liebe.
Schon als er in diese Welt kam, erkannten die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland, der greise Simeon, was er für sie bedeutete. Seine Apostel, die Kranken, die Volksmenge von Galiläa sahen noch deutlicher, dass er nicht sich selbst gehörte. War er doch zu den Menschen gesandt worden, um ihnen der Hirte zu sein, der sein Leben für seine Schafe hingibt. Die Taufe, die er ersehnte, war eine Ganzhinopferung seiner selbst bis zur Vergießen des letzten Blutstropfens. «Ich muss mit einer Taufe getauft werden, und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist» (Lk 12, 50). Bei seinem Leiden hat Jesus sich in unendlicher Liebe ausgeliefert. «Für uns gekreuzigt», wie unser Credo kündet; und dieses «für uns» klang in seinem Herzen sicher nicht matt und kraftlos.
Der hl. Bernhard, der himmlische Erleuchtung über die Hingabe Jesu an die Menschen empfangen hatte, fasst sein Wissen in die Worte zusammen: «Er hat sich mir voll und ganz geschenkt; er hat sich für mich verschwendet» (Sermo III in Circumcisione. P. L. 183. Sp. 138).
Doch wir alle wissen, dass sich diese Mitteilung der Liebe im Schoße der Kirche fortsetzt. Und dieser erhabene Dienst obliegt den Priestern Christi. Durch die Priesterweihe wurden wir dazu erwählt, der Welt Christus zu schenken. Hierin liegt die Daseinsberechtigung des Priestertums: «sacerdos - Priester» bedeutet «jener, der Heiliges gibt». Und was gibt es Heiligeres als Jesus Christus ?
Die Liebe des Erlösers hatte stets einen doppelten Aspekt: sie war dem Vater zugewandt, dessen Willen er auf das vollkommenste vollbrachte, und umfasste zugleich alle Menschen. Darum bringt Christus sich bei der Heiligen Messe zunächst zur Ehre des Vaters dar; das ist das Hauptziel des Opfers. Dann aber gibt er sich allen zur Speise: den «Guten», den Gewohnheitschristen, den Lauen, und sogar den «Bösen», «Sumunt boni, sumunt mali - Gute empfangen es, Böse empfangen es» (Sequenz «Lauda Sion»).
Er weist niemanden zurück: «Empfangt und verzehrt es» (Mt 26, 26). Und diese Liebe veranlasst ihn, die Hingabe seiner selbst, durch die das Erlösungswerk vollendet wird, in seinem mystischen Leib fortzusetzen.
Wir gefallen Gott in dem Maße, als wir seinem Sohn gleichen. Für den Priester ist Christus das vollendete Vorbild der Liebe, vor allem in seinem Opfer. Wenn der Priester den Altar verlässt, müsste er nach dem Beispiel seines göttlichen Meisters bereit sein, sich vorbehaltlos den Menschen zur Verfügung zu stellen. Ihnen soll er seine Zeit, seine Kräfte, sein Leben weihen, durch seine Hingabe soll auch er sich verzehren lassen.
Wenn wir mit Christus die «cura animarum - Seelsorge» teilen, müssen wir uns immer mehr unserer Verantwortung für die Herde Christi bewusst werden. Ob der Priester Kaplan, Pfarrer oder Professor, Ordensoberer oder Bischof ist, er muss sich selbst vergessen und sich gleich dem Guten Hirten unaufhörlich verschenken. So wird unser Leben Gott überaus wohlgefällig.
Der Eifer des hl. Paulus soll uns Vorbild sein. Der Ursprung des Feuers, das im Apostel brennt, ist die Liebe Christi. «Die Liebe Christi drängt uns» (2 Kor 5, 14). Die Betrachtung der Hingabe des Erlösers machte es ihm unmöglich, fernerhin seinen eigenen Interessen zu leben, und zwang ihn sozusagen, «nicht für sich selbst zu leben, sondern für den, der für ihn gestorben und auferstanden ist» (Vgl. 2 Kor 5, 15). In dieser Gesinnung rief er aus: «Ich will mit Freuden Opfer bringen, ja mich für eure Seelen aufopfern» (2 Kor 12, 15).
Am Tag der Priesterweihe hat Christus uns auserwählt: «Ich habe Euch erwählt.» Und wozu? «Damit ihr Frucht bringet» (Joh 15, 16). Wenn der Priester nicht von dem glühenden Wunsch erfüllt ist, die Seelen mitzureißen, wenn er sich nur mit seinen eigenen Angelegenheiten befasst, dann ist seine Haltung falsch. Er hätte Laie bleiben, sich für die Wissenschaft, für öffentliche Angelegenheiten, für seine persönlichen Arbeiten interessieren können, ohne sich den Kopf zu zerbrechen, ob sein Leben den Seelen nütze. Aber wenn er einmal Priester geworden ist, «Denn jeder Hohepriester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott» (Hebr 5,1), darf es für ihn nur eine Aufgabe geben: die Menschen zu Gott zu führen, ihnen Christus zu geben; und all sein Streben muss auf dieses einzige Ziel gerichtet sein.
2. «Die Liebe stammt von Gott»
Die Nächstenliebe, wie sie im Neuen Testament vor unsere Augen gestellt wird, gehört zur übernatürlichen Tugend der Liebe.
Zwei erhabene Vorzüge charakterisieren sie; der erste: sie ist eine Gabe Gottes und eine Teilnahme an seiner eigenen Liebe zu uns; und der zweite: die Übung der Nächstenliebe bleibt nicht bei den Menschen stehen; in ihnen findet man Christus; in jedem seiner Glieder ist er selbst der Gegenstand unserer Liebe.
Der hl. Johannes wird nicht müde, uns über den ersten der beiden Vorzüge zu belehren: «Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe stammt von Gott. Wer Liebe hat, hat sein Leben aus Gott» (1 Joh 4, 7). Nach dem Lieblingsjünger wird uns die Liebe durch eine göttliche Mitteilung verliehen; wenn sie in der Seele erwacht, vereint sie diese mit Gott und macht sie ihm ähnlich. - Und er fährt fort: «Gott ist die Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm» (1 Joh 4,16). So eng sind Gottesliebe und Nächstenliebe verbunden, dass sie im selben Gebot befohlen werden: «Wir haben das Gebot von ihm: Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben» (1 Joh 4,21). Die Nächstenliebe gehört also wesentlich zur Gottesliebe.
Die Theologie drückt diese Wahrheit aus, wenn sie erklärt, dass es nur eine einzige Tugend der Liebe gibt, die den Christen befähigt, Gott und den Nächsten zugleich auf übernatürliche Weise zu lieben - «unico habitu».
Dieses Wunder ist möglich, denn wenn die Seele mit Gott vereint ist, gleicht sie sich ihm notwendigerweise an; so erlangt sie die gleiche innere Haltung dem Nächsten gegenüber wie Gott. Sie liebt den Nächsten, weil Gott ihn liebt und wie Gott ihn liebt, mit dem Wunsche, dass er den Herrn verherrlichen und in ihm nach der göttlichen Ordnung seine Seligkeit finden möge.
Die christliche Liebe ist grundverschieden von jeder Art natürlicher Menschenliebe. Diese kann ohne Zweifel nützlich und lobenswert sein, doch sie liebt den Nächsten nicht, um ihn zu Gott zu führen, nicht, wie Gott ihn liebt - «wie ich euch geliebt habe» (Joh 13,34). Sie beschränkt sich auf dieses Leben, während die christliche Liebe die Ewigkeit ins Auge fasst. Philanthropie geht über menschliche Gesichtspunkte und rein natürliche Motive nicht hinaus. Die echt christliche Liebe hingegen ist ganz übernatürlich. Sie betrachtet den Mitmenschen nicht getrennt von Gott; das gleiche Streben, die sie die Unendliche Liebe umfassen lässt, drängt sie auch zur Hochherzigkeit, zum liebenden Dienen an den Menschen. Deshalb fügt der hl. Johannes hinzu: «Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, dabei aber seinen Bruder hasst, so ist er ein Lügner» (1 Joh 4, 20).
Im Gegensatz zum Gesetz der Wiedervergeltung fordert Jesus unerschöpfliche Güte: «Wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, so halte ihm auch die andere hin. Will jemand mit dir rechten und dir deinen Rock nehmen, so lass ihm auch den Mantel. Nötigt dich jemand, eine Meile weit mitzugehen, so geh zwei mit ihm» (Mt 5, 39-42).
Dieses Ideal ist so charakteristisch für das Gesetz des Neuen Bundes, dass Jesus die Nächstenliebe «sein Gebot» nennt: «Das ist mein Gebot» (Joh 15, 12). Es ist das Zeichen, an dem man unzweifelhaft seine Jünger erkennt: «Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt» (Joh 13, 35).
Das Maß, das vollendete Vorbild dieser Liebe finden wir im Herzen Christi. All seine Liebe zu den Menschen hat ihren Ursprung offensichtlich in seiner Liebe zum Vater: «denn sie gehören dir» (Joh 17, 9). Der menschliche Wille des Erlösers war vollkommen dem unveränderlichen Akt ewiger Liebe geeint, mit dem Gott die Menschen liebt: «So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab» (Joh 3,16).
Die Liebe des Herzens Jesu zu uns hat ihre Quelle, ihren Beweggrund und ihr Ziel in Gott selbst.
Jesus ging in seiner Hingabe bis zum äußersten. «Er hat sein Leben für uns dahin gegeben. So müssen auch wir das Leben für die Brüder hingeben» (1 Joh 3, 16). Die Liebe Christi zu den Menschen ist für uns das Vorbild der Liebe in unsern Seelen, die aus Gott stammt. Zweifeln wir niemals daran; das Herz Christi verlangt sehnlichst, in die Herzen seiner Priester einen Funken seiner eigenen Liebe zu senken.
Nur das Herz vermag Herzen zu bewegen. Wir haben nur soweit Einfluss auf die Seelen, als wir sie lieben. Darin liegt die Erklärung für eine überraschende Tatsache: man trifft manchmal Priester, die ihre religiösen Pflichten sehr gewissenhaft erfüllen und deren Wirken doch ziemlich unfruchtbar bleibt. Wenn sich ein Mensch in Not an sie wendet, findet er einen kalten Verstand, Gewissenhaftigkeit, aber kein weites, offenes Herz. Alle Seelen, vornehmlich jene, die von Leid oder Mühen niedergedrückt sind, haben das Recht, beim Priester Verständnis für ihren Kummer zu erwarten. Im Herzen des Priesters müssen daher die Wärme, die Liebe, der Eifer leben, die geeignet sind, die Seelen zu Jesus zu führen. Der Eifer ist nichts anderes als eine Äußerung der Liebe, einer Liebe, die so stark ist, dass sie andere mitzureißen vermag. Wenn wir aus Liebe glühend wünschen, dass das Reich Gottes in den Seelen und in der Gesellschaft herrsche, dann werden wir Worte finden, die trösten, dann werden wir die Sünde bekämpfen, dann werden wir Leiden und Mühen auf uns nehmen und uns ganz hinopfern.
3. Christus im Nächsten lieben
Der zweite Vorzug der christlichen Liebe ist noch erhabener; er erzeugt bei den Heiligen wahre Wunder der Hingabe.
Die Wahrheit, die uns der Glaube zeigt, ist folgende: Christus setzt sich selbst an die Stelle unseres Mitmenschen, damit wir im Nächsten ihn lieben und ihm dienen.
Seit der Menschwerdung identifiziert sich der Herr mit jedem von uns. St. Paulus betont es oft: «Ihr seid der Leib Christi und, als Teile betrachtet, seine Glieder» (1 Kor 12,27). Und weiter: «Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er hegt und pflegt es. So macht es auch Christus mit der Kirche. Wir sind ja Glieder an seinem Leib, Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein» (Eph 5, 29-30). Sind wir aber von seinem Fleisch und von seinem Bein, dann besagt das, dass wir wirklich eins mit ihm sind.
Der Vater sieht uns in seinem Sohn als dessen Glieder; deshalb erweist er uns Barmherzigkeit und schenkt uns die Fülle seiner Gnade. Wenn Gott uns verzeiht, uns an sich zieht, uns heiligt, dann gilt diese grenzenlose Güte letztlich seinem Sohn.
Was ergibt sich für uns aus unserem Einssein mit Christus?Folgendes : Wenn wir uns einander widmen, so ist es Christus, den wir in seinen Gliedern lieben, dem wir in ihnen dienen. Alles, was man für die Glieder eines Menschen tut, erweist man ihm selbst. Wenn ich einen verletzten Finger habe, und jemand verbindet ihn mir, so widmet er seine Fürsorge meiner Person, denn der Finger gehört zu meinem Leib. Das gleiche gilt von den Gliedern Christi; sie sind eins mit ihm. Christus hat sie mit sich vereinigt und er sagt uns: «Was ihr euern Brüdern tut, das habt ihr mir getan.»
Liebe hat Gott bestimmt, dieses Gesetz zu erlassen, und es kann nicht unser Bestreben sein, es zu ändern. Am Tag des Gerichtes wird das endgültige Urteil davon abhängen, wie wir das Gebot der Nächstenliebe beobachtet haben. Christus selbst wird feierlich verkünden: «Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters … Ich hatte Hunger und ihr habt mir zu essen gegeben» … Und die Guten werden staunen: «Herr, wann haben wir dich in Not gesehen?» Und er wird antworten: «Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.» Und zu den Bösen wird er sprechen: «Weicht von mir, ihr Verfluchten.» Warum? Weil sie nicht gebetet, nicht gefastet haben? Nein, aber «ich hatte Hunger, ich hatte Durst, ich war traurig und verlassen, und ihr habt mir nicht geholfen ... Was ihr einem von diesen Geringsten da nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan» (Vgl. Mt. 25, 34-45).
Man wird vielleicht einwenden: Gibt es denn nicht andere Gebote, die wir halten müssen, um unser Heil zu sichern ? Gewiss, aber deren Befolgung nützt nichts, wenn wir nicht das große Gebot der Nächstenliebe beobachten. Deshalb schreibt der hl. Paulus: «Das ganze Gesetz wird in dem einen Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst» (Gal 5,14).
Diese Identifizierung Jesu mit den leidenden Gliedern seines mystischen Leibes kann nicht ein leeres Wort bleiben. Sie drückt eine geheimnisvolle, aber beglückende Wahrheit aus, die geeignet ist, Liebe zu wecken, die uns drängt, dem Nächsten so zu begegnen, als ob er Jesus Christus selbst wäre.
Die Heiligen haben ihr Leben der Liebe geweiht, weil sie an das Geheimnis dieser heiligen Stellvertretung glaubten. Nach dem hl. Benedikt z. B. ist es Christus, dem man in der Person des Obern gehorcht; es ist Christus, dem man Erleichterung schafft, wenn man Kranke pflegt; ihm dient man, wenn man sich andern widmet; die Ehrfurcht, mit der man Gäste empfängt, gilt Christus, dem Pilger (Regel, an verschiedenen Stellen).
Aus der gleichen Erwägung müssen wir unsern Feinden verzeihen können. - Der hl. Johannes Gualbert war vor seiner Bekehrung ein stolzer florentinischer Ritter. Am Karfreitag begegnete er in einem Hohlweg dem Mörder seines Bruders. Schon wollte er sich auf seinen Feind stürzen und Rache an ihm nehmen. Doch der Schuldige warf sich am Weg auf die Knie, breitete die Arme in Kreuzesform aus und bat im Namen des Gekreuzigten um Verzeihung. Johannes Gualbert hielt inne; er sah in dem Mörder das Bild Christi. Die Gnade bemächtigte sich seiner. Er stieg vom Pferd, umarmte seinen Feind und nahm ihn als Bruder an. Erschüttert von dieser Handlung trat er dann in eine nahe Kirche ein, und während er zu Füßen des Kruzifixes betete, sah er, wie Christus ihm mit dem Ausdruck grenzenloser Liebe das Haupt zuwandte.
Dass Christus sich an die Stelle jedes seiner Glieder setzt, ist also keine bloße Annahme, sondern eine der tiefsten Wahrheiten.
Er gießt ihnen das übernatürliche Leben ein, das nichts anderes ist als sein eigenes Leben, das der heiligmachenden Gnade und der Liebe. Die Glieder seines Leibes sind mit ihm vereint wie die Reben mit dem Weinstock.
Wir Priester haben das erhabene Vorrecht, am Altar Christus in unsern Händen halten zu dürfen; doch wenn wir Kälte oder gar Groll gegen den Nächsten in uns aufkommen lassen, ist es Christus selbst, dem diese Bitterkeit gilt. «Wie solltest du nicht gegen Christus sündigen, wenn du eines seiner Glieder beleidigst?» fragt der hl. Augustinus (Sermo 83, 3. P. L. 38, Sp. 508). Aus Liebe zu Christus wollen wir uns vor dem Zelebrieren nicht mit den kleinlichen Ansprüchen unserer Empfindlichkeit und Eigenliebe beschäftigen, sondern jeden freiwilligen Groll aus unserm Herzen verbannen, vorbehaltlos verzeihen. Hat doch Jesus uns befohlen: «Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder» (Mt 5, 24). Es ist, als wollte er sagen: «Bring erst deine Angelegenheiten mit deinem Nächsten in Ordnung; dann komm und opfere deine Gabe.»
Rechnen wir nie auf menschliche Dankbarkeit. Seien wir gütig, ohne eine Vergeltung zu erwarten. Schenken wir allen unsere Liebe; dann wird Christus sich als unser Schuldner fühlen. Alles, was wir seinen Gliedern tun, nimmt er ja an, als hätten wir es ihm selbst getan. Und da er unermesslich reich ist, wird er diese Schuld tausendfach vergüten. Gott handelt in allem mit großer Freigebigkeit; er ist kein kleinlicher Krämer. Er wird uns mit der Fülle seines Segens überschütten. «Gebt, so wird euch gegeben: ein gutes, volles, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß schütten» (Lk 6, 38).
4. Die Kennzeichen der echten Liebe
Der hl. Paulus zählt die Kennzeichen der wahren Liebe auf: Sie ist «geduldig, hilfsbereit, neidlos; sie prahlt nicht, überhebt sich nicht, sie handelt nicht unschicklich, sucht nicht das Ihre, kennt keine Erbitterung, trägt das Böse nicht nach; am Unrecht hat sie kein Gefallen, mit der Wahrheit freut sie sich; alles erträgt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles duldet sie» (1 Kor 13, 4-7).
Prüfen wir, ob wir diese Haltung haben. Am Altar empfangen wir den, der die Liebe selber ist. Diese Begegnung mit Gott sollte unsere Seele täglich mehr von der Selbstsucht befreien.
Echte Liebe ist geduldig, sagt der Apostel.
Der erste Impuls des natürlichen Menschen ist, alles abzuschütteln, was ihm lästig ist; und wenn ihm das nicht möglich ist, wird er unzufrieden oder zornig. Die Liebe erträgt ruhig Widerwärtigkeiten, Leiden, Ungerechtigkeiten, Beleidigungen. Je größer sie ist, desto mehr wächst die Kraft des Ertragens. Unser Erlöser ist das Vorbild dieser Geduld. Als er sich für uns ausgeliefert hatte, spuckt man ihm ins Gesicht, man schlägt ihn, man klagt ihn an; doch wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, «tut er seinen Mund nicht auf», «Jesus aber schwieg» (Mt 26, 63). In der Todesangst am Kreuz betet er, aber er klagt nicht.
Wahre Geduld geht mit Güte Hand in Hand, mit Sanftmut im Denken, im Sprechen, im Handeln. Auch hierin ist Jesus unser Vorbild. Judas kommt, um ihn zu verraten; und er richtet die gütigen Worte an ihn: «Freund, wozu bist du gekommen ?» (Mt 26,50). Die Henker schlagen ihn ans Kreuz, und er bittet um Vergebung für sie: «Vater, verzeihe ihnen, sie wissen nicht, was sie tun» (Lk 23, 34).
Was empfinden wir, wenn man uns Unrecht tut, selbst in kleinen Dingen? Sind wir voll Unwillen und Bitterkeit? Lassen wir Abneigung, Groll in uns aufkommen? Im täglichen Verkehr mit den Mitmenschen brauchen wir viel Geduld. Wenn man mit andern zusammenlebt, geschieht es zuweilen - auch bei Priestern -, dass man sich gegenseitig stört, auf die Nerven geht, ohne dass es einem immer klar zum Bewusstsein kommt. Der hl. Augustinus sagt: «Wir sind sterbliche, gebrechliche, schwache Menschen und tragen irdene Gefäße; man stößt sich gegenseitig.» Und er fügt hinzu: «Doch wenn die Gefäße aus Fleisch sich gegenseitig einengen, soll die Weite der Liebe ihnen Raum geben» (Homil. 69 de Verbis Domini. P. L. 38, Sp. 440). Wenn Heilige an einem Werk zusammenarbeiteten, würden sie wohl einander Schwierigkeiten bereiten wollen? Versuchen wir also, jeder für sich selbst, die Fehler oder auch die kleinen Verkehrtheiten des andern zu ertragen. Sie müssen ja auch die unsern hinnehmen.
Ob Christus, der edelste, feinfühlendste aller Menschen, nicht darunter gelitten hat, während seines öffentlichen Lebens Tag und Nacht mit den rauen galiläischen Fischern beisammen zu sein? Die Jünger liebten ihren Meister sehr, doch oft verstanden sie weder den Sinn seiner Worte noch die Erhabenheit seiner Handlungen.
In der Ausübung unseres Amtes braucht es viel Geduld: im Beichtstuhl, beim Religionsunterricht, im Verkehr mit den gleichgültigen, lauen Pfarreiangehörigen, mit den Sündern. Doch schauen wir stets vertrauensvoll in die Zukunft, haben wir Geduld; säen wir guten Samen und zweifeln wir nicht, dass die Stunde der Gnade einmal kommen wird.
«Benigna est - Er ist gütig.» «Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? ... Dasselbe tun ja auch die Sünder», sagt Jesus (Lk 6, 32-33). Aus der Liebe geht naturnotwendig Eifer hervor; sie drängt zu starkem, hochherzigem Handeln; sie will allen Gutes tun, selbst den Feinden; sie ist gütig und hilfsbereit gegen jeden. «Der himmlische Vater lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen» (Mt 5, 45). So sollen auch wir handeln. Die Sonne aufgehen lassen heißt trösten, helfen, erfreuen; den Sündern wie den eifrigen Christen, dem Kind wie dem Greis liebevoll begegnen.
Ist Jesus während seines ganzen Erdendaseins nicht das vollendete Vorbild dieser Güte? Noch bevor er sein Leben für das Heil der Menschen hingab, schenkte er ihnen sein Herz. Wir ersehen es aus dem Evangelium. Eltern bringen ihm ihre Kinder, damit er ihnen die Hand auflege. Die Jünger wollen sie fortschicken. Doch Jesus spricht: «Lasst die Kleinen zu mir kommen» (Mk 10, 14).
Jesus war gütig gegen alle Leidenden. Wie viele Wunder hat er ihretwegen gewirkt! Gewiss, wir haben nicht die Macht, gleich ihm Kranke zu heilen; doch wir können an seiner Stelle sie besuchen, sie in ihren Peinen trösten, SIe ermutigen, ihre Leiden in übernatürlicher Gesinnung zu tragen.
Der Gute Hirt kennt seine Schafe, er trägt das verirrte Lamm auf den Schultern zurück. Das muss uns Ansporn sein, unsere Herde gut kennen zulernen, uns für ihre Nöte zu interessieren und jede leidende oder verirrte Seele mit Güte zu behandeln. Man soll von uns sagen können, was der hl. Petrus vom göttlichen Meister bezeugte: «Wohltaten spendend ging er umher» (Apg 10, 38).
Doch wenn der Priester Christi allen dienen will, wird er nicht die Ordnung außer Acht lassen, die die christliche Liebe fordert. Ist er mit der Seelsorge betraut, so wird er sich vor allem denen widmen, für die er unmittelbare Verantwortung trägt, und darunter vornehmlich den Verlassensten und denen, die seiner Hilfe am meisten bedürfen. Die Ordnung bei der Liebestätigkeit schränkt die echte Hingabe durchaus nicht ein.
Wenn das christliche Volk die Güte eines Priesterherzens erkennt, nimmt es in allen Prüfungen voll Vertrauen Zuflucht zu ihm. «Man hat keine Angst, zu ihm zu gehen», sagt man gern; «man kann stets auf seine Hilfsbereitschaft zählen.» Von einem Priester, den man nicht um einen Dienst zu bitten wagt - mag er sonst auch ein tadelloses Leben führen, treulich seine Betrachtung und Gewissenserforschung halten -, kann man mit Bestimmtheit annehmen, dass die Liebe Christi noch nicht in ihm herrscht. Verschließt man sein Herz dem Nächsten, dann verschließt man es Jesus.
Die Liebe wirkt sich nicht nur in Taten, sondern auch in Gedanken und Worten aus. Manche neigen dazu, schnell ein ungünstiges Urteil über die Taten und sogar über die Absichten des Nächsten zu fällen. Handeln wir so, dann widersetzen wir uns dem Willen Gottes und dem Vorrecht Christi: «Der Vater hat das Gericht dem Sohn übergeben» (Joh 5, 22).
Nur das Auge Gottes vermag das Innerste des Gewissens zu durchforschen. Er allein weiß, welchen Anteil Unwissenheit, Schwäche, Vererbung, Krankheit, Nervosität an den Fehlern der andern hat; er allein kennt die Verkettung von Ursachen, die eine Seele zu einem Fehler veranlassen. Was uns eine schwere Sünde scheint, wird von Gott mit Rücksicht auf die Umstände oft ganz anders beurteilt.
Auch wer große Geistesschärfe hat, darf sich nicht fähig glauben, das Verhalten anderer richtig zu beurteilen. «Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!» (Mt 7, 1). Wollen wir nicht die Strenge des Herrn herausfordern, dann seien wir barmherzig gegen unsere Mitmenschen. «Wenn eine Handlung hundert Gesichter hat, so muss man sie immer nach dem schönsten beurteilen», sagt der hl. Franz von Sales (Hamon, Vie II, S. 455.). Seien wir also wachsam, damit wir in unsern Urteilen nicht die Liebe verletzen.
Es kann allerdings vorkommen, dass der Priester außerhalb des Beichtstuhls sogar auf Grund seines Amtes verpflichtet ist, öffentlich ein ungünstiges Urteil über das Verhalten eines Menschen abzugeben. Dann muss er diese Pflicht unerschrocken erfüllen; doch er darf sich nie erlauben, die Absicht zu beurteilen.
Die Liebe geht über menschliche Gesichtspunkte und Gedanken hinaus. Das zeigt der hl. Paulus so klar: «Die Liebe trägt das Böse nicht nach. Am Unrecht hat sie kein Gefallen». Im Gegenteil, sie freut sich am Guten, das dem Nächsten zuteil wird.
«Caritas non aemulatur - Die Liebe kennt keinen Neid». Wenn der natürliche Mensch sieht, dass ein anderer ein Vorrecht genießt, ist er unglücklich, als ob er dadurch etwas verlöre, worauf er ein Recht hat. Die Eifersucht kann schwerwiegende Folgen haben. Aus Neid tötete Kain den Abel, aus Neid wurde Josef von seinen Brüdern an Fremdlinge verkauft. Geben wir nie zu, dass dieses Laster in unserm Herzen Wurzel fasse. Aber seien wir auch nicht erstaunt, wenn wir zuweilen Regungen dieser Art verspüren. Das ist menschlich: doch geben wir nicht nach. Auch die Apostel Christi waren gelegentlich aufeinander eifersüchtig. Vor dem letzten Abendmahl, so berichtet der hl. Lukas, «Es entstand unter ihnen ein Streit» (Lk 22, 24): sie stritten - sagen wir es nur ruhig -, «wer von ihnen wohl der Größte sei».
Die Liebe denkt genau entgegengesetzt: sie betrübt sich nicht, wenn sie die Erfolge anderer sieht, sie setzt deren Verdienste nicht herab, sie versucht nicht, ihnen insgeheim zu schaden; sie betrachtet den Nächsten nicht als Rivalen, nicht einmal als Fremden. In der Einheit des Leibes Christi betrachtet sie ihn als einen Bruder, so wie ein anderer sich selbst betrachtet. Deshalb kann der Apostel sagen: «Wer wird schwach, ohne dass ich schwach werde? Wer nimmt Anstoß, ohne dass ich entbrenne?» (2 Kor 11, 29). Und weiter: «Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden» (Röm 12, 15). So denkt echte Liebe.
«Die echte Liebe ist selbstlos, sie vergisst die persönlichen Interessen». Der Priester muss sich bewusst sein, dass er von Gott vor allem dazu erwählt ist, sich für die übernatürlichen Interessen des Nächsten einzusetzen. Bei diesem Werk kann er nicht sich selbst suchen. Wie sagt doch der hl. Paulus ? «Gebildeten und Ungebildeten bin ich verpflichtet» (Röm 1, 14).
Um klarer die Einstellung zu sehen, die der Liebe eigen ist, brauchen wir uns nur an die Theorie des englischen Philosophen Hobbes zu erinnern. Hobbes zeichnet die Idee eines Sozialstaates, in dem jeder alle seine Rechte in Anspruch nehmen kann. Das Ergebnis ist zwangsläufig ein ständiger Kampf unter den Menschen: jeder sieht im Nächsten einen Feind, der ein Hindernis für die Befriedigung seiner Lüste ist. Diese Theorie ist eine Vergötterung der Selbstsucht. Doch es ist gut, sie zu kennen, weil wir auf diesem Hintergrund klarer sehen, wie die Nächstenliebe den Menschen von der Verhaftung an die Wünsche des Ich löst. Die Liebe blickt über die Grenzen der persönlichen Interessen hinaus; sie weitet die Seele. Da sie Gott über alles liebt, vergisst sie sich selbst, um an das Wohl des Nächsten zu denken.
Wer diese Einstellung hat, pocht nicht ständig auf seine Rechte. Er handelt, wie der hl. Benedikt es empfiehlt: «Keiner soll suchen, was ihm für sich selber nützlich scheint, sondern das, was den andern nützt». In Irland ruft man in Augenblicken der Panik ein Witzwort: «Jeder für sich, und den Rest kann der Teufel holen!» Halten wir es lieber mit dem Wort des Apostels: «Gern wollte ich selber mit dem Fluch beladen, fern von Christus sein für meine Brüder» (Röm 9, 3). Hier spricht nicht Selbstsucht, sondern grenzenlose christliche Liebe.
«Die Liebe ist demütig», «Sie ist nicht eitel, nicht stolz». Warum? Weil sie sich hingibt, ohne Ruhm dabei zu suchen, ohne zu wünschen, dass die Welt davon wisse, ohne sich große Verdienste zuzuschreiben. Eine solche Hingabe, die keine eitle Selbstbespiegelung kennt, macht die christliche Liebe der des Gottessohnes ähnlich.
Im ganzen Leben des göttlichen Meisters sehen wir, dass er die Liebe stets in Demut übte; doch nirgends tritt dieser Zug so ergreifend hervor wie beim Letzten Abendmahl, als er vor den Aposteln niederkniete, um ihnen die Füße zu waschen.
Der Priester, der in seinem seelsorglichen Wirken diese Demut nachahmt, «löscht den glimmenden Docht nicht aus und bricht nicht das geknickte Rohr» (Jes 42, 3). Selbst wenn er verpflichtet ist, zu widersprechen, Widerstand zu leisten, abzuwehren, wird er es in so maßvoller Weise tun, wie es nur das Wissen um die eigene Schwachheit und die Liebe eingeben können.
Alle diese Äußerungen der Güte und Liebe sind nur verschiedene Erscheinungsformen einer einzigen, übernatürlichen Tugend, die der Erlöser dieser Welt gebracht hat. Wenn wir sie üben, wie der hl. Paulus sie beschreibt, ahmen wir ohne Zweifel die Barmherzigkeit Jesu nach und durch diese - wenn auch noch so entfernte - Ähnlichkeit gleichen wir uns der Liebe Gottes an.
Um seinetwillen, wie er und kraft seiner Gnade lieben wir den Nächsten.
5. Liebe im Dienst des Wortes
Der Priester bringt den Menschen die Gnade der Sakramente, aber auch die Lehre Christi; ein «Dienst des Wortes» (Apg 20, 24) ist ihm vom Herrn anvertraut worden, er ist beauftragt, die «Lehre Christi» den Gläubigen einzuprägen. Auf der Kanzel, im Beichtstuhl, beim Krankenbesuch, beim Religionsunterricht, überall, selbst bei gewöhnlichen Gesprächen haben die Worte aus Priestermund große Bedeutung für die Entfaltung des religiösen Lebens.
Die Offenbarung ist ein kostbares «Depositum - Vermächtnis», das der Priester in gewisser Weise zu hüten hat. «Timotheus, bewahre das anvertraute Gut! Vermeide unheiliges, leeres Gerede» (1 Tim 6, 20). Der Diener Christi hat die Pflicht, in den Gläubigen das Verständnis für die Größe und Fruchtbarkeit der geoffenbarten Wahrheiten zu wecken. «Der Priester ist verpflichtet zu predigen», heißt es im Pontifikale.
«Gott hat zu uns gesprochen durch seinen Sohn» (Hebr 1, 2). Das Göttliche Wort drückt durch sich selbst die unendliche Vollkommenheit des Vaters aus, aber als Mensch enthüllt es uns die Geheimnisse des göttlichen Lebens in menschlicher Sprache, die unserer geringen Fassungskraft angepasst ist: «Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht» (Joh 1, 18).
Durch Jesus sind also die Gedanken der Ewigen Weisheit für uns verständlich geworden; sie wurden der Welt durch die Heilige Schrift und die Tradition übermittelt. «Diese Worte sind Lebensträger gleich Samen», «Der Samen ist das Wort Gottes» (Lk 8, 2). «Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben» (Joh 6, 63).
Wenn der Priester diese Wahrheiten verkündet, spricht er nicht im eigenen Namen, sondern als Gesandter des Meisters: «Wir sind also Gesandte an Christi Statt» (2 Kor 5, 20). Er gehorcht dem Wort Christi, der gesagt hat: «Geht hin und lehrt» (Mt 28, 19). Durch seinen Mund spricht der Erlöser zu den Menschen (Jes 51,61). Christus hat für die gebetet, die auf ihr Wort hin an ihn glauben werden (vgl. Joh. 17,20). Jeder Priester kann mit dem Apostel sprechen: «Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde!» (1 Kor 9, 16).
Die protestantischen Pastoren predigen zuweilen mit einer Überzeugung, die starken Eindruck macht, aber sie predigen ohne «Auftrag». Uns wurde die Pflicht, den Menschen das Wort Gottes zu bringen, von der Obrigkeit auferlegt. «Gott ist es, der uns mahnt» (2 Kor 5, 20). Der Bischof empfängt seinen Auftrag von der Kirche; wenn er den Priester «sendet», den Menschen die geoffenbarten Wahrheiten zu verkünden, dann ist sein Wort das eines Gesandten Gottes. «Wie kann man predigen, wenn man nicht gesandt ist?» sagt der hl. Paulus (Röm 10, 15).
Was die Predigt betrifft, wollen wir die kurzen, aber überaus wertvollen Richtlinien des hl. Paulus betrachten: «Verkünde das Wort! Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, weise zurecht und ermahne mit aller Geduld und allem Geschick» (2 Tim 4, 2).
Wir können hier diese Richtlinien nicht im einzelnen zergliedern, wollen aber einige Punkte hervorheben.
Der Apostel schreibt zuerst: «Predige». Der Dienst am Wort, den der Herr dem Priester anvertraut hat, besteht vor allem darin, die Frohbotschaft und den Wert des christlichen Glaubens bekannt zu machen: «das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen» (Apg 20, 24). Um diese Aufgabe zu erfüllen, muss sich der Prediger auf gründliches Wissen stützen; das ist unerlässlich. Gut predigt, wer den Geistern Klarheit gibt und die Herzen ergreift.
Um das zu erreichen, sollte sich der Priester mit der Heiligen Schrift vertraut machen. «Alles, was vorzeiten geschrieben wurde, ist zu unserer Belehrung niedergeschrieben. Wir sollen aus der Schrift Geduld und Trost schöpfen und so die Hoffnung bewahren» (Röm 15, 4). Ich glaube, für jede Seele, die Gott aufrichtig sucht, genügt die Lehre, die Christus und die Apostel gegeben haben. Christus und die Überfülle seiner Gnade predigen wird immer wirksam sein.
Überdies ist dem Priester eine gründliche theologische Bildung notwendig, damit er die geoffenbarten Wahrheiten in der Sprache der Kirche erklären kann.
Für junge Priester ist es ratsam, sich wenigsten drei Jahre lang die Mühe zu nehmen, ihre Predigten niederzuschreiben.
«Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen.» - St. Paulus zeigt, welch unermüdlicher Eifer von dem Diener Christi gefordert wird. Sein Gewissen soll ihn immer und überall an die Sendung erinnern, die er empfangen hat. Doch dieser Eifer soll mit Mäßigung und Klugheit gepaart sein; der Priester muss in der Seelsorge stets vernünftig vorgehen. Manchmal muss man jahrelang warten, bis die Stunde der Gnade kommt.
«Überführe, weise zurecht.» - Wir haben nicht das Recht, den moralischen Verfehlungen oder den irrigen Meinungen der Gläubigen gegenüber gleichgültig zu bleiben. Wir sind verpflichtet, den Christen gelegentlich ihren schlechten Lebenswandel vorzuhalten und sie vor Gefahren zu warnen, die ihren Glauben bedrohen. Erfüllen wir diese Aufgabe mit Wachsamkeit, aber gehören wir nicht zu denen, die auf der Kanzel nichts anderes tun, als ihrer Unzufriedenheit Ausdruck geben und alle tadeln. Sie glauben zu Unrecht, das Evangelium verkündet zu haben. Es ist ein Eifer voll Bitterkeit, der sie treibt. Der hl. Jakobus sagt: «Im Zorn tut der Mensch nicht, was vor Gott gerecht ist» (1, 20). Wer so vorgeht, befolgt sicher nicht den Rat des Apostels, der verlangt, man solle «in aller Geduld» predigen.
«Ermahne.» - Der Priester soll die Gläubigen zum Guten ermutigen. Wir können hier nicht die verschiedenen Formen besprechen, die diese Ermahnung haben kann. Jeder muss sich seinen Zuhörern anpassen. Doch vergessen wir nicht, dass die persönliche religiöse Überzeugung des Priesters oft das wirksamste Argument sein wird: «Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet» (2 Kor 4,13). - Oft ist es notwendig, dass der Priester dem Volk zuredet, seinen Lebenswandel zu bessern; und durch eindringliches Bitten wird er mehr erreichen als durch Vorwürfe, auch wenn sie verdient sind. - Es gibt Seelen, die nur durch Güte zu Christus geführt werden können; packen wir sie bei der Geradheit ihrer Gesinnung.
Wenn der heilige Dienst am Wort so erhaben ist, versteht man, wie sehr sich Priester gegen das Ideal verfehlen, die in ihren Gesprächen Bitterkeit zur Schau tragen, die stets mehr geneigt sind, Kritik zu üben als zu trösten und zu helfen. Manche Priester bringen viel Zeit damit zu, sich in ihren Ärger zu vergraben; sie sind immer unzufrieden mit jemandem oder mit etwas, und haben immer zu widersprechen, selbst wenn es sich um eine Autorität handelt. Sie tun es nicht aus Bosheit, es ist eine Schrulle, eine Manie, die man ablegen sollte. Der Liebe Christi ist diese Neigung fremd, die den übernatürlichen Einfluss des Priesters aufs Spiel setzt. Bei der Jugenderziehung wirkt dieser Geist unfruchtbarer Kritik zersetzend, schädigt die Schwungkraft, deren die jungen Menschen bedürfen, um den Lebenskampf zu beginnen.
In jeder Epoche wurden in der Kirche Reformen durchgeführt. Der Niedergang der christlichen Sitten, dogmatische Irrtümer, die Anpassung an neue soziale Bedürfnisse haben sie notwendig gemacht. Diese Neugestaltung soll grundsätzlich nicht von den Gliedern ausgehen, sondern vom Haupt. Die Glieder können solche Maßnahmen anregen und darum bitten; es steht ihnen jedoch nicht zu, anders als in Zusammenarbeit mit der rechtmäßigen Autorität die Initiative zu ergreifen.
Denken wir an die Ereignisse des 16. Jahrhunderts. Die Kirche bedurfte offensichtlich einer Erneuerung. Luther, Zwingli, Calvin und Melanchton wollten eine durchgreifende Änderung herbeiführen, ohne einen Auftrag dazu erhalten zu haben. Ihre Absicht war nicht schlecht; Melanchton z. B. verabscheute die Übertreibungen Luthers und seine unleugbare Ehrlichkeit zwingt zu Achtung. Doch diese Bewegung kam von unten und trennte ganze Völker von der Einheit der Kirche.
Die Neugestaltung wurde vom Konzil von Trient verwirklicht. Diese kam von oben, wirkte vom Haupt auf die Glieder. So war sie von Gott gewollt, und unter der Führung des Heiligen Geistes brachte sie größten Nutzen.
Bemühen wir uns, in unsern Worten und Handlungen «die Einheit in der Liebe» zu wahren. Vermeiden wir um jeden Preis alles, was trennt, was die Kräfte spaltet, sei es in der Kirche, in der Diözese, in der Pfarrei oder in irgendeiner Gemeinschaft, denn das ist nicht mit der Haltung vereinbar, die man vom Priester verlangt.
Zum Schluss wollen wir noch einen Gesichtspunkt von entscheidender Wichtigkeit ins Auge fassen.
«Niemand gibt, was er nicht hat»; wer kein inneres Leben hat, wird niemals den Seelen nützen. Wir können den andern nur vom Überfluss unseres eigenen geistlichen Lebens geben, von der Fülle unserer religiösen Überzeugungen, die wir in Gebet und Betrachtung gewannen: «Comtemplata aliis tradere», wie der hl. Thomas sagt (S. th. II-II, q. 188, a. 6).
Am Tag der Priesterweihe sprach der Bischof im Namen Christi zu uns: «Ich nenne euch nicht mehr Knechte … vielmehr habe ich euch Freunde genannt» (Joh 15, 15). Wenn der Priester der vertraute Freund Jesu ist» so muss es eine Freude für ihn sein, jede Seele, die durch Christi Blut erlöst ist, den Herrn besser kennen und lieben zu lehren. Wer in der Wahrheit lebt und von ihr kündet, dem fehlt es nicht an Beredsamkeit. Ohne tiefe Überzeugung, ohne Vereinigung mit Christus kann man wohl schöne Reden halten, die dem Ohr der Zuhörer schmeicheln und den Prediger überheblich machen; aber das ist auch alles. Warum? Weil wir, um Einfluss auf die Seelen zu gewinnen, mit dem vereint sein und in Abhängigkeit von ihm arbeiten müssen, der die Quelle alles Guten ist. Man kann es gar nicht oft genug sagen: wir sind Werkzeuge der Gnade. Das Werkzeug aber kann nur kraft seiner Verbindung mit der Erstursache wirken; der Pinsel kann Wunder vollbringen, vorausgesetzt, dass er von einem Künstler geführt wird. Die heilige Menschheit Jesu war stets mit der Gottheit vereint; in der Theologie spricht man vom «instrumentum coniunctum divinitati - Werkzeug, das mit der Gottheit verbunden ist». Aus uns selbst sind wir «nicht verbundene Werkzeuge». Vereinigen wir uns darum in Glauben und Liebe mit Jesus Christus, damit er selbst durch unsere seelsorglichen Arbeiten wirke.
Unsere Sendung ist übernatürlich. Einem Priester, der sich ganz seiner Aufgabe widmet, können selbst Gleichgültige und Glaubensfeinde nicht die Ehrfurcht versagen.
Denken wir an den Pfarrer von Ars. Tausende strömten von überallher zu ihm. Warum ? Weil er ein Heiliger war. Gott hat ihn auserwählt, um uns zu zeigen, wie weit der Einfluss eines Priesters reichen kann, der sich selbst vergisst und aus der Gottesliebe lebt.
Und denken wir an den höchsten Akt priesterlicher Liebe, an das andächtig gefeierte Messopfer. Wenn der Priester es darbringt, kann er nicht an sich allein denken. Die Verantwortung für die ihm anvertrauten Seelen liegt ihm am Herzen. So muss er für seine Herde beten, für seine Pfarrei mit ihren verschiedenen Einrichtungen, für seine Diözese, für die ganze Kirche; und von dem Kelch des Segens, den er konsekriert, werden Fluten des Erbarmens und der Gnade sich über die Seelen ergießen, auch über die fernsten.
Jesus hat auf Kalvaria unsere Angst und unsere Schmerzen getragen. Er war der Gute Hirt, der sein Leben für alle seine Schafe hingab.
Wenn der Priester am Altar den Kelch aufopfert, vereinigt er sich mit dem Erlösungswerk Christi und schließt wie sein Meister in allumfassender Liebe die vielfachen Nöte der Menschheit ein: «Wir opfern Dir, Herr, den Kelch des Heiles … und der ganzen Welt zum Heil, emporsteige wie lieblicher Wohlgeruch»
B. BESTELLT FÜR DIE ANGELEGENHEITEN DER MENSCHEN BEI GOTT
XI. «TUT DIES ZU MEINEM ANDENKEN ...»
Unsere Heiligung schreitet in dem Maße voran, als wir die Tugenden üben, die unser Stand in besonderer Weise von uns verlangt. Das tun wir durch Erfüllung der Pflichten unseres Amtes als Mittler: durch die gottesdienstlichen Handlungen und durch das geistliche Leben. Der Apostel lehrt: «Jeder Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen in ihren Angelegenheiten bei Gott bestellt» (Hebr 5, 1).
Gewiss, diese Akte sind in sich selbst heilig. Sagen wir nicht: die Heilige Messe, die heilige Kommunion? Und warum? Weil uns diese Handlungen in unmittelbare Verbindung mit der Quelle aller Heiligkeit bringen. Das gleiche gilt, wenn auch in geringerem Maße, vom Offizium, vom Privatgebet, von den gewöhnlichen Arbeiten des Alltags.
In den folgenden Kapiteln werden wir sehen, welches die wichtigsten Handlungen sind, die der Priester jeden Tag neu vollziehen soll. Eine vertiefte Kenntnis ihrer Eigenart und des übernatürlichen Nutzens, den sie bringen, wird uns bei der Arbeit an unserer Vervollkommnung eine wirksame Hilfe sein.
Unter den göttlichen Dingen («ea quae sunt ad Deum»), nennt der hl. Paulus in erster Linie das heilige Opfer. Und mit Recht.
Das Sakrament der Priesterweihe wurde eingesetzt mit der Absicht, Menschen die Macht zu verleihen, den Leib und das Blut Christi zu konsekrieren. Die Mitteilung dieser Macht ist das Wesentliche bei der Handauflegung.
Wenn der Priester das «mysterium fidei - Geheimnis des Glaubens» feiert, vollzieht er nicht nur eine der vielen Funktionen, die mit seiner Würde verbunden sind, sondern ihren wesentlichen Akt. Dieser Akt steht höher als jede andere Amtshandlung, sei sie kultischer oder seelsorglicher Art. Darum soll das Leben des Priesters ein Weiterklingen, eine Verlängerung des Messopfers sein (Siehe in: «Christus, das Leben der Seele» das Kapitel: »Das eucharistische Opfer», und in «Christus in seinen Geheimnissen» das Kapitel: «In mei memoriam».).
Um geziemend über das heilige Opfer sprechen zu können, müsste man ein Engel sein, nicht ein Mensch; und selbst ein Engel vermöchte nicht die ganze Erhabenheit des eucharistischen Geheimnisses zu erklären, denn Gott allein weiß die Hinopferung eines Gottes in ihrer vollen Bedeutung zu erfassen. «Wenn wir verständen, was eine Messe ist, stürben wir vor Liebe», sagte der heilige Pfarrer von Ars (Der Ausspruch des Heiligen lautet wohl: «Der Priester wird erst im Himmel richtig verstanden werden ... Wenn man ihn auf der Erde verstände, würde man darob sterben, nicht vor Schrecken, sondern vor Liebe.» (Esprit du curé d'Ars, S. 113, zitiert bei Abbé Trochu, Le curé d'Ars, S. 110).
Dennoch ist es sehr wertvoll für uns, wenn wir die Erhabenheit der Heiligen Messe erwägen: sie ist der Mittelpunkt des ganzen Lebens der Kirche und der Ursprung zahlloser Gnaden; sie ist die geheimnisvolle Quelle, deren Wasser der himmlischen Stadt Fruchtbarkeit verleihen, wie der hl. Johannes es in der Apokalypse beschreibt (22,1-2).
Die Wirkungen dieses göttlichen Geheimnisses in unserer Seele hängen zu einem Großteil von unserm Glauben und unserer Andacht ab: «Quorum tibi fides cognita est et nota devotio.»
Damit unser Glaube immer lichtvoller werde, wollen wir die Lehre der Kirche erwägen; im Gebet mögen wir dann die gewonnenen Erkenntnisse vertiefen.
Wenn es um das Messopfer geht, ist es besser, die reine Lehre der Kirche aus den authentischen Quellen zu schöpfen, als sich bei persönlichen theologischen Auffassungen aufzuhalten. Vergessen wir nie, dass Gott alles, was von seinem freien Wollen abhängt, in ganz anderer Weise hätte anordnen können. Um seine Absichten zu verstehen, müssen wir die Offenbarung befragen, denn nur sie kann uns seine Gedanken und seine Pläne enthüllen. Auf diesem Gebiet können wir niemals etwas mit Sicherheit aus uns selbst erkennen.
Was Gott geoffenbart hat, finden wir in der Heiligen Schrift und in der Tradition. Diese beiden Quellen sind nicht immer leicht zu deuten; deshalb fallen die Protestanten, bei denen jeder nach eigenem Gutdünken darüber urteilen darf, so leicht in Irrtümer. Doch wenn der Heilige Vater oder ein Konzil eine Definition geben, sind wir der Wahrheit sicher, denn die Kirche steht unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ihre Lehre ist die unmittelbare Richtschnur unseres Glaubens: «Regula proxima fidei - nächste Regel des Glaubens».
Auch die heilige Liturgie gibt Zeugnis von den Gedankengängen der Braut Christi. In ihren Gebeten spricht die Kirche ihre Glaubensüberzeugung aus und weist auf den Sinn der Worte hin, mit denen die Heilige Schrift und die echte Tradition über die Eucharistie sprechen. In der Schule der Liturgie gleichen wir kleinen Kindern, die von der Mutter beten lernen. Das gilt vornehmlich von der Messe. Sie ist die Sonne der christlichen Gottesverehrung; die Worte und Riten, mit denen die Kirche die Feier des heiligen Opfers umgibt, helfen uns ganz wunderbar, seine Größe zu erfassen.
Von allen Konzilien hat das von Trient am ausführlichsten und genauesten die traditionelle Lehre über das Messopfer klargestellt.
Die Grundwahrheiten, die das Konzil darlegte, sind bekanntlich folgende: Die Messe ist ein «wahres und wirkliches Opfer» (Sess. XXII, can. 1). Im Gegensatz zu den Reformatoren des 16. Jahrhunderts müssen wir in ihr mehr sehen als eine bloße Erinnerung an das Letzte Abendmahl des Herrn; sie ist nicht nur eine einfache Huldigung an Christus unter den heiligen Gestalten, noch eine bloß symbolische Darstellung seines Todes, sondern ein «wahres und wirkliches Opfer».
Ferner: Die Messe schließt die gleiche Opferung in sich, wie sie auf Kalvaria vollbracht wurde. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Opfern liegt in der Art der Darbringung: auf unsern Altären, so erklärt das Konzil, «setzt sich der gleiche Christus gegenwärtig und opfert sich in unblutiger Weise, der sich am Altar des Kreuzes in einem einmaligen blutigen Opfer dargebracht hat» (Sess. XXII, cap. 2).
Die Messe erneuert nicht die Erlösung, aber durch die sakramentale Hinopferung setzt sie durch alle Zeiten die Darbringung dieses einzigen Opfers fort und «wendet uns in Überfülle dessen Früchte zu» (Sess. XXII, cap. 2).
1. Die Natur des Opfers
Das Opfer ist ein Akt der Gottesverehrung, durch den wir die unendliche Majestät Gottes und seine Oberherrschaft über uns anerkennen. Gott ist ewig, allmächtig, der höchste Herr. Wir sind seine Geschöpfe; er hat uns aus nichts erschaffen, und wenn die Stunde des Todes kommt, kehren wir zu ihm zurück, mögen wir uns noch so sehr dagegen sträuben. Wahrhaftigkeit, Ordnung und Gerechtigkeit verlangen, dass wir die Macht Gottes, der Herr über Leben und Tod, Ursprung und Ziel aller Dinge ist, anerkennen.
Gewiss, auch rein innere Akte der Anbetung, der Danksagung, der Reue, durch die der Mensch seine völlige Abhängigkeit anerkennt, werden von der Heiligen Schrift oft in weiterem Sinn «Opfer» genannt: «Ein zerknirschtes Herz ist ein Opfer vor Gott» (Ps 50, 19).
Doch im eigentlichen Sinn ist das Opfer ein äußerer Akt der Gottesverehrung; es ist der sichtbare Ausdruck der inneren Huldigung, die Gott allein zukommt. Darum hat es so große Bedeutung, wenn der Kult Gott in Gemeinschaft erwiesen wird.
Man kann die Muttergottes, die Engel, die Heiligen und sogar Menschen durch Zeichen der Ehrfurcht, durch Gaben ehren. Doch es gibt eine höchste religiöse Handlung, die das Nichts des Geschöpfes bezeugt vor «Dem, der ist» (Ex 3, 14). Das ist die Zerstörung einer Sache, ein heiliger Ritus, durch die die unumschränkte Oberherrschaft der Gottheit über den Menschen angezeigt wird. Der Mensch fühlt sich von Natur aus gedrängt, Gott diese Huldigung zu erweisen. Obwohl diese menschliche Handlung geheimnisvoll ist, symbolisiert sie mehr als jede andere die Souveränität Gottes. Nach dem Naturgesetz ist das Opfer der wichtigste Akt der Gottesverehrung.
Die mosaische Religion kannte zahlreiche und verschiedenartige blutige Opfer. Alle wurden in der Absicht dargebracht, Gott gnädig zu stimmen; manche bezweckten vor allem Sühneleistung, andere hatten vorwiegend den Charakter der Anbetung oder der Danksagung; doch alle stellten das Kreuzesopfer dar. Aus sich selbst waren sie nach dem Wort des hl. Paulus nichts als «kraftlose und armselige Elemente» (Gal 4,9). «Alles, was ihnen widerfuhr, war vorbildlich» (Siehe die Ausführung Dom Marmions über den Symbolismus der beiden Testamente in «Présence de Dom Marmion», Paris, Desclée, 1948), (1 Kor 10,11), es waren «nur Schattenbilder des Künftigen» (Kol 2,17). Darum mussten die Hebräer, als sie Ägypten verließen, die Türen ihrer Häuser mit dem Blut des Osterlammes bestreichen, und dieses Zeichen bewahrte die Erstgeborenen vor dem Tod. «Kann das Blut eines Tieres den Menschen retten?» fragt der hl. Johannes Chrysostomus. Und er antwortet: «Ja, doch nur, weil es das Blut Jesu symbolisiert» (Homilia ad Neophytos, Editio Basiliensis, 1539, V, S. 459).
Auch die Messe war in den Opfern des Alten Bundes angekündigt und vorgebildet. Sie ist, wie das Konzil sagt, «deren Vollendung und Erfüllung» (Sess. XXII, cap. 1). Das bedeutet, dass die Anbetung, die Sühneleistung, die Danksagung, die in den Opfern der Patriarchen und im mosaischen Kult liegt, voll und ganz, doch auf erhabenere Weise im Geheimnis unserer Altäre fortgesetzt wird.
2. Der Sühnecharakter des Kreuzesopfers
Um die Erhabenheit der Messe zu erfassen, gehen wir im Geiste auf den Kalvarienberg und betrachten die Hinopferung Jesu.
Aus Liebe ist er da, aus Liebe hängt er am Kreuz. Beten wir in ihm den Hohenpriester an, «heilig, schuldlos, rein, nicht aus der Reihe der Sünder» (Hebr 7, 26). Er ist das heilige Schlachtopfer; da er unser Bruder wurde, hat er alle unsere Sünden auf sich genommen.
War dieses Opfer wirklich eine Sühne? Ohne Zweifel. Was bedeutet das Wort? Man spricht von einem Sühnopfer, wenn auf Grund einer sakralen Hinopferung die Haltung der Gottheit gegenüber den Menschen geändert wird: vom Zorn zum Wohlwollen, zu Milde, Verzeihen und Versöhnung geneigt.
Erinneren wir uns z. B. eines denkwürdigen Sühnopfers, von dem das Alte Testament berichtet, das des Noe nach der Sündflut. Wie die Genesis berichtet, hatte Gott wegen der Bosheit der Menschen beschlossen, ihr Geschlecht zu vernichten. Doch Noe und die Seinen wurden gerettet. Als er die Arche verließ, errichtete er einen Altar aus Stein und opferte, umgeben von seinen Söhnen, dem Herrn «reine Tiere». Und die Heilige Schrift sagt, Gott habe seine Haltung geändert. «Als der liebliche Duft zum Herrn emporstieg, sprach der Herr bei sich: 'Ich will die Erde nicht mehr um des Menschen willen verfluchen'» (Gen 8, 21). Und zum Zeichen der Verzeihung ließ Gott seine Sonne erstrahlen und den Regenbogen leuchten; dadurch bezeugte er, dass er seine Schöpfung aufs neue in Gnaden aufnahm (Gen 9, 13-20).
Das Opfer des Noe und die des mosaischen Gesetzes waren nur ein schwaches Abbild des Kreuzesopfers. Dieses war in hervorragender Weise wahres Sühnopfer. Es war die Hinopferung eines Gottes an einen Gott. St. Paulus schreibt: «Er, der in Gottesgestalt war, erachtete sein gottgleiches Sein nicht für ein Gut, das er mit Gewalt festhalten sollte. Vielmehr entäußerte er sich ... und ward gehorsam bis zum Tod» (Phil 2, 6-8). Durch seine Unterwerfung und seine Liebe bot Christus dem Vater eine vollkommene Genugtuung für die Beleidigungen, die seiner Majestät durch die Verfehlungen und die Bosheit der Welt zugefügt werden.
Diese Huldigung, die Gottes würdig war, wurde vorbehaltlos angenommen, denn sie war vom Vater in den barmherzigen Plänen seiner Weisheit und Güte nicht nur vorhergesehen, sondern auch vorbereitet worden. Darum konnte der Apostel sagen: «Es hat Gott gefallen, die ganze Fülle in ihm wohnen zu lassen, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, was auf Erden und was im Himmel ist, indem er durch sein Blut am Kreuz Frieden stiftete» (Kol 1, 19-20). Und ferner: «Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt» (2 Kor 5, 19). Und an anderer Stelle: «Wir wurden durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt» (Röm 5, 10).
Hat Jesus nicht beim Letzten Abendmahl versichert, dass durch sein Blut «ein neuer und ewiger Bund» besiegelt werden würde? Ihm verdanken wir es, dass uns Gott nun für immer verzeihend, liebend und erbarmungsvoll zugewandt ist.
Das Kreuzesopfer war also unzweifelhaft ein Sühnopfer (Siehe auch S. 29 ff).
3. Die Messe, ein Sühnopfer
Das eucharistische Opfer ist die sakramentale Weiterführung des Kreuzesopfers. «Jedes Mal, wenn wir die heiligen Geheimnisse feiern, «verkünden wir den Tod des Herrn (1 Kor 11,26). Das Konzil von Trient erklärt den Sinn dieses Pauluswortes: «Es ist derselbe (Christus), der sich gegenwärtig durch die Vermittlung seiner Priester opfert, er, der sich einst selbst am Kreuze opferte» (Sess. XXII, cap. 2).
Suchen wir die Bedeutung dieser Worte zu erfassen, so wird uns der Sühnecharakter der Messe ganz klar werden.
Für Gott gibt es weder Vergangenheit noch Zukunft. In unveränderlicher Gegenwart besitzt er sein ganzes, unendliches Leben, das in Erkennen, Liebe und Seligkeit besteht. Der hl. Thomas (S. th. I, q. 10, a. 1) übernimmt die klare Definition des Boethius über die Ewigkeit: «Interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio - den Zusammenbesitz der vollkommnen Fülle des Seins und des Lebens in sich selbst.» Das bedeutet, dass Gott in einem «Nunc stans», d. h. in einem Jetzt, das alle Grenzen und alle Aufeinanderfolge übersteigt, «in vollkommener, vollständiger und stets gegenwärtiger (tota simul) Weise die Fülle eines Lebens ohne Anfang und ohne Ende besitzt». - Wir kennen nur eine Aufeinanderfolge; das Leben wird uns nur Augenblick für Augenblick gegeben. Deshalb misst man es durch die Zeit. Doch Gott betrachtet in seiner Ewigkeit mit einem einzigen Blick die aufeinanderfolgenden Ereignisse, die für den Menschen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bilden.
Bei der Konsekration ist das ganze Drama von Kalvaria - mit allen Leiden und Demütigungen, die Jesus dort erduldete - vor Gott gegenwärtig. Wir breiten dieses heilige Geschehen vor den Augen des Ewigen aus; deshalb sagt der Apostel mit Recht, dass wir durch jede Messe (dem Vater) den Tod seines Sohnes künden.
Erinneren wir uns an die Geschichte der Brüder Josefs (Gen 37, 31-32). Nachdem sie sein Verderben beschlossen und ihn an Fremdlinge verkauft hatten, durchtränkten sie sein Gewand mit Blut und sandten es Jakob, um ihm damit den Tod seines Sohnes anzuzeigen.
Jedes Mal, wenn der Priester zelebriert, bietet er dem Vater als Beweis für die Leiden des Erlösers nicht dessen Gewand dar, sondern unter den heiligen Gestalten den Sohn selbst, der aus Liebe eine wahre, wenngleich sakramentale Hinopferung vollzieht.
Verweilen wir manchmal bei diesem Gedanken. Was sieht der ewige Vater auf dem Stein, auf dem das heilige Opfer dargebracht wird? Den Leib und das Blut seines vielgeliebten Sohnes (Kol 1, 13). Und was tut der Sohn auf dem Altar? «Er verkündet seinen Tod - Annuntiat mortem» : er stellt dem Vater seine Liebe, seinen Gehorsam, seine Leiden, die Hingabe seines Lebens vor Augen. Und der Vater wendet sich in Barmherzigkeit uns zu.
Viele liturgische Formeln sprechen den Sühnecharakter des eucharistischen Opfers aus.
Wenn der Priester beim Offertorium den Kelch hebt, bittet er mit den Worten der Kirche, der Herr möge ihn der ganzen Welt zum Heil gereichen lassen: «Für uns und dem Heil der ganzen Welt.» Wenn nach der Konsekration sich der Leib und das Blut Jesu auf dem Altar befinden, bitten wir den Vater, er möge «mit gnädigem und mildem Angesicht» auf unser Opfer blicken.
Dieser Gedanke kommt ganz klar in einem Gebet «super oblata» zum Ausdruck: «Herr, sieh gnädig auf Dein Volk, sieh gnädig auf die Gaben; versöhnt durch dieses Opfer schenke uns Verzeihung und erfülle unsere Bitten» (Sekret vom 13. Sonntag nach Pfingsten. Siehe auch die Sekret der Messe am Fest der hl. Cäcilia).
Das Opfer des Gottessohnes auf Kalvaria war so heilig und seine Sühnekraft war so groß, dass die Untat der Henker, ihr Hass, ihre Gotteslästerungen den Wert dieser heiligen Handlung nicht vermindern, den Triumph der Erlösung nicht verhindern konnten. Das gleiche gilt für das Opfer unserer Altäre. «Keine Unwürdigkeit, keine Makel, die dem Priester anhaften, kann es beflecken», erklärt das Konzil von Trient (Sess. XXII, cap. 1).
Beleben wir oft unsern Glauben an die Erhabenheit der Messe. Für viele zählen auf dieser Erde nur finanzielle, industrielle und geschäftliche Fragen, die politischen Ereignisse. Diese Dinge haben ihre Bedeutung; sie sind ein Teil unseres zeitlichen Lebens. Doch in den Augen des Glaubens gehört das Messopfer einer Ordnung von unendlich höherem Wert an: es verherrlicht Gott auf das vollkommenste. Viele sind unfähig, diese Wahrheit zu erfassen; sie werden unsere Worte übertrieben finden. Doch im Jenseits, wenn wir die Wirklichkeit schauen, werden sie verstehen, dass nur jene menschlichen Handlungen wahrhaft groß sind, die Ewigkeitswert haben.
Man spricht zuweilen gedankenlos mit Geringschätzung über einen Priester, der «seine Messe liest» und sich kaum einer nützlichen Arbeit widmen kann. Und doch, vor den Augen der Unfehlbaren Wahrheit vollbringt dieser Priester, einzig und allein durch eine andächtig dargebrachte Messe, auch wenn ihr niemand beiwohnt, ein göttliches Werk, denn er ehrt den höchsten Herrn und stimmt ihn gnädig gegen das Elend der ganzen Welt.
4. Die Messe als Lobopfer und Danksagung
Die Messe ist nicht nur Sühnopfer, sondern auch Lobpreis und Danksagung: «Opfer des Lobes und der Danksagung» (Sess. XXII, can. 3.).
Der Kultus des reinen Lobpreises, den wir Gott darbringen, lässt verschiedene Arten der Huldigung zu. Warum? Weil der Herr aller Anbetung, aller Verherrlichung und aller Danksagung würdig ist. Vereint mit der Genugtuung, die Jesus der göttlichen Gerechtigkeit leistet, bildet diese Huldigung den Hauptzweck des Opfers. Deshalb wiederholt die Messlitugie so oft die Worte: «Ehre sei dem Vater ... Wir beten Dich an und preisen Dich ... Lob sei dir Christus. Dank sei Gott.» Die Antwort des Ministranten nach dem «Betet Brüder - Orate fratres» weist klar auf dieses Ziel hin: «Der Herr nehme das Opfer an zur Ehre und Verherrlichung seines Namens.» Unser Nutzen, auch der für das geistliche Leben, und der Nutzen für die Kirche kommen erst in zweiter Linie.
Im Himmel wird die Liturgie nichts kennen als bewundernden Lobpreis, Liebe, Freude. Das Opfer Jesu wird sicherlich in seiner Wirksamkeit stets erhalten bleiben; nur er erlöst und beseligt die Auserwählten; doch die Sühne, die Bitte um Verzeihung als solche wird es nicht mehr geben. In der Apokalypse beschreibt der hl. Johannes diese himmlische Liturgie. Er sah das geschlachtete Lamm vor dem Thron Gottes liegen. Es war von Greisen umgeben und von der zahllosen Menge der Auserwählten, die durch sein Blut gerettet sind; und sie sangen: «Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt Lob, Ehre, Ruhm und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit» (5,13). Durch die Schleier dieser Symbole sollen wir die Herrlichkeit der jenseitigen Wirklichkeit ahnen.
Jede Messe auf Erden nimmt an der Liturgie des Himmels teil. Der Sohn Gottes, der Logos, erweist im Schweigen der Hostie seinem Vater eine unfassbare Verherrlichung. Sie übersteigt unser Fassungsvermögen; sie ist unergründlich. Doch wir dürfen dem Vater diesen Lobpreis darbringen, denn so ist es ihm wohlgefällig; ist doch der Sohn der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters: «er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens» (Hebr 1, 3).
Dennoch ist es unsere erste Pflicht bei der Heiligen Messe, uns mit dem Lobpreis zu vereinen, den Jesus in seiner heiligen Menschheit darbringt. Dieser Lobpreis ist die Verherrlichung der Dreifaltigkeit durch jenen, der allein ihr kraft der hypostatischen Union im Namen der ganzen Kirche eine Ehrung von unendlicher Erhabenheit erweisen kann.
Wir kennen die wesentlichen Huldigungsakte beim Opfer; sie alle müssen die Anbetung zur Grundlage haben. Sind wir nicht arme Geschöpfe, Elende, die alles von der Hand Gottes empfangen müssen? Von ihm erhalten wir Sein und Leben; aus uns sind wir nichts. Wollen wir in der Wahrheit bleiben, müssen wir unaufhörlich anbetend lobpreisen, bewundern, danksagen. Von den seligen Geistern sagt uns die Liturgie: «Es loben Dich die Engel, die Herrschaften beten dich an, es zittern die Gewalten.» Tremunt, «sie zittern»; und doch sind es Engel, reine Geister, die nicht gesündigt haben; aber sie sehen die göttliche Majestät und beugen sich vor ihr.
Wenn Gott den Schleier höbe, der uns die Erhabenheit des Geheimnisses verhüllt, das auf dem Altar gefeiert wird, würden wir, wie Moses, «nicht die Augen zu ihm zu erheben wagen», «Er fürchtete sich, Gott anzuschauen» (Ex 3,6). Und was lehrt die Kirche? «Unser Glaube soll uns lehren, was das Auge nicht erkennt - Praestet fides supplementum sensuum defectui» - der Glaube setzt uns das Übernatürliche so gegenwärtig, wie es durch die Anschauung geschehen würde. Bei manchen Heiligen, bei Philipp Neri z. B., war dieser Glaube so lebendig, dass er den Schleier des Geheimnisses durchdrang und die Wirklichkeit erfasste.
Die Messe ist auch in hervorragender Weise «Eucharistie», eine herrliche Danksagung. Die Urchristen bezeichneten sie am liebsten so.
«Der Herr selbst hat eine göttliche Gabe in die Hände seiner Kirche gelegt», «Wir opfern ... von deinen Geschenken und Gaben». Wenn wir dem Vater den Leib und das Blut Jesu darbringen, vollziehen wir ein Dankesopfer und diese Danksagung wird immer angenommen.
Edle Seelen fühlen sich gedrängt, ihre Dankbarkeit zu zeigen; andere hingegen sehen nur sich selbst, sie glauben Anrecht auf alles zu haben und danken für nichts. Ein Mensch, der zugleich großmütig und demütig ist, leidet sozusagen ständig unter dem Wunsch, seiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Die hl. Theresia hatte «ein Herz, weit wie der Sand am Meeresufer», sagt der das Eingangsgebet ihrer Eigenmesse: «Dedit ei Dominus latitudinem cordis quasi arenam quae est in littore maris»; ihr Verlangen, dankzusagen, war so stark, dass es ihr schier das Herz brach. Auch in den Schriften der hl. Gertrud finden wir diesen Zug. Gern erinnerte sie die heiligste Dreifaltigkeit an die Gnaden, mit denen sie von ihrer Kindheit an überhäuft worden war (Der Gesandte der göttlichen Liebe, II). Ihre schöne Gebetssammlung «Exercitia spiritualia» ist ein einziger Hochgesang der Dankbarkeit.
Die großen Heiligen ahmten darin nur ihren Bräutigam nach. Christus hatte das edelste Herz, das jemals existierte. Er sagte dem Vater während seines Erdenlebens Dank und tut es noch immer. Er dankte ihm vor allem dafür, dass die Person des Göttlichen Wortes von seiner Menschheit Besitz ergriffen hat; sie gehört ihm an und hat Anteil an seiner Herrlichkeit; für die Gnade der hypostatischen Union schuldet der Mensch Jesus Gott mehr Dank als die ganze Menschheit.
Jesus dankte dem Vater auch in unserm Namen als unser Haupt und Erlöser. «Er frohlockte im Heiligen Geist», sagt der hl. Lukas (10, 21-22) und sprach: «Ich preise Dich, Vater, ... dass Du dies vor Weisen und Klugen verborgen, Kleinen aber geoffenbart hast. Ja, Vater, so hat es Dir gefallen.» Und was tat er, als er das Sakrament der Eucharistie einsetzte? «Es sagte Dank, brach es.» Bei der wunderbaren Brotvermehrung, die ein Sinnbild der Eucharistie war, sowie vor der Auferweckung des Lazarus dankte er dem Vater. Hier gewinnen wir Einblick in das Geheimnis seines Innenlebens.
Wir verdanken Gott alles: das Leben, die Annahme an Kindes Statt, das Priestertum. Wenn wir die Präfation beten, denken wir an alle die Gnaden, die uns vom Kreuz zufließen, aus denen wir Zuversicht und übernatürliche Freude schöpfen. «Er sagte immer und überall Dank!» Die Präfation muss uns stets die große Weite des Glaubens vor Augen stellen. Danken wir dem Herrn, dass er uns das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit enthüllt, dass er uns Christus gegeben hat und dass er uns erlaubt, Unsere Liebe Frau zu preisen.
Vereinigen wir uns in diesem Augenblick mit den Engeln, «die wie wir Gott nur durch Christus Ehre und Dank erweisen», «Per quem maiestatem tuam laudant angeli.»
An den Festtagen des Kirchenjahres muss unser Herz von Dankbarkeit erfüllt sein für die Herrlichkeit Jesu und für die Gnaden, die seiner Mutter, den Heiligen, der Kirche und uns selbst gewährt wurden. So wird das Messopfer die beste Weise der Danksagung für uns sein.
5. Die Teilnahme der Gläubigen am Opfer Christi
Betrachten wir wiederum den Ursprung aller Vorrechte, die wir als Christen besitzen: die Taufe.
Auf Grund des Taufcharakters kann der Christ aktiven Anteil an der Gottesverehrung der Kirche nehmen. Diese Gottesverehrung gehört der übernatürlichen Ordnung an; Christus ist ihr Hoherpriester, das Messopfer ihr Brennpunkt und Zentrum. Deshalb gibt der hl. Petrus der Gesamtheit der Gläubigen die Bezeichnung «heiliges Priestertum» (1 Petr 2, 9). Das will nicht besagen, die Wirkung der Taufe komme jener der Priesterweihe gleich; aber durch den Taufcharakter wird der Mensch fähig, sich berechtigterweise mit dem Priester zu vereinen, um mit ihm und durch ihn den Leib und das Blut Christi und in Vereinigung mit der heiligen Opfergabe sich selbst Gott darzubieten.
Es ist wichtig für uns, dass wir den erhabenen Vorzug, der eine Wirkung der Taufe ist, ganz verstehen und dem christlichen Volk zum Bewusstsein bringen.
Prüfen wir diese Wahrheiten gründlich. In jeder Messe bildet ohne Zweifel die sakramentale Hinopferung Jesu den Mittelpunkt; doch das Opfer, das die Kirche dem Vater darbringt, schließt in ihrer Gesamtheit mit der Hingabe Christi auch die seiner Glieder ein. Auf dem Altar wie am Kreuz ist der Erlöser die einzige «heilige, reine und unbefleckte Opfergabe»; doch er will, dass wir uns an sein Opfer anschließen und es ergänzen.
Seit der Himmelfahrt trennt sich Christus nie mehr von seiner Kirche. Im Himmel zeigt er sich dem Vater mit seinem zur Vollendung geführten mystischen Leib, der «ohne Makel, ohne Runzel» (Eph 5, 27) ist. Alle Auserwählten weihen sich - mit ihm und untereinander vereint - dem gleichen Lobpreis im Licht des Wortes und in der Liebe des Heiligen Geistes.
Hier auf Erden bereitet sich dieses Geheimnis der Einung und Verherrlichung während der Heiligen Messe vor. Die Verbindung zwischen Haupt und Gliedern ist noch unvollkommen; sie ist im Wachsen begriffen und vollzieht sich im Glauben. Doch weil die Gläubigen mit Christus opfern, nehmen sie tatsächlich an seiner Eigenschaft als Opfergabe teil.
Was bedeutet das? Wenn sich der Christ mit Christus, der sich hinopfert und zur Speise gibt, vereint, willigt er ein, in völliger und ständiger Hinopferung für die Ehre des Vaters zu leben. So pflanzt Jesus in armselige Menschenherzen sein eigenes Leben, macht sie dem seinen ähnlich, ganz Gott und den Seelen geweiht.
Es gibt Gläubige, die - hingerissen vom Beispiel Jesu und seiner Gnade - ihn bei der Messe vorbehaltlos nachahmen: sie opfern ihm ihr Sein, ihr Denken, ihr Handeln und nehmen alle Leiden, allen Widerspruch, alle Mühen an, die die Vorsehung ihnen zuteilen will.
Andere nehmen ebenfalls teil an der Opferung Jesu, aber ohne sich völlig auszuliefern; wieder andere markten stets. Der Herr nimmt dennoch ihr Opfer an; er weist keines seiner Glieder zurück, auch die schwächsten nicht. Im Gegenteil, wenn er sich mit ihnen vereint aufopfert, nimmt er ihren guten Willen an, er belebt und heiligt sie.
Das ist die Ansicht der Kirche (Nach Dom Marmions Auffassung hat die Vereinigung der Glieder mit dem Haupt bei der Opferung keinen Einfluss auf den wesentlichen Wert der Messe. Dom Bernard Capelle bemerkt mit Recht, dass die Selbstaufopferung der Gläubigen, so ausgezeichnet sie sei und so sehr die Kirche sie wünsche, doch nur als «Ergänzungsopfer» angesehen werden dürfe ... «Die Wertordnung muss respektiert werden.» (Le sens de la messe, in Questions liturgiques, 1942, S. 22.) Die Enzyklika «Mediator Dei» bestätigt diese Lehre: Die Gläubigen sind durch die Taufe «zum Kult beauftragt; sie nehmen gemäß ihrer Stellung am Priestertum Christi teil». Sie nehmen an der Opferung teil, «nicht nur, weil sie das Opfer durch die Hände des Priesters darbringen, sondern auch, weil sie es mit ihm darbringen». Dennoch wird bei der Messe «die unblutige Hinopferung ... durch den Priester allein vollzogen, insofern er die Person Christi vertritt und nicht, insofern er die Person der Gläubigen vertritt»). Der Symbolismus dieser Riten zeigt sehr klar, dass die Gläubigen aufgerufen sind, mit Christus eine einzige Opfergabe zu sein. Das Brot und der Wein des eucharistischen Opfers stellen die Vereinigung der Glieder der Kirche untereinander und mit ihrem Haupt dar, wie der hl. Augustinus erklärt. «Ist das Brot aus einem einzigen Korn gemacht? Stammt es nicht vielmehr aus zahlreichen Weizenkörnern ? Und der Wein wurde aus mehreren Trauben gekeltert ... die, nachdem sie zusammen in der Weinpresse waren, einen einzigen Trank in der Lieblichkeit des Kelches bilden.» (Hl. Augustinus, Sermones 227 u. 229. P. L. 38, Sp. 1100 und 1103). Folglich «seid ihr auf dem Altartisch gegenwärtig, ihr seid im Kelch». Die Wirklichkeit, die der Glaube bei der Messe schaut, ist - wiederum nach dem hl. Augustinus - diese: die Kirche lernt durch die Darbringung des unter den heiligen Gestalten geopferten Christus täglich neu, sich selbst in ihm und mit ihm zu opfern: «In ea re quam offert, ipsa offeratur.» (De civitate Dei, X, 6. P. L. 41, Sp. 284).
Die Liturgie unserer Zeit wiederholt treulich die gleiche Lehre: «Gewähre uns, o Herr, die Gaben der Einheit und des Friedens, die unter den dargebrachten Gaben geheimnisvoll bezeichnet sind» (Sekret der Messe vom FronleichnamsIest). Wenn also Brot und Wein zum Altar getragen werden, sind wir geheimnisvoll in ihnen verborgen, vereint mit Christus, mit ihm dargebracht.
Das Konzil von Trient spricht von diesem Geheimnis, wenn es die Mischung von Wasser und Wein beim Offertorium erklärt. Dieser Ritus «drückt die geheimnisvolle Einheit Jesu mit seinen Gliedern aus» (Sess. XXII, cap. 7).
Beim «Suscipe Sancta Trinitas - H�eilige Dreifaltigkeit nimm …» nach der Opferung des Kelches erinnert der Priester daran, dass das Opfer zur Ehre der Jungfrau Maria, der Apostel und aller Heiligen dargebracht wird. Die streitende Kirche, die von so viel Not und Elend bedrängt ist, weiß sich in ihrer Liturgie vereint, ein Leib, unter einem Haupt und König mit der triumphierenden Kirche im Himmel. - Im Kanon wird dieser Glaube durch das «Communicantes - In heiliger Gemeinschaft» und das «Nobis quoque peccatoribus - Auch uns Sünder» neuerlich betont.
Nach der Konsekration lässt uns die Kirche ein geheimnisvolles Gebet sprechen. Der Priester neigt sich demütig und spricht: «Demütig bitten wir Dich, allmächtiger Gott: Dein heiliger Engel möge dieses Opfer zu Deinem himmlischen Altar emportragen vor das Angesicht Deiner göttlichen Majestät. Lass uns alle, die wir gemeinsam von diesem Altar das hochheilige Fleisch und Blut Deines Sohnes empfangen, mit allem Gnadensegen des Himmels erfüllt werden.»
Dieses Gebet betrifft uns; wir sind es, die vor Gott getragen werden sollen. Das «haec» bedeutet die Opfergaben, also die Glieder Christi mit ihren Gaben, ihren Wünschen und Gebeten. Soweit sie mit ihrem Haupt vereint sind, werden sie nach der Bitte der Kirche «zum himmlischen Altar» emporgetragen. Der Erlöser ist mit vollem Recht «ein für allemal in das Allerheiligste eingegangen» (Hebr 9, 12) ; doch wir durchdringen bei der Messe, demütig auf unsern Mittler gestützt, jeden Tag den Schleier und gehen mit ihm in das Heiligtum der Gottheit ein, «in den Schoß des Vaters».
Doch man wird einwenden: Ist Jesus nicht immer vor dem Angesicht des Vaters? Gewiss, seiner verherrlichten Menschheit nach: «denn er lebt allezeit, um für sie einzutreten» (Hebr 7, 25). Ohne den Himmel zu verlassen, kommt er auf unsere Altäre, um uns dorthin zu erheben, wo er selbst lebt. In dieser liturgischen Bitte sprechen wir den Wunsch aus, von ihm emporgetragen zu werden, damit Gott in seiner großen Barmherzigkeit uns aufnehme und mit dem gleichen Blick der Liebe umfange wie seinen Sohn (Diese tiefen Erkenntnisse schöpfte Dom Marmion aus liturgischen Texten; doch er will damit nicht eine Erklärung des Wortlautes geben. - Das Gebet «Supplices - Demütig» ist zum Teil im übertragenen Sinn zu verstehen. Die alte Kirche, die mit den Symbolen der Heiligen Schrift vertraut war, spielt hier auf den Engel an, der nach der Apokalypse die Kulthandlung leitet; er steht neben dem Altar, vor dem Throne Gottes [Offb 8, 3]. Dieser Engel ist, wie Bossuet sagt. «nicht ein Mittler, den wir für uns in Anspruch nehmen, als ob Jesus Christus nicht genügte», doch die Kirche bittet um seinen Dienst, damit er zusammen mit ihr die geopferten Gaben Gott darbringe, «doch stets durch Jesus Christus» [Bossuet, Explication de la messe, 38. Kap.]).
Die Heilige Schrift berichtet von der Weihe des salomonischen Tempels: «Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel» (2 Chr 7, 1): «Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes.» Die Priester fürchteten sich, einzutreten; sie waren wie vernichtet vor der göttlichen Majestät. Wenn das vom alten Tempel gilt, was muss man da erst von unsern Kirchen sagen, wo die göttlichen Geheimnisse gefeiert werden? Durch ein Wunder des Erbarmens ist Gott hier zugegen, Christus opfert sich unter den eucharistischen Gestalten dem Vater auf; er bringt sich vereint mit allen seinen Gliedern dar und bereitet sie so vor auf den nie endenden Lobpreis im Himmel. Das drückt die Kirche in der Sekret der Messe am Fest der heiligsten Dreifaltigkeit aus (Vgl. auch die Sekret der Messe vom Pfingstmontag): «Herr, unser Gott, wir bitten Dich: heilige diese Opfergabe durch die Anrufung Deines heiligen Namens und mache durch sie uns selber zur vollendeten ewigen Opfergabe für Dich.»
6. Die Früchte des Messopfers
Durch göttliche Anordnung strömen uns aus dem Messopfer die Gnaden und die Vergebung vom Kreuz in überreicher Fülle zu. Das ist unser Glaube: «Die Früchte jenes Opfers nun (nämlich des blutigen) werden überreich durch dieses unblutige «Opfer» empfangen» (Konzil von Trient, Sess. XXII, cap. 2).
Auch der hl. Thomas hat schon diese Auffassung vertreten: «Alle Heilswirkungen, die zum Nutzen der ganzen Welt vom Leiden Christi ausgehen, werden in diesem Sakrament jedem Menschen im besonderen zugewendet» (S. th. III, q. 79, a. 1).
Betrachten wir, welches die Früchte sind, die «zum Segen für uns und die ganze Kirche» gereichen sollen, und wie ihre Zuwendung ,an die Gläubigen zu verstehen ist.
Diese Früchte bestehen vor allem in einem Wachstum der Gnade. Wenn jede gute Tat eine Vermehrung der Verdienste, der Gnade und der ewigen Herrlichkeit zur Folge hat, bringt uns die andächtige Feier des Messopfers ohne Zweifel dieselben übernatürlichen Früchte. Bei der Messe vereinigt sich der Priester mit Jesus; durch ihn kommt er der göttlichen Majestät ganz nahe und ist gleichsam von der göttlichen Liebe umhüllt. Auf diese Weise will die Gnade seine Seele heimsuchen und in Überfülle in ihr sein. «Mit allem Segen des Himmels �und der Gnade erfüllt werden.»
Weil die Messe auch ein Sühnopfer ist, leistet sie Genugtuung für die Sünden und bewegt Gott, zu verzeihen und uns die Fülle seiner Barmherzigkeit zu schenken. Mag unser Elend, unsere Schwachheit, unsere Vergangenheit sein wie immer, halten wir uns stets die Versicherung des Konzils vor Augen: «Durch diese Opfergaben wird der Herr gnädig gestimmt, gewährt seine Gnade, schenkt uns Bußgesinnung und verzeiht selbst die schwersten Sünden und Frevel» (Sess. XXII, cap. 2).
Nach der Auffassung des Konzils erstreckt sich die Heilswirkung des Messopfers über die ganze Welt; sie soll in der Kirche unaufhörlich «zur Vergebung der Sünden, die die Menschen täglich begehen», wirksam sein (Sess. XXII, cap. 1).
Die Heilige Messe tilgt nicht aus sich selbst die Beleidigungen, die Gott zugefügt wurden, wie es das Bußsakrament tut; aber sie erlangt uns in hohem Maß die Gnade der Zerknirschung und wahrer Reue.
Die Messe bewirkt auch den Nachlass der zeitlichen Strafen, die wir für unsere Sünden verdient haben. So ist sie für die Armen Seelen im Fegfeuer ebenso Sühnopfer wie für uns.
Und können unsere Bitten je wirksamer sein, als wenn wir sie im heiligen Opfer vorbringen? Der Vater sieht nicht mehr unsere Unwürdigkeit, sondern er hört die Stimme seines Sohnes, der für uns eintritt. Die Macht des Bittgebetes in der Messe ist unermesslich groß. Das Blut Abels rief zu Gott um Rache, das Blut Jesu aber erfleht nicht Strafe, sondern Erbarmen und Gnade. Es ist «das mächtiger ruft als das Blut Abels» (Hebr 12, 24).
Wem kommen die Früchte des Messopfers zu ?
Man unterscheidet zunächst eine Frucht, die dem Zelebranten allein zukommt. Als Diener Jesu Christi empfängt der Priester eine ganz besondere Gnadenmitteilung. Diese Gabe ist so persönlich, dass sie nach Ansicht der Theologen niemand anderem zugewendet werden kann. Diese Gnade bezweckt die Umgestaltung des Priesters in jenen, dessen Stellvertreter er ist. Er ist wirklich ein anderer Christus, und alle Gnade, die er empfängt, will ihm helfen, immer mehr die innere Haltung zu erlangen, die der Priesterwürde gemäß ist.
Ohne Zweifel gewinnen auch jene, die der Messe beiwohnen, eine besondere übernatürliche Frucht. Das liturgische Gebet: «Orate fratres- Betet Brüder» und auch andere Gebete deuten darauf hin. Die Anwesenden, die Leviten und Messdiener, die zusammen mit dem Priester die Riten vollziehen, erhalten in erster Linie Anteil daran.
Jede Messe hat vor Gott «durch sich selbst», «ex opere operato - aus dem vollzogenen Werk heraus», die Wirkung eines Sühn- und Bittopfers. Diese hat sie kraft des Kreuzesopfers. Dennoch ziehen der Eifer und die Ehrfurcht des Priesters, mit der er die heilige Handlung würdig zu vollziehen sucht, sicher ein Mehr an Gnaden auf die Gläubigen herab. Denken wir daran, wir, die wir Verantwortung für die Seelen tragen und von Amts wegen bei Gott für sein Volk eintreten müssen.
Die Theologen unterscheiden noch eine andere Frucht, den «fructus ministerialis». Sie kommt jenen zu, für die der Priester das heilige Opfer darbringt. Diese Frucht sichert ihnen eine vorzugsweise Zuwendung der Verdienste und der Genugtuung Jesu Christi. Messen, die in diesem Sinn aufgeopfert werden, können in Sündern und Gerechten, aber auch in den Gliedern der leidenden Kirche große Gnadenwirkungen hervorbringen.
Ferner gibt es noch eine «allgemeine Frucht», die allen Gläubigen zukommt. Der Priester betet im Kanon und auch sonst mehrmals für die ganze Kirche. Er bittet den Erlöser, allen, die durch den Glauben und die Liebe mit ihm verbunden sind, seine Gnade zu schenken. Häresie und Exkommunikation bewirken, dass die Seele außerhalb dieses Stroms göttlicher Gaben gestellt wird.
Das heilige Opfer, dass der Herr seiner Braut gegeben hat, ist der hervorragendste Ausdruck ihrer Gottesverehrung und ihres Gebetes.
«Sooft man das Gedächtnis dieses Opfers feiert, wird das Werk unserer Erlösung vollzogen» (Sekreta vom 9. Sonntag nach Pfingsten).
Wir können unsere Priesterwürde gar nicht hoch genug schätzen. Der hl. Johannes Chrysostomus schreibt: «Wer vermag zu sagen, wie die Hände sein müssen, die ein solches Opfer vollziehen, die Zunge, die solche Worte ausspricht, und um wie viel reiner und heiliger noch die Seele sein muss, die den gewaltigen Hauch des Heiligen Geistes empfängt» (De Sacerdotio, VI, 4. P. G. 48 bis, Sp. 681).
XII. SANCTA SANCTE TRACTANDA
Der Priester ist zu einer gewissermaßen göttlichen Würde erhoben, denn Jesus Christus identifiziert sich mit ihm. Seine Aufgabe als Mittler ist das höchste, was es auf Erden gibt. Man kann wiederholen: wenn der Priester sein Leben lang nichts tun würde, als jeden Morgen andächtig das Messopfer darbringen, ja wenn er es nur einmal dargebracht hätte, so hätte er damit eine Handlung vollzogen, die in der Wertordnung weit höher steht als die Ereignisse, die die Welt begeistern. Denn die Wirkungen jeder Messe haben Ewigkeitsdauer. Nichts ist ewig als das Göttliche.
Orientieren wir unser ganzes Leben an der Heiligen Messe. Sie ist der Mittelpunkt, die Sonne des Tages. Sie ist gleichsam der Herd, von dem uns Licht und Wärme und übernatürliche Freude zuströmt.
Wir müssen wünschen, dass unser Priestertum unsere Seele und unser Leben so beherrscht, dass man von uns sagen kann: er ist immer und überall Priester. Das ist die Wirkung eines eucharistischen Lebens, echten Opfergeistes, die uns zu einem «Alter Christus - Anderen (oder zweiten) Christus» macht.
Wie schön ist es doch, einen Priester zu sehen, der nach langen Jahren treuer Pflichterfüllung wirklich aus dem göttlichen Opfer lebt!
Es gibt viele Priester, die ganz Christus und den Seelen hingegeben sind und dieses Ideal voll verwirklichen; sie gereichen der Kirche zur Ehre und sind die Freude des göttlichen Meisters.
Wenn auch wir auf der Höhe unserer priesterlichen Berufung sein wollen, wenn wir wollen, dass der priesterliche Charakter unser ganzes Leben prägt, uns mit Liebe und Eifer entflammt, dann bereiten wir unsere Seelen, dass sie fähig werden, die Gnaden unseres Messopfers aufzunehmen.
Manche stellen nach Jahren fest, dass sie es im Lauf ihres Lebens gewohnheitsmäßig an Eifer fehlen ließen. Wo ist die Ursache dafür zu suchen?
Viele Umstände können dazu beigetragen haben. Denken wir daran, dass man völlig der Sünde, auch der lässlichen Sünde sterben muss, wenn die Liebe in uns den endgültigen Sieg davontragen soll.
Dennoch ist es meist mangelnder Eifer bei der Darbringung des täglichen Messopfers, der zu dem Sich-gehenlassen führt. Das Zelebrieren setzt die Prüfung des Gewissenszustandes voraus und umgibt den Priestern mit einer Atmosphäre der Gnade. Dadurch bietet sie ihm eine kostbare Gelegenheit, sich zu sammeln, sich zu demütigen, sich wieder zu besinnen. Wenn man dieses Mittel, das so sehr geeignet ist, uns im Übernatürlichen zu verankern, vernachlässigt, dann verfällt man immer mehr dem Gewohnheitsmäßigen und dem Mittelmäßigen. Bleibt hingegen in der Seele der Wunsch lebendig, das Messopfer so gut als möglich darzubringen, wird sie nie vom richtigen Weg abweichen.
1. Die Wichtigkeit der Seelenhaltung
Wenn wir reiche Frucht aus unsern Messopfern ziehen wollen, können wir die Bedeutung der inneren Haltung gar nicht hoch genug einschätzen.
Betrachten wir Kalvaria.
Wer waren die Zeugen der Erlösungstat ? Wir können drei Gruppen unterscheiden: Maria, der Lieblingsjünger Johannes und die heiligen Frauen bilden die erste; die Juden und die Henker Jesu die zweite; die dritte Gruppe ist unsichtbar: die heiligste Dreifaltigkeit, umgeben von Myriaden himmlischer Geister. Der Vater. schaute auf Christus, der sich am Kreuz hinopferte. Er sah, wie sein Sohn, «der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens» (Hebr 1, 3), ihm eine erhabene Huldigung der Gerechtigkeit und der vollkommenen Liebe darbrachte. Dieses Opfer, das von der Göttlichen Weisheit vorausgesehen und angeordnet worden war, erwies Gott alle Verherrlichung und erlöste die Menschen. Und der Vater, das WORT und der Heilige Geist hatten Wohlgefallen an der unendlichen Liebe, von der die Hinopferung des Erlösers eingegeben war.
Am Kreuz opfert sich Christus und stirbt für uns: «Er ist für alle gestorben» (2 Kor 5, 15).
Doch wie verschieden ist der übernatürliche Gewinn, den die Anwesenden von ihrer Teilnahme am göttlichen Opfer haben!
Betrachten wir zunächst Maria. Sie ist das Urbild vollendeter Heiligkeit; sie nimmt den Willen des Vaters an, sie bietet ihm seinen Sohn dar; sie bittet für uns. Die Gnade, die ihr vom Kreuz zuströmt, übersteigt alles menschliche Verstehen. Maria wurde durch das Leiden Jesu mehr geheiligt als alle andern. Die Verdienste ihres Sohnes waren der Preis für alle ihre Vorzüge und für die Fülle der göttlichen Gnade, mit der sie überhäuft wurde.
Vielleicht werden wir sagen: «Herr, ich verstehe, dass deine Mutter so große Gaben empfing; aber ich bin nur ein armer Sünder.» Und Jesus wird uns antworten: «Ganz nahe neben meiner Mutter steht Maria Magdalena; ich wollte, dass eine Sünderin zu Füßen meines Kreuzes stehe, doch eine Sünderin, die von Liebesreue erfüllt war. Die Wirksamkeit dieses Opfers ist so groß, dass für die Gnaden, die daraus entspringen, auch die schwersten Sünden kein Hindernis bilden, wenn nur das Herz von Reue erfüllt ist.»
Und war nicht auch der gute Schächer ein Sünder? Doch durch die Verdienste Christi erhielt er die Gnade des Glaubens. Voll Vertrauen wandte er sich an Jesus und in der geheimnisvollen Zwiesprache am Kreuze vernahm er von den Lippen des sterbenden Erlösers die Worte vollen Verzeihens: «Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein» (Lk 23, 43).
Für sie alle war das Sterben Jesu eine Quelle der Heiligkeit. Wenn es auch uns vergönnt gewesen wäre, beim Drama auf Golgotha gegenwärtig zu sein, hätten wir sicher an der Seite der Mutter Jesu und seiner Freunde stehen wollen.
Die zweite Gruppe ist die der Pharisäer, der Priester und der Juden, die von Pilatus die Kreuzigung Jesu gefordert hatten. Am Kreuz «hat der Erlöser für sie alle gebetet»: «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun» (Lk 23, 34). Niemand war von dieser Bitte ausgeschlossen. Ohne Zweifel war sie für einige von ihnen wirksam, wenn auch vielleicht nicht sofort. - Die Gesetzeslehrer waren, wie das Evangeliums berichtet, von sakrilegischem Hass erfüllt; sie haben ihr geistiges Auge verschlossen und ihre Herzen verhärtet. Riefen sie doch dem Pilatus zu: «Sein Blut komme über uns» (Mt 27, 25).
Und schließlich die Henker: sie sind Unwissende, Gleichgültige. Auch für sie hat Christus gebetet; doch in jener Stunde kannten sie noch keine religiöse Beunruhigung. Sie dachten an nichts oder interessierten sich höchstens dafür, wer von ihnen in den Besitz des Gewandes Jesu kommen werde, oder sie freuten sich, einen Menschen leiden zu sehen.
Auch heute noch stehen die Menschen dem Erlöser, der in unsern Kirchen das Geheimnis seiner Hinopferung fortsetzt, in einer Haltung gegenüber, die - wenn auch in verschiedenem Grade - der Haltung einer dieser Gruppen entspricht. Die Messe ist das gleiche Opfer wie das auf Kalvaria. Das Konzil von Trient sagt: «Es ist die eine und gleiche Opfergabe; es ist jetzt noch der gleiche Opferpriester» (Sess. XXII, cap. 2). In ihr ist das kostbare Blut Jesu, von dem ein einziger Tropfen genügt, um die Welt zu erlösen. Doch wer der Messe gleichgültig beiwohnt, dem bringt sie wenig Nutzen, während die eifrigen Seelen aus der Glaubensbegegnung mit Christus eine Kraft und eine himmlische Freude schöpfen, die sie über die Welt und das Fleisch triumphieren lässt.
Wenn das für jene gilt, die der Messe nur beiwohnen, von welcher Bedeutung ist da die Gesinnung, in der der Priester sie darbringt! Zwei Priester verlassen den Altar: der eine hat sich im Gebet Gott genaht, er ist voll Eifer und heiliger Freude: «Zu Gott, der mich von Jugend auf erfreut» (Ps 43, 4). Der andere ist zerstreut und missgestimmt. Fast möchte er sagen wie die Israeliten: «Unsere Seele hat Widerwillen gegen diese kraftlose Speise» (Num 21, 5). Die Messe, die Eucharistie lassen ihn kalt. Ist sein Messopfer nicht das gleiche wie das des andern? Es ist das gleiche, doch der Glaube dieses Priesters hat nicht die Lebenskraft, die die Liebe verlangt.
Wenn wir die rituellen Handlungen vollziehen und die heiligen Worte aussprechen, geben wir uns Mühe, diese beiden theologischen Tugenden in uns zu erwecken; nur in ihrer Kraft können wir durch die Erscheinungsform zur übernatürlichen Wirklichkeit vordringen.
Wenn es vorkommt, dass ein Priester die heiligen Geheimnisse feiert und sein Gewissen schwer belastet ist, hat er dann noch das Recht, sich zu den Freunden Jesu zu zählen? Er würde ein Sakrileg begehen. Hält er hartnäckig an der Sünde fest, dann gilt auch für ihn das schreckliche Wort des Apostels: «Ein solcher schlägt auch den Sohn Gottes ans Kreuz» (Hebr 6, 6). Ich weiß, ein Glaubensartikel sagt, dass jede Sünde vergeben werden könne; aber die Erfahrung lehrt, dass diese Beleidigung des Gottessohnes eine furchtbare Blindheit zur Folge hat. Was wird das Schicksal einer solchen Seele sein, wenn der Tod sie unverhofft ereilt?
Bevor wir zelebrieren, denken wir daran, dass es uns ergehen wird wie den Menschen, die beim Kreuze standen: jeder wird Gnade empfangen oder sich verhärten, je nach seiner inneren Gesinnung.
2. Grundhaltung: Vereinigung mit Jesus Christus, dem Priester und der Opfergabe
Durch ein einzigartiges Vorrecht seines Priestertums ist Christus selbst zugleich Opferpriester und Opfergabe beim Opfer des Neuen Bundes.
Welches muss die Grundhaltung des Priesters sein, wenn er so vollkommen als möglich seinem göttlichen Vorbild gleichen will? Er muss in die innerste Gesinnung des Herzens Jesu eingehen, jene Gesinnung, die den Herrn beim Letzten Abendmahl und auf Kalvaria beseelte und die er auch jetzt noch im Himmel bewahrt. So wird er dem Wort des Apostels gerecht: «Habt die Gesinnung in euch, die in Christus Jesus war» (Phil 2, 5).
Als sich Jesus unter dem Antrieb des Heiligen Geistes am Kreuze opferte, war er von Liebe beherrscht: «die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe» (Joh 14,31). Seine Seele war auch damals vor der göttlichen Majestät in Anbetung und Danksagung versenkt. Jesus verlangte sehnlichst danach, sich zu opfern, um die Sünden der Welt zu sühnen und der ganzen Menschheit das Heil zu erringen.
Wenn wir zelebrieren, ist es höchst geziemend, dass wir die Gesinnung und die Absichten des einzigen Opferpriesters teilen. Bedenken wir wohl: als Christus in seine Herrlichkeit einging, hat er nicht aufgehört, seinen Vater zu lieben, und wir haben den Auftrag, in der gleichen Seelenhaltung im Schoß der Kirche das Geheimnis des Letzten Abendmahles und des Kreuzes fortzusetzen.
Während der heiligen Handlung muss sich also der Priester mit dem Erlöser vereinen. Jesus ist das vollendete Vorbild der Gesinnung der Gottesverehrung und Liebe, mit der auch sein Diener das heilige Opfer darbringen soll.
Vorbild ist uns Christus auch in seiner Eigenschaft als Opfergabe.
Auch hier müssen wir uns seiner Gesinnung angleichen. Der Weiheritus erinnert uns ausdrücklich daran. «Ahmt das Opfer nach, das ihr darbringt», das will sagen, während ihr das Geheimnis des Todes unseres Erlösers feiert, ertötet in euern Gliedern Laster und Begierlichkeit. Nur dann werdet ihr dem Vater euer Opfer auf die vollkommenste Weise darbringen: jene, die Christus am Kreuz wählte.
Warum, so kann man sich fragen, wollte Jesus sich Gott als Opfergabe für uns weihen ?
Man kann Gott verschiedene Gaben bieten: durch Almosengeben, fromme Stiftungen, durch Schenkung kostbarer Gegenstände, eines Kelches z. B. All das ist sehr gut und Gott wohlgefällig, wenn es vom Geist der Liebe eingegeben wird.
Doch wie unterscheidet sich die Opfergabe von allen anderen Gaben?
Der Unterschied ist sehr groß. Die Gaben werden zu einem bestimmten Zweck dargebracht, der durch ihre Natur oder den Willen des Gebers bestimmt ist. Wenn ich einen Kelch spende, so ist dieser Gegenstand sicher nur für einen begrenzten Zweck bestimmt und kann nicht für andere Zwecke dienen. Die Opfergabe hingegen ist kraft ihrer wesentlichen Bestimmung Gott allein ausgeliefert; sie gehört ihm ganz und gar; sie ist ausschließlich für ihn da, damit er darüber nach seinem Wohlgefallen verfüge.
Das ist der tiefste Grund, aus dem Jesus Opfergabe sein wollte. Wir haben es schon betrachtet, aber wir können uns gar nicht oft genug an diese Wahrheit erinnern. Das erste Wort Jesu bei seinem Eintritt in die Welt lautet: «Schlachtopfer hast du nicht gewollt ... siehe, ich komme, um deinen Willen zu erfüllen, o Gott» (Hebr 10, 6-7). Und was war der Wille Gottes? Der Tod auf Kalvaria nach einem Leben voll mühevoller Arbeit, die im Geist der Liebe vollbracht wurde. Das ist das Opfer Christi.
Opfern auch wir uns bei der Messe wie Christus, nach seinem Beispiel, so dass Gott mit uns tun kann, was er will ; wir müssen uns unserm Schöpfer und Erlöser hingeben, uns ihm ausliefern.
In Vereinigung mit dem menschgewordenen Wort nehmen wir alle Mühen und Schwierigkeiten unseres Amtes auf uns; ertragen wir uns selbst mit unserer Begrenztheit, unserm Elend, unsern gesundheitlichen Beschwerden. Gewöhnen wir uns daran, für die Lockungen der Welt taub zu sein, wo sie sich der Herrschaft Gottes in uns entgegenstellen. Beim Ordenspriester führt der Geist vorbehaltlosen Gehorsams zu dieser so wichtigen Haltung.
Es gibt da Wahrheiten von unergründlicher Tiefe zu betrachten, es gilt, sehr ernste Gewissenserforschungen anzustellen. Haben wir Gott stets nach seinem Wohlgefallen über uns verfügen lassen ?
Fassen wir den Vorsatz, das Geheimnis der Hinopferung Christi, das sich unter unsern Händen auf dem Altar fortsetzt, aufrichtig nachzuahmen.
3. Grundhaltungen, die das Konzil von Trient empfiehlt
Es nennt deren vier: ein wahrhaftiges Herz - einen aufrichtigen Glauben - Furcht und Ehrfurcht - und den Geist der Zerknirschung und der Buße: «mit aufrichtigem Herzen und rechtem Glauben, mit Scheu und Ehrfurcht, reuevoll und bußfertig» (Sess. XXII, cap. 2).
Vor allem ein ganz «wahrhaftiges Herz». Was heißt das? Es besagt eine volle Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Diese Eigenschaft ist von größter Wichtigkeit; aber geben wir es nur zu, sie ist recht selten. Wir glauben zuweilen, vor uns selbst ganz aufrichtig zu sein, doch es gibt geheime Winkel unseres Herzens, die wir nicht öffnen, nicht einmal vor Gott.
Um dieses «wahrhaftige Herz» zu erlangen, müssen wir sehnlichst wünschen, uns selbst so zu kennen, wie der Herr uns beurteilt. In der Sammlung des Gebetes soll das göttliche Licht bis in die verborgensten Tiefen eindringen und uns zeigen, was wir sind. Es genügt nicht, die Wahrheit zu sagen, wenn wir mit andern sprechen; wir müssen auch uns selbst gegenüber wahrhaftig sein: «der in seinem Herzen die Wahrheit sagt» (Ps 15,3), und vor allem Gott gegenüber. Wenn der Priester am Altar würdig vor dem Herrn stehen will, dann muss er dieses «wahrhaftiges Herz» haben.
Erwägen wir, was im Himmel unser wartet. Wie die Seele Jesu als Seele des Gottessohnes von der Menschwerdung an zur Anschauung des Vaters erhoben und von Herrlichkeit umhüllt wurde, so wird sich der Herr in wunderbarer Herablassung auch den angenommenen Kindern schenken. Je nach dem Grade der Liebe, die wir im Augenblick des Todes besitzen, wird er unsere Seelen mit seinem Licht und seiner Seligkeit erfüllen. Warum erzeigt er uns solche Güte? Weil er in uns die Abbilder Jesu sieht.
Ein wenig beachtetes Wort der Heiligen Schrift sagt uns, worin diese Seligkeit bestehen wird: «Gott wird uns seine Geheimnisse enthüllen» (Sir 4, 21. Diese «Enthüllung» wird von der personifizierten Weisheit ausgesagt, die, nachdem sie ihren Jünger geprüft hat, ihn mit Freude erfüllen und ihm ihre Geheimnisse offenbaren wird. «Sapientia laetificabit illum et denudabit absconsa illi.» Dom Marmion wendet dieses Wort auf Gott an in dem Augenblick, wo er der geläuterten Seele Zutritt in das Glorienlicht gewährt). Vergessen wir dieses Wort nicht. Gott wird sich seinen Auserwählten zeigen, wie er ist, in der Einheit seines Wesens und in der Dreifaltigkeit seiner Personen; er wird ihnen die «absconsa - Verborgenheit» seines ewigen Lebens enthüllen; alles wird ihnen im vollen Lichte der Wahrheit entschleiert werden: «Gott ist Licht, und keine Finsternis ist in ihm» (1 Joh 1, 5).
Und wir werden uns mit dem Herrn vereinigen und ihn im Licht voller Erkenntnis verherrlichen. Das ganze Elend unseres vergangenen Lebens und der Sieg der Gnade in uns werden vor unsern Augen offenliegen. Dann wird unser Herz in tiefer Demut die Abgründe des göttlichen Erbarmens verstehen; dann wird unser Gotteslob voll und ganz wahr sein.
Zweifeln wir nicht daran, Gott wünscht, dass wir schon in diesem Leben in einer Haltung absoluter Aufrichtigkeit vor ihm stehen.
Wir täuschen uns oft über uns selbst. Wir haben nicht immer die Kraft, dem Blick Gottes standzuhalten, uns Gott zu zeigen, wie wir sind. Wir haben Mängel, geheime Neigungen, Anhänglichkeiten, die wir uns nicht eingestehen; es gibt Opfer, zu denen wir nicht den Mut haben und die Gott doch von uns verlangt.
Erwägen wir diese Wahrheiten, und wenn Gott uns Verzichte auferlegt, nehmen wir sie auf uns. Wenn wir zum Altar schreiten, bringen wir Gott ein wahrhaftiges, ehrliches, offenes Herz dar. Dann werden wir, wie das Konzil versichert, reichen Gewinn vom heiligen Opfer haben.
Das zweite, was das Konzil empfiehlt, ist eine echte Glaubenshaltung: «rechten Glauben». Das Konzil stützt sich dabei auf den Hebräerbrief : «So haben wir denn, Brüder, kraft des Blutes Christi zuversichtliche Hoffnung auf den Eintritt in das Allerheiligste … durch den Vorhang hindurch, nämlich durch sein Fleisch». «Und wir haben einen erhabenen Priester ... Lasst uns darum mit aufrichtigem Herzen voll Glaubenszuversicht hinzutreten» (Hebr 10, 19-22).
Das Bild des Alten Bundes, auf das der hl. Paulus an dieser Stelle anspielt, wird im Messopfer herrlich verwirklicht. Hier gestattet uns Christus tatsächlich, mit ihm nicht nur in das Allerheiligste des Tempels von Jerusalem, sondern in das Allerheiligste der Gottheit einzugehen, d. h. zum Vater. Er führt uns dorthin kraft seines Leidens, dessen Verdienste uns durch die Aufopferung am Altar zugewendet werden. Dieser Glaube wird in uns grenzenloses Vertrauen in den unendlichen Wert des Opfers wecken.
Das eucharistische Geheimnis ist wirklich «Mysterium fidei - Geheimnis des Glaubens». Die Kirche hat diese beiden Worte in die Formel für die Konsekration des kostbaren Blutes eingeschaltet. All das vollzieht sich im Glauben. Die Macht des Priesterwortes, die Gegenwart Christi durch die Verwandlung des Brotes und des Weines, die Heilswirkungen jeder Messe das sind Dinge, die nur im Glauben erfasst werden können.
Wir lasen von heiligen Seelen, die bei der Heiligen Messe sahen, wie der Herr selbst das Opfer darbrachte; der Priester verschwand vor ihren Augen, sie sahen nur Christus. Das ist eine außerordentliche Gnade, doch sie entspricht ganz dem, was die Kirche lehrt. Das Konzil sagt darüber: «Christus ist am Altar derselbe Opferpriester wie auf Kalvaria» (Sess. XXII, cap. 2).
Das priesterliche Wirken Christi, kann uns nicht überraschen. «Der Vater richtet niemand; er hat vielmehr das Gericht ganz dem Sohn übertragen» (Joh 5, 22). Christus richtet jeden, der stirbt, und in jedem Augenblick sterben Menschen. Warum sollte er nicht ebenso gut bei jeder Messe tätig und ausdrücklich mit dem Priester zusammenwirken, der sein Opfer auf Erden fortsetzt ?
Und was geschieht bei der Verwaltung der Sakramente? Der hl. Augustinus spricht klar die Lehre der Kirche aus: «Ob Petrus oder Paulus oder Judas taufen - es ist immer Christus, der im Heiligen Geist die Wiedergeburt der Seele bewirkt». «Christus tauft aus eigener Kraft, jene als Werkzeuge» (In Joan. VI. P. L. 35, Sp. 1428). Das gleiche gilt für die Eucharistie: wer immer auch der Priester sei, der konsekriert, selbst wenn er ein Häretiker oder ein Unwürdiger wäre, es ist immer Christus, der in ganz wirklicher und erhabener Weise opfert und konsekriert, wenngleich durch den Dienst eines Menschen.
«Cum metu et reverentia - mit Furcht und Ehrfurcht.» Bei der Darbringung seines Opfers überströmte das Herz Jesu von tiefer Ehrfurcht vor der Majestät des Vaters. Isaias sagte voraus, dass der Geist der Furcht des Herrn auf ihm ruhen werde (11, 3).
Als wir die Tugend der Gottesverehrung betrachteten, sagten wir, dass das ganze Erdenleben Jesu eine Huldigung ehrfurchtsvoller Gottesverehrung gewesen sei. Auch jetzt im Himmel, wo er in der «Herrlichkeit des Vaters» weilt, ist seine Haltung stets von Ehrfurcht und Anbetung bestimmt; da seine menschliche Natur geschaffen ist, kann sie nur in der Wahrheit sein, wenn sie durch ihre Verdemütigung die Vollkommenheit Gottes anerkennt.
Seien auch wir am Altar von dieser ehrfürchtigen Scheu erfüllt, die ganz mit Liebe und Vertrauen Hand in Hand geht; lassen wir uns bis aufs Mark von ihr durchdringen: «Aus Ehrfurcht vor dir erschauert mein Leib» (Ps 119, 120).
Sodann nennt das Konzil den Geist der Zerknirschung und der Buße; wir beschäftigten uns mit diesem Gegenstand bereits im Kapitel über die Zerknirschung des Herzens. Wir brauchen nicht darauf zurückzukommen. Doch wir können es uns nicht versagen, hier die Worte des hl. Gregor anzuführen, die die ganze christliche Tradition zusammenfassen: «Es ist notwendig, dass wir uns bei der 'heiligen Handlung' selbst Gott hinopfern in der Zerknirschung des Herzens; wenn wir das Geheimnis des Leidens des Herrn feiern, müssen wir das Opfer nachahmen, das wir darbringen» (Dialog. IV. P. L. 77, Sp. 428. - Von dieser Stelle scheint der Text des gegenwärtigen «Pontificale Romanum» inspiriert zu sein: «Imitamini ...» Diese ganze Ansprache des Bischofs scheint aus dem Pontifikale von Durand de Mende [XIII. Jahrhundert] entnommen zu sein).
4. Unmittelbare Vorbereitung - Zelebrieren - Danksagung
Die Gesinnung, von der wir eben sprachen, sollte in der Seele des Priesters stets lebendig sein; doch eine solche Forderung übersteigt das Können des schwachen Menschen. Deshalb ist es sehr nützlich, dass wir uns vor dem Zelebrieren bemühen, durch eine unmittelbare Vorbereitung unsern Glauben lebendiger und unser Herz aufnahmebereiter zu machen.
Das Messbuch enthält ausgezeichnete Vorbereitungsgebete für das heilige Opfer. Man kann sie mündlich beten oder betrachten.
Wir begnügen uns mit einigen Ratschlägen.
Alle Methoden und alle Übungen sind auf folgendes Prinzip zurückzuführen: Je mehr man sich bei der Darbringung des heiligen Opfers mit Jesus Christus identifiziert, je mehr man auf die Absichten des Vaters eingeht, desto gnadenvoller wird die Zelebration sein. Die Sekret vom Gründonnerstag spricht diese Glaubenswahrheit aus: «Heiliger Herr, ... wir bitten dich: unser Opfer mache er selber dir genehm, der es am heutigen Tage einsetzte und seine Jünger belehrte, es geschehe zu seinem Gedächtnis.»
Der Priester soll also eins werden mit der Person Jesu Christi, wenn er in seinem Namen handelt. Bevor er zum Altar schreitet, kann er zu Jesus sprechen: «Herr, Du hast gesagt: «Ohne mich könnt ihr nichts tun» (Joh 15,5). Ich erkenne es an: ohne Dich vermag ich nichts, vor allem bei dieser göttlichen Handlung des heiligen Opfers. Ich bin ganz unfähig, bei diesem unvergleichlich erhabenen Akt Dein würdiger Diener zu sein. Selbst wenn ich mein ganzes Leben zur Vorbereitung verwenden würde, wäre ich nicht würdig, einen solchen Dienst zu vollziehen. Doch da ich vom Heiligen Geist eine Teilnahme an Deinem Priestertum empfangen habe, bitte ich Dich demütig, verleihe mir Deine eigene Gesinnung als Priester und Opfergabe; jene, die Dich beim Letzten Abendmahl und am Kreuze beseelte; würdige Dich, in Deiner Barmherzigkeit alles zu ersetzen, was mir fehlt.»
Wie widersinnig wäre es, wenn der Priester das Kreuzesopfer fortsetzte, ohne sich in tiefster Seele der Hinopferung anzugleichen, die er am Altar vollzieht! Wenn Christus durch seinen Mund redet, sich durch seine Hände opfert, kann da das Herz des Priesters kalt bleiben, als ob ihm die Gesinnung des Erlösers fremd wäre?
Bei seiner Opferung bringt Christus das ganze Menschengeschlecht dar. Sein Beispiel soll unsere Seele aufgeschlossen machen für die Nöte und Leiden aller: denken wir an die Sünder, die Armen, die Kranken, die Sterbenden, als ob wir beauftragt wären, alle ihre Bitten vor den Herrn zu bringen. Auf diese Weise werden wir «Wortführer» der ganzen Kirche.
Legen wir immer in geziemender Weise die priesterlichen Gewänder an. In der Genesis gibt es eine Stelle, die uns helfen kann, in diesem Augenblick unsere Gedanken zu den Glaubenswahrheiten zu erheben. Als Jakob es wagen wollte, Isaak zu nahen, um seinen Segen zu empfangen, legte seine Mutter Rebekka ihm die Kleider Esaus an. Dann sprach er kühn zum Vater: «Ich bin dein erstgeborener Sohn» (Gen 27, 19). Die Kirche, unsere Mutter, sagt: «Geh zu Jesus Christus, deinem erstgeborenen Bruder» (Röm 8, 29); «bekleide dich mit ihm» (Röm 13, 14). Jetzt können wir ruhig zum Vater gehen. Er sieht in uns trotz unserer Unwürdigkeit einen «Alter Christus - Zweiten Christus».
Für jene, die von Gott dazu angeregt werden, ist es auch eine ausgezeichnete Vorbereitung auf die Darbringung des heiligen Opfers, sich mit der Gesinnung zu vereinen, die Maria unter dem Kreuz beseelte, mit ihr die Hinopferung ihres Sohnes zu vollziehen (S. unten, S. 390).
Während des Zelebrierens müssen wir genau die Rubriken beobachten; das ist ein Ausdruck der Ehrfurcht. Der Priester, der im Geist der Gottesverehrung die vorgeschriebenen Zeremonien vollzieht, ist Gott sehr wohlgefällig.
Wenn wir beim Offertorium Brot und Wein darbringen, vergessen wir nie, mit der Hostie, die auf der Patene liegt, und mit dem Wein im Kelch unsere Handlungen und uns selbst aufzuopfern. Sieht Jesus uns als «Opfergaben», dann opfert er sich seinem Vater zusammen mit uns. Wird die Aufopferung am Morgen in einem Tagewerk voll treuer Pflichterfüllung fortgesetzt, dann steht das ganze Leben des Priesters im Kraftfeld der Messe.
Bemühen wir uns beim Zelebrieren um die Gesinnung, die in den liturgischen Worten und Handlungen zum Ausdruck kommt. Die Vorschrift des hl. Benedikt : «Unser Geist stimme mit dem Wort überein» gilt vornehmlich für die Gebete, die am Altar gesprochen werden.
Viele der Messtexte erinnern uns an die Verherrlichung Gottes, die durch unsern Dienst vollzogen wird. Ist die Messe nicht der hervorragendste Akt der Gottesverehrung? Die Formeln «Gloria Patri, Suscipe, sancte Pater, Per ipsum, Placeat» sagen uns immer wieder, dass unser Blick auf den Vater, auf die heiligste Dreifaltigkeit gerichtet sein muss: «�Wir opfern ruhmvoll Deiner Majestät.»
Doch richten wir im Zusammenhang mit den liturgischen Texten unser Augenmerk auch auf die Schätze des göttlichen Erbarmens und die Nöte der Menschen. In der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten treten wir für das Volk ein. Wenn wir an den Stufen des Altares stehen, vermögen wir wirksamere Fürsprache für das Volk einzulegen als der Priester des Alten Bundes es im Allerheiligsten, in der Gegenwart Gottes, tat; denn wir stützen uns in unsern Gebeten auf die Kraft des Blutes Jesu.
Die beste Art der Danksagung ist die durch Jesus selbst. Doch mögen wir während der Feier der Messe noch so sehr von Dankbarkeit durchdrungen sein, so ist es doch höchst geziemend, dem Herrn auch nach der Messe aus tiefster Seele Dank zu sagen. Jeder kann da dem Antrieb des Heiligen Geistes folgen, aber gesellen wir uns nicht zu jenen, die den Vorwurf verdienen, dass sie viel empfangen und wenig gedankt haben.
Die gebräuchlichen Gebete, die für die Danksagung nach der Messe empfohlen werden, sind ausgezeichnet. Im «Benedicite» hauchen wir gleichsam allen Geschöpfen Leben ein, damit sie Gott loben; der Mensch wird so das Herz alles dessen, was seiner Natur nach nicht lieben kann, um alles zum Herrn heimzuführen.
Es ist gut, nach diesen mündlichen Gebeten einige Zeit der persönlichen Zwiesprache mit Gott zu widmen. Diese Danksagung muss vor allem ein Akt höchster Anbetung sein. Je mehr Jesus sich erniedrigt und verhüllt, umso mehr muss unser Herz seine göttliche Majestät anerkennen: «Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, an dem der Vater sein Wohlgefallen hat. Und weil ich das glaube, übergebe ich mich dir mit voller innerer Bereitschaft, um in allem deinen Willen zu vollbringen.»
Nach der allgemeinen Auffassung vollzieht sich die Hauptwirkung des Sakramentes im Augenblick der Mandukation. Doch wie lange auch die Integrität der heiligen Gestalten in uns dauern mag, der Erlöser hört nicht auf, durch seine Vereinigung mit der Seele Quell göttlichen Segens für sie zu sein; deshalb, ist die Zeit der Danksagung so kostbar, weil wir in diesen Augenblicken lernen sollen, uns Christus anzuschließen und mit ihm eins zu werden in Liebe. Das intensivere Gebet nach der Kommunion trägt dazu bei, einen dauernden Zustand der Sammlung zu schaffen, was überaus wertvoll ist. Sagte doch Jesus nach dem Letzten Abendmahl, als die Jünger kommuniziert hatten: «Vater, ich will, dass sie, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin» (Joh 17,24). Durch die Gnade des Sakramentes zieht Christus uns an sich, um uns in sich zum Vater zu erheben.
Ist der Priester gezwungen, nach der Messe Beichte zu hören, ein Begräbnis zu halten, den Kindern Religionsunterricht zu erteilen, braucht er sich nicht entmutigen zu lassen, wenn er durch diese Funktionen verhindert ist, sich zu sammeln. Er sei vielmehr von der Wahrheit folgender Erwägungen überzeugt: diese Amtshandlungen sind als Fortsetzung des heiligen Opfers zu betrachten, denn sie wenden den Seelen die Früchte der Erlösung zu; sind sie nicht gewissermaßen eine Huldigung der Liebe an Christus in seinen Gliedern? Und schließlich, wenn man die heilige Eucharistie ehrfurchtsvoll empfangen und andächtig die Schlussgebete der Messe gesprochen hat, so ist das schon als eine wirkliche Danksagung anzusehen. Gewiss, die Texte der «Postcommunio» sprechen gewöhnlich nicht ausdrücklich von Dankbarkeit; wir bitten darin um Anteil an den Heilswirkungen des Sakramentes. Dennoch schließen diese Bitten ohne Zweifel Hochschätzung vor der göttlichen Gabe ein und bezeugen dadurch unsere tiefe Dankbarkeit.
So groß auch der Wert der Messe selbst als Danksagung sein mag, es ist wichtig, ja notwendig, dass der Priester nach der Messe ausdrücklich dem Herrn dankt, wenn die Umstände es gestatten; denn - vergessen wir das niemals in diesen heiligen Augenblicken ruht der geliebte Sohn, der im «Schoß des Vaters» wohnt, in «Schoß des Sünders».
XIII. DAS EUCHARISTISCHE MAHL
«Seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat: Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es» (1 Joh 3,1). Gott ist unser Vater, er liebt uns mit unfassbarer Zärtlichkeit. Alle Liebe, die es in der Welt gibt, kommt von ihm und ist nur ein Schatten seiner grenzenlosen Liebe. «Kann wohl eine Mutter ihres Kindes vergessen?», spricht der Herr durch den Mund des Propheten. «Und selbst wenn sie es vergäße, so werde ich doch eurer niemals vergessen» (Jes 49, 15).
Die Liebe will sich verschenken; so vereinigt sie sich inniger mit dem Gegenstand ihrer Zuneigung. Gott ist die Liebe selbst (1 Joh 4, 8); er hat immer den inständigen Wunsch, sich uns mitzuteilen. Deshalb schreibt der hl. Johannes: «So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie dahin gegeben hat» (Joh 3, 16).
Der Sohn, der die Liebe des Vaters teilt, hat Knechtesgestalt angenommen und sich zum Kreuzestod ausgeliefert: «Eine größere Liebe hat niemand» (Joh 15, 13).
Und jetzt noch verbirgt er sich unter den Gestalten des Brotes und des Weines, um sich auf das innigste mit uns zu vereinigen. Die heilige Eucharistie ist die letzte Auswirkung der Liebe, die sich schenken will; sie ist das Wunder der Allmacht im Dienst der unendlichen Liebe.
«Alle Werke Gottes sind vollkommen» (Dtn 32, 4). Darum hat der himmlische Vater seinen Kindern ein Festmahl bereitet, das seiner würdig ist. Er bietet ihnen nicht materielle Nahrung, nicht ein Manna, das vom Himmel herabregnet; er gibt ihnen den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit seines einzigen Sohnes Jesus Christus.
In diesem Leben werden wir niemals die Erhabenheit dieser Gabe erfassen; selbst im Himmel werden wir sie nicht voll begreifen, denn die Eucharistie ist der sich schenkende Gott, und er allein kennt sich ganz.
Bei diesem Mahl empfangen wir den Sohn des Vaters, die Seligkeit des Himmels; während der ganzen Ewigkeit wird er die Speise der Engel und der Heiligen bilden. Mehr noch, der ewige Vater selbst sagt, dass er seine Wonne in ihm findet: «Dieser ist mein vielgeliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe» (Mt 17,5). Gott könnte uns an keinem kostbareren Gut Anteil gewähren. «Wisst ihr nicht», sagt Jesus, «dass ich in meinem Vater bin und mein Vater in mir?» (Joh 14,10). Und den Philippus belehrt er: «Wer mich sieht, sieht den Vater» (Joh 14, 9) Durch die Kommunion besitzen wir die heiligste Dreifaltigkeit in unsern Herzen, denn der Vater und der Heilige Geist sind notwendigerweise dort, wo der Sohn ist; sind sie doch drei in einem einzigen Wesen.
1. Die Parabel vom Hochzeitsmahl
Es ist nicht leicht, über die Eucharistie etwas Neues zu sagen.
Die Betrachtung einer Seite des Evangeliums kann unserm Glauben größere Klarheit geben. Diese Stelle gibt uns Aufschluss über die Verbindung, die in der Eucharistie zwischen Christus und uns hergestellt wird.
Wir kennen die Parabel vom Hochzeitsmahl. Christus sagt: «Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn Hochzeit hält» (Mt 22, 2 ; Lk. 14, 16).
Wer ist dieser König, dieser Sohn, wer sind die Gäste dieses Hochzeitsmahles ? Verbirgt sich unter dem Gleichnis ein Geheimnis ?
Nach den Kirchenlehrern ist der König der himmlische Vater.
Als der Vater zur Rettung der Welt die Menschwerdung des Logos beschloss, da bereitete er im Hinblick auf die Vereinigung der menschlichen Natur mit der göttlichen Person ein wunderbares Hochzeitsfest vor. Die Menschwerdung des Wortes trägt hochzeitlichen Charakter, weil der Sohn Gottes die heilige Menschheit, die er empfing, zu seiner Braut machte. So war schon die Menschwerdung die «Hochzeit des Lammes» (Offb 19, 7) im höchsten Sinn.
«Dieses Geheimnis», so sagt der hl. Gregor, «vollzog sich in Maria, als der Engel ihr die Botschaft brachte» (Homil. 38 in Evang. P. L. 76, Sp. 1283).
Zwei Naturen in einer Person: welche Einheit des Wesens, welch innige Verbindung in Liebe! «Wer ist sie, die aus der Steppe heraufsteigt, auf ihren Geliebten gestützt?» (Hld 8, 5). Die Menschheit des Erlösers ist «diese makellose Braut, mit Wonne überhäuft, die sich in der Wüste dieser Welt erhebt, gestützt auf das Wort, ihren Vielgeliebten».
Die Liturgie besingt «die Wunder dieser Vereinigung», «Wunderbares Geheimnis ... Gott ist Mensch geworden». Der Sohn Gottes nimmt eine Menschennatur an, die aus dem Nichts stammt, ohne dass sich die Herrlichkeit seiner ewigen Vollkommenheit vermindert hätte. Und diese Vereinigung verursacht keine Vermischung von Gott und Mensch; im Gegenteil, sie wahrt völlig die Unterscheidung der beiden für immer untrennbaren Naturen (Antiphon vom Fest der Beschneidung).
Hierin ist die Lehre von der Menschwerdung ausgedrückt. Nach demselben Kirchenlehrer «hat der Vater gemäß den Plänen seiner Barmherzigkeit durch die Menschwerdung die hochzeitliche Verbindung seines Sohnes mit der Kirche verwirklichen wollen» (Antiphon vom Fest der Beschneidung). Christus vereinigt sich mit seiner Kirche vornehmlich dadurch, dass er sich mit jeder Seele durch die heiligmachende Gnade und die Liebe verbindet. Der heilige Paulus schreibt an die Korinther: «Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als reine Braut Christus zuzuführen» (2 Kor 11, 2). Beachten wir, der Apostel wendet sich hier nicht nur an die Jungfrauen, sondern an die Gesamtheit der Getauften: durch die Gnade der Annahme an Kindes Statt ist nach ihm jeder Christ berufen, sich in Liebe mit Christus zu vereinigen.
Doch zurück zur Parabel. Der König hatte viele Gäste eingeladen, an dem Festmahl teilzunehmen, doch alle entschuldigten sich. Da sandte er seine Diener auf die Straßen; sie sollten die Armen zu dem reichen Festmahl laden, das er bereitet hatte. Der Festsaal wurde so den Niedrigen, den Siechen und sogar den Krüppeln geöffnet.
Wen versinnbildet diese Menge? Mit Origines, dem hl. Hieronymus und auf Grund der liturgischen Verwendung einiger Worte dieser Parabel sehen wir darin das christliche Volk, das durch die göttliche Freigebigkeit zum eucharistischen Mahl geladen wurde. Wer an den heiligen Geheimnissen teilnimmt, wird der Liebesvereinigung gewürdigt, die den Gästen des Festmahles vorbehalten ist; Christus ergreift Besitz von ihren Seelen, und sie besitzen ihn ihrerseits im Glauben und in der Liebe.
Diese Vereinigung - seien wir uns dessen stets bewusst ist in gewisser Weise ein Abbild jener der heiligen Menschheit mit dem Göttlichen Wort; sie ist das Vorbild aller innigen Liebesverbindungen zwischen dem Geschöpf und seinem Gott.
So erhaben ist das übernatürliche Leben, zu dem wir alle berufen sind.
2. Die Messe, das Festmahl des Gottessohnes
Dieses Festmahl wird alle Tage bereitet: das Hochzeitsmahl des Gottessohnes erneuert sich jeden Morgen beim heiligen Opfer. Priester und Gläubige sind geladen, daran teilzunehmen.
Dieses Geheimnis der Vereinigung hat die göttliche Weisheit erdacht und der Kirche zur Verwaltung anvertraut. In ihrem Schoß ist die Messe der Mittelpunkt, von dem die Gnade auf das tägliche Tun der Glieder Christi ausgeht. Besonders für den Priester empfangen das Offizium, die Betrachtung, die Seelsorge, alle Arten seines Einsatzes ihren übernatürlichen Impuls von der heiligenden Kraft dieses göttlichen Opfers. Das ist in der Sekret vom Fest des hl. Ignatius von Loyola ausgesprochen: « … auf dass die hochheiligen Geheimnisse, worin du die Quelle aller Heiligkeit beschlossen hast, auch uns in Wahrheit heiligen.»
Wie aber werden wir der Gnaden teilhaft, die vom Messopfer ausgehen ?
Vor allem durch die heilige Kommunion. Die Eucharistie ist in hervorragender Weise das Sakrament, das dem Priester und den Anwesenden die Früchte des Kreuzesopfers zuwendet. Das Gebet «Supplices» im Kanon spricht das sehr klar aus. Wir bitten da, dass «alle, die wir gemeinsam von diesem Altar das hochheilige Fleisch und Blut Jesu Christi empfangen, mit allem Gnadensegen des Himmels erfüllt werden». Die Gabe der Eucharistie ist die Antwort der Liebe des Vaters auf die Darbietung seines Sohnes, die wir vollziehen. In unfassbarer Herablassung will der Vater Priestern und Gläubigen die Opfergabe zur Speise geben und ihnen die unermesslichen übernatürlichen Güter verleihen, deren Ursprung die Messe ist.
So vereinigt sich Christus mit allen Gliedern seiner Kirche in Liebe; er macht sie an allem reich: «an allem reich geworden seid in ihm» (1 Kor 1, 5). Durch die Eucharistie lässt er ihnen die Früchte der Erlösung zukommen: «Dass wir die Frucht Deiner Erlösung allzeit in uns erfahren.» (Oration vom Fronleichnamsfest). Bei der Heiligen Messe wird uns dieser «Frucht der Erlösung» durch die heilige Kommunion gegeben. Die Kommunion kann darum niemals als Nebensache, als eine sekundäre Übung in unserm religiösen Leben betrachtet werden. Denn wenn Jesus zu uns kommt, «kommt er» nach der Versicherung des Evangeliums, «um uns sein Leben mitzuteilen»; und das tut er nicht karg, sondern «mit göttlicher Überfülle», «Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle habent» (Joh 10, 10). «Wenn wir doch die Gabe Gottes erkännten!» (Vgl. Joh 4, 10.).
3. Die Erhabenheit des Lebens, zu dem die Kommunion uns aufruft
Durch die eucharistische Vereinigung ist der Christ und vor allem der Priester - zu einem Leben von großer Erhabenheit berufen; wir können gar nicht oft genug daran erinnern.
Christus ist das vollendete Vorbild der menschlichen Vollkommenheit, die der Vater in seinen angenommenen Kindern sehen will: «bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben» (Röm 8, 29). Wir alle sind verpflichtet, wenn auch in verschiedenem Grad, zu dieser übernatürlichen Ähnlichkeit zu gelangen, sonst dürfen wir nicht am himmlischen Hochzeitsmahl teilnehmen. Nur die Gleichförmigkeit mit dem menschgewordenen Sohn führt zu jenem gehobenen geistlichen Leben, zu jener Harmonie zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen, die der Vater von uns erwartet.
Worin besteht die Heiligkeit Jesu ? - In der heiligsten Dreifaltigkeit ist der Vater der Ursprung, von dem der Sohn alles empfängt, was er ist; deshalb hat Jesus gesagt: «Wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben» (Joh 5,26). Auch die Menschheit Jesu in ihrer unvergleichlichen Erhabenheit empfängt vom Vater alles, was sie ist; aus dem Innersten des Vaters strömte Jesus unaufhörlich göttliches Leben zu; dadurch besaß er die Fülle der heiligmachenden Gnade, die eingegossene Liebe, die Tugenden, die Gaben des Heiligen Geistes.
Die hypostatische Union heiligte schon aus sich selbst die Seele und den Leib Christi; diese «Gnade der Vereinigung» mit dem ewigen Sohn Gottes ist die Wurzel aller andern Gaben, die der Vater der Menschheit Jesu verliehen hat, um es ihm zu ermöglichen, seine Mission als Erlöser auf göttliche Weise zu erfüllen.
So hörte die Seele Jesu nicht auf, den Vater und das Göttliche Wort und den Heiligen Geist zu betrachten. In der Einheit der göttlichen Person sind die zwei Naturen sicher unterschieden, aber dennoch sind sie in einer unaussprechlichen Verbindung zusammengeschlossen. Alles kam Jesus vom Vater als der einzigen Quelle zu, und Jesus gab alles dem Vater zurück und verherrlichte ihn durch jede seiner Handlungen.
Das ist der Zustand der Heiligkeit in seiner erhabensten Vollkommenheit, zu der Jesus die Seelen der Kommunizierenden führen möchte.
Als Gott der Kirche die Eucharistie gab, wollte er ohne Zweifel, dass Christus unter den heiligen Gestalten dargebracht und hingeopfert, dass er im Tabernakel angebetet, besucht und geliebt werde, aber er wollte auch, dass sein Sohn uns Nahrung sei, um uns Teilnahme am göttlichen Leben zu gewähren: «Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, werdet ihr das Leben nicht in euch haben» (Joh 6, 53).
Das gewöhnliche Brot erhält die Körperkräfte, obwohl es selbst nicht lebendig ist; doch wenn wir das Brot und den Wein in der Eucharistie genießen, dann ist es etwas Lebendiges, dann ist es Jesus, der in uns eindringt, von uns Besitz nimmt und uns durch diese Vereinigung mit sich verähnlicht. Sagte er doch: «Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist» (Joh 6, 51).
Das göttliche Leben in sich ist unerreichbar, aber durch dieses Sakrament kommt es zu uns. Alles Wachstum der Heiligkeit, die der Vater seinen angenommenen Kindern verleihen will, ist in Jesus vorhanden, bereit, uns mitgeteilt zu werden.
Betrachten wir das Wunder: die Seele des Erlösers stand in unaufhörlicher Verbindung mit dem Logos und wurde durch ihn belebt; unsere sakramentale Verbindung mit Christus dauert jeden Tag nur ein paar Augenblicke, aber wie groß ist dennoch ihre heiligende Kraft! Diese Verbindung ist sicher nicht so eng wie die zwischen dem Logos und seiner Menschheit; aber ruht nicht der Urheber der Gnade in der Seele? Er bekleidet sie mit seinen Verdiensten, er befähigt sie, aus der Gnade der Annahme an Kindes Statt zu leben und öffnet ihr den Zugang zur Dreifaltigkeit: «Wenn jemand mich liebt ... wird ihn mein Vater lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen» (Joh 14, 23).
Die sakramentale Vereinigung, die die göttliche Weisheit herbeiführt, ahmt so ganz die des Logos mit seiner Menschheit nach, dass Jesus uns versichert: «Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben» (Joh 6,57). Wir können unmöglich die Tiefe des Geheimnisses der eucharistischen Vereinigung erfassen, ohne uns über diese Parallele klar zu werden, die der göttliche Meister selbst gewollt hat. Staunen erfasst uns, wenn wir die wunderbare Erhöhung betrachten, die dieser Vergleich ahnen lässt; lassen wir uns durchdringen von der Wahrheit, die er uns enthüllt. Das wird für alle Kommunionen, die wir im Lauf unseres Priesterlebens empfangen, eine Vertiefung der Ehrfurcht und des Vertrauens auf die Gnade bewirken. Der hl. Hilarius fasst diese erhabenen Wahrheiten in die Worte zusammen: «Christus empfängt sein Leben vom Vater, und wie er durch den Vater lebt, so leben wir durch sein Fleisch» (De Trinitate, VIII. P. L. 10, Sp. 248).
Unter die hohen Vorzüge der Heiligen Messe zählt der, dass sie in Wahrheit ein Hochzeitsmahl ist. Im Augenblick der Menschwerdung hat der Vater seinem Sohn eine menschliche Natur gezeigt, die bestimmt war, als makellose Braut mit ihm vereint zu werden. Am Altar zeigt der Priester Christus Seelen, die der Herr beleben soll: seine eigene Seele und die der Anwesenden, damit der Erlöser sich ihnen schenke und sie an seinem eigenen Leben teilnehmen lasse.
Versuchen wir zu erfassen, welch ein Ruf zur Höhe in der Kommunion an uns ergeht. Denn unser Fortschritt in der Heiligkeit hängt zu einem großen Teil von der Art ab, in der wir für gewöhnlich am eucharistischen Mahl teilnehmen.
4. Wirkungen der Kommunion
Die Betrachtung über die Natur der göttlichen Vereinigung, die durch die Eucharistie in uns bewirkt wird, ist noch nicht alles, was wir im Hinblick auf dieses wunderbare Sakrament erwägen sollen. Suchen wir konkreter zu erkennen, welche Gnaden jede Kommunion der Seele vermittelt.
Die Sakramente bringen die Wirkung hervor, die in ihrem sichtbaren Zeichen zum Ausdruck kommt. Die heilige Eucharistie wurde als Mahl eingesetzt und muss folglich in der übernatürlichen Ordnung eine geheimnisvolle Nahrung für das Leben der Seele sein.
Die körperliche Nahrung wird zuerst aufgenommen; dann assimiliert sie der Organismus und so erhält sie sein Leben und sichert das Wachstum. Das eucharistische Brot wirkt ähnlich in uns. Wenn wir es «mit dem Munde aufnehmen», vereinigt sich Christus mit der Seele: «nehmen wir es mit reinem Geist auf». Er befruchtet und vermehrt in ihr das göttliche Leben, dessen Keim bei der Taufe in sie eingesenkt wurde.
Die gewöhnliche Nahrung wird in unsere eigene Substanz umgewandelt; doch beim Empfang der Eucharistie wandeln wir Jesus nicht in uns um, sondern er, das Lebensbrot, wandelt uns in sich um. Was im Geheimnis dieser Vereinigung geschieht, spricht der hl. Augustinus mit den Worten aus, die er dem Herrn in den Mund legt: «Ich bin die Nahrung der Großen; wachse, und du wirst mich essen. Doch du wirst mich nicht in dich umwandeln wie deine materielle Nahrung, sondern du wirst dich in mich verwandeln» (Confessiones, VII, 10. P. L. 32, Sp. 742).
Die erste sakramentale Wirkung der Kommunion «ex opere operato - aus dem vollzogenen Werk heraus» ist das Wachstum der heiligmachenden Gnade. Sie macht uns durch jede würdige Kommunion Gott ähnlicher, «gottförmiger» durch «eine übernatürliche Teilnahme an seiner Natur», damit ihr «an der göttlichen Natur Anteil erhaltet» (2 Petr 1, 4).
Um die Vereinigung des Menschen mit Christus in ihrer Fülle zu verwirklichen, hat der Vater dem Sakrament die besondere Kraft verliehen, die habituelle Liebe in uns zu beleben, ihr Inbrunst zu geben. Durch diese Liebe, die eine Frucht der Eucharistie ist, nähern wir uns nicht bloß Christus, sondern sie vereinigt uns mit ihm; und in dieser innigen Verbindung formt sie uns allmählich in den Gegenstand unserer Liebe um: «In virtute huius sacramenti», so lehrt der hl. Thomas, «fit quaedam transformatio hominis ad Christum, per amorern» (IV Sententiarum, Distinctio XII, q. 2, a. ). So groß ist die Innigkeit der göttlichen Gegenwart, dass der Erlöser sagen konnte: «Wer mein Fleisch isst ... , der bleibt in mir und ich in ihm» (Joh 6, 56).
Wenn die Seele sich so freiwillig in Liebe an Christus anschließt, wird die Übung der christlichen Tugenden intensiviert. Nichts hilft dem Priester so sicher, das Beispiel Jesu nachzuahmen, wie die Liebe: Wenn wir heilig sein wollen, muss der Vater in uns die Züge seines menschgewordenen Sohnes finden; wir sollen Christus so ähnlich werden, dass der Vater uns als seine wahren Kinder anerkennt. Die Eucharistie unterstützt uns wirksam bei dem Bemühen um Umgestaltung in Christus; sie gibt uns die Gnaden, deren wir bedürfen, um Jesus in allem gleichförmig zu werden durch Annahme des göttlichen Willens, durch unsere Hingabe an den Nächsten, durch Geduld und Verzeihen.
Wir alle wünschen, eifrige Priester zu sein. Vielleicht sind wir von Natur aus schwach; vielleicht sind wir energisch. Doch dieses Sakrament vermittelt allen die Kraft Gottes. Das Brot, das er dem Elias gab, um ihn in seiner Entmutigung zu stärken, war ein Sinnbild der Eucharistie: «In der Kraft dieser Speise wanderte er bis zum Gottesberge» (1 Kön 19,8). Auch für uns ist die heilige Kommunion ein «Heilmittel für unsere Schwachheit», ist sie doch «fortitudo fragilium» (Postcommunio der Fastenzeit). Die Liebe, die sie in uns entzündet, ermöglicht es uns, Überdruß, Erschlaffung und Versuchungen zu überwinden; sie hilft uns, in der Nachfolge des göttlichen Meisters unser Kreuz zu tragen.
Ohne Zweifel tilgt die Eucharistie auch die lässlichen Sünden. Die Innigkeit der Liebe, eine unmittelbare Wirkung der Sakramentsgnade, weckt in der Seele Abneigung gegen alles, was die Vereinigung hindert. Diese Abkehr von der Sünde erlangt uns von Gott Verzeihung der lässlichen Sünden, an die wir keine Anhänglichkeit haben. Daher reinigt die Eucharistie die Seele von der Befleckung, die die Sünde zurückgelassen hat: «Ut in me non remaneat scelerum macula.» Überdies heilt sie uns durch den göttlichen Beistand, den wir in ihr empfangen, von unsern verkehrten Neigungen: «Unsere Gebrechen beseitigen.» (Postcommunio vom 17. Sonntag nach Pfingsten). Bitten wir nicht bei jeder Messe, sie «als Heilmittel» empfangen zu dürfen, «Ad medelam percipiendam» ?
Eine Wirkung der Eucharistie, die zu wenig beachtet wird, ist die geistliche Freude. Diese Gnade ist für unser Priesterleben sehr wichtig.
Die heilige Kommunion ist eine unermessliche Quelle der Freude, der reinsten, der innigsten, der unverlierbarsten Freude. Gott ist die Seligkeit selbst. Alle Freude, die die Schöpfung birgt, ist nur ein Widerschein, ein Schatten dieser unendlichen Glückseligkeit. Im Himmel herrscht so große Freude, dass St. Paulus sagt, kein Menschenherz habe sich je ein solches Glück erträumt. (Vgl. 1 Kor 2, 9.)
In der eucharistischen Vereinigung empfangen wir nicht nur einen Anteil an dieser himmlischen Seligkeit, sondern deren Urheber selbst mit der Fülle seines Reichtums. Die hl. Rosa von Lima sagt, im Augenblick der Kommunion sei es ihr gewesen, als nähme sie die Sonne in ihr Herz auf (Acta Sanctorum, 31. August, V, S. 958). Und fürwahr, wie die Sonne in der Natur Ursprung des Lichtes, der Lebenskraft, der Entfaltung ist, so ist Jesus durch die heilige Kommunion in der Seele die Quelle immerwährender Zufriedenheit und eines unbesiegbaren Mutes, in denen die Kraft des Christen liegt.
Ich spreche hier nicht von fühlbaren Tröstungen, sondern von der Hoffnung und der Freude, die St. Paulus meint, wenn er sagt: «Ich bin überreich an Freude inmitten aller Trübsal» (2 Kor 7, 4). Diese übernatürliche Fröhlichkeit gab den Martyrern die Kraft, in ihren Qualen zu lächeln und zu singen. Sie hatten sich zuvor gestärkt beim Hochzeitsmahl des Lammes; sie hatten kommuniziert.
Das Glück, das die Eucharistie schenkt, äußert sich bei manchen in großer Ausgeglichenheit und innerm Frieden. General de Sanis kommunizierte auch im Feld stets, wenn sich Gelegenheit bot. Am Abend der Schlacht von Solferino schrieb er: «Ich glaube, ich habe während dieses schrecklichen Tages keinen Augenblick die Gegenwart Gottes vergessen» (Mgr. Baunard, Vie, S. 112. ). Ist die Haltung dieses Soldaten mitten in Getümmel und Gefahren nicht ein ergreifendes Beispiel dafür, wie ruhig die Seele sein kann und soll, die durch die göttliche Gegenwart geheiligt wurde ?
Es kommt vor, dass unser Glaube uns kein Licht über die Wunder der Eucharistie gibt; aber bemühen wir uns doch, bei der Kommunion fest an die Wirklichkeit, an die Erhabenheit der wunderbaren Gabe zu glauben, die unsere Seele empfängt. Dieser lebendige Glaube wird eine langsame, aber sichere Umgestaltung unseres Priesterlebens bewirken.
Die Früchte dieses göttlichen Sakramentes besitzen einen solchen Gehalt, dass es unmöglich ist, ihre Lebensfülle zu erschöpfen. Jeder Versuch, alles darüber zu sagen, ist zum Scheitern verurteilt. Doch wir wollen wenigstens noch auf eine letzte Wirkung der Eucharistie hinweisen: sie ist das Unterpfand der künftigen Seligkeit (Antiphon der Vesper vom heiligsten Altarssakrament). Sie bereitet uns auf das himmlische Festmahl im Reich des Vaters vor, das uns Christus selbst beim Letzten Abendmahl verheißen hat, das Festmahl, bei dem er die Auserwählten mit seiner Herrlichkeit beglücken wird: «mich satt sehen, wenn deine Herrlichkeit aufscheint» (Ps 16, 15). Ist uns das ganz bewusst, wenn wir beten: «Der Leib ... und das Blut des Herrn bewahre meine Seele zum ewigen Leben» ?
5. Einheit in Christus
Alle Wirkungen der Eucharistie, die wir bisher betrachteten, beziehen sich auf jeden von uns im besonderen. Doch die Eucharistie ist auch das Sakrament der Vereinigung mit Christus als dem Haupt des mystischen Leibes. Sie fügt die Gläubigen voll und ganz in die übernatürliche Ordnung ein, die Christus und uns zu einem einzigen, unvergleichlichen Organismus zusammenschließt.
Wir müssen in uns das Verständnis für die Zugehörigkeit zum «Corpus mysticum» vertiefen. Für uns Priester ist dieser Aspekt des Glaubens unerlässIich, um den Eifer für die uns Anvertrauten wachzuhalten.
Jesus wünscht sehnlich, dass sich in seiner Kirche diese Einigung der Gläubigen mit ihrem Haupt und untereinander verwirkliche. Nachdem er beim Letzten Abendmahl das allerheiligste Sakrament eingesetzt hatte, wendete er sich an seinen Vater. Und was erbat er von ihm? Die Einheit aller in ihm. «Heiliger Vater, bewahre sie... damit sie eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir ... So lass auch sie vollkommen eins sein» (Joh 17, 11; 21, 23). Messe und Kommunion - das Hochzeitsmahl des Gottessohnes - sind die hervorragendsten Heilmittel, um diese erhabene Einheit zu begründen: «Weil es ein Brot ist, so bilden wir viele einen Leib. Wir nehmen ja alle an dem einen Brot teil» (1 Kor 10, 17). Kraft des Sakramentes vermögen die Seelen in das Geheimnis des mystischen Leibes einzudringen; so wird bewirkt, dass sie dem Herrn enger verbunden sind, mehr von seinem Leben leben, sich eifriger seinem Dienst widmen.
Die eucharistische Vereinigung fordert vom Gläubigen, Christus zu lieben, und mit ihm, um seinetwillen seinen mystischen Leib. Die Gnade dieses Sakramentes befähigt uns, den «ganzen Christus» zu lieben, das Haupt und die Glieder und alle Seelen, die er durch sein Opfer erlöst hat. Die Liebe ist so das starke übernatürliche Band, das zwischen der Erde und dem Himmel eine wunderbare Verbindung aller Glieder untereinander bewirkt.
Das Reich der Liebe Christi in seiner Kirche soll immer mehr Gegenstand unserer Wünsche, unseres Einsatzes, unserer Predigt sein. Arbeiten wir auf seine Verwirklichung hin in der Diözese, in der Pfarrei und allen ihren Einrichtungen und Organisationen, in unserer unmittelbaren Umgebung. Die Liebe wird uns drängen, dem Nächsten Achtung und Zuneigung zu bezeigen, uns selbstvergessen für ihn einzusetzen. Im Augenblick der Kommunion wird sie die Erinnerung an das Unrecht der andern aus unsern Herzen verbannen; sie wird uns Gleichgültigkeit und Kälte überwinden und alles Trennende vergessen lassen. So werden wir durch die Eucharistie, das Sakrament der Einheit, immer mehr in Christus eingegliedert werden, wie es in der Postcommunio vom Samstag nach dem dritten Fastensonntag erfleht wird: «Wir bitten dich, allmächtiger Gott, lass uns unter die Glieder dessen gezählt werden, an dessen Leib und Blut wir teilnehmen.»
Bleibt die heilige Menschheit in der Seele jedes Gliedes des «Corpus mysticum» gegenwärtig?
Durch die Kommunion treten wir sicher in Verbindung mit Jesus und stellen uns unter seine Herrschaft. Das Konzil von Ephesus erklärt: «Das Fleisch Christi ist lebenspendend, weil es das Fleisch des Göttlichen Wortes ist» (Canon II). In dem Sakrament berührt und heiligt Jesus die Seele, nimmt von ihr Besitz. Er wirkt in ihr. Solange die heiligen Gestalten sich nicht aufgelöst haben, genießt die Seele diesen «contactus virtutis - Berührung der Kraft»; sie wird abhängiger von dem Wirken des Herrn, fester mit seinem mystischen Leib vereinigt.
Doch auch wenn die sakramentale Gegenwart aufhört, bleibt der Gläubige als Glied Christi stets unter dem Einfluss des Erlösers. Christus leistet ihm inneren und äußern Beistand und befruchtet sein übernatürliches Leben. «Er wohnt gewissermaßen in seinem Herzen.» «Durch den Glauben, wohne Christus in euren Herzen» (Eph 3, 17). Mit diesen Worten will der Apostel nicht auf die eucharistische Gegenwart hinweisen, sondern auf jene wirksame, innige und beständige Vereinigung, durch die Christus, das menschgewordene Wort, ständig in der Seele eines jeden von uns lebt.
6. Hindernisse für die Fruchtbarkeit der Kommunion
Wir klagen zuweilen, dass unsere Kommunionen keine größere Wirkung ausüben; und wir hören von frommen Seelen dieselbe Klage. Und doch, «dieses Brot vom Himmel enthält alle Süßigkeit in sich», «Omne delectamentum.» (Versikel des Offiziums vom Fronleichnamsfest).
Der geringe Eifer beim Empfang der heiligen Kommunion rührt von verschiedenen Ursachen her. Manche davon sind vorübergehender Art: der Gesundheitszustand, die Umgebung, quälende Sorgen, die beim Zelebrieren auftauchen, können uns hindern, in Frieden die Gegenwart Gottes zu genießen.
Doch lassen wir diese besonderen Ursachen beiseite und beschäftigen wir uns mit zwei Hindernissen, die jedem begegnen können und denen man die Stirn bieten muss: Mangel an Lebendigkeit des Glaubens oder Vorbehalte in der Hingabe seiner selbst.
Die Eucharistie ist in hervorragender Weise das «mysterium fidei - Geheimnis des Glaubens». Wenn wir die konsekrierte Hostie betrachten, verrät nichts unsern Sinnen die wirkliche Gegenwart unseres Erlösers. Dennoch ist er da, in seiner ganzen Majestät und seiner himmlischen Herrlichkeit, mit derselben Liebe, die er uns auf Erden schenkte. Nur der Glaube kann jenseits der Gestalten des Brotes und Weines dieses Geheimnis erfassen.
Wenn im Augenblick der Kommunion unser Glaube schwach oder doch nicht wach ist, oder wenn wir uns durch äußere Dinge ablenken lassen, können wir den Wert der Gabe des Vaters und der erbarmungsvollen Herablassung Jesu nicht richtig schätzen. Fehlt der Glaubensgeist, dann bleiben wir gleichgültig gegen die übernatürlichen Reichtümer, die uns in der Eucharistie zufließen.
Ist der Glaube hingegen wach, dann ist die Seele gleichsam von Bewunderung hingerissen; sie weiß, dass die Gabe Christi an die Welt und an jeden einzelnen stets gegenwärtig, stets wirksam bleibt. Durch dieses Sakrament werden wir wirklich «mit der ganzen Gottesfülle erfüllt». Diese Fülle empfangen wir, «so werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt» (Eph 3, 19).
Wenn wir darunter leiden, dass unser Herz trotz aller Vorbereitung angesichts dieser Wunder empfindungslos bleibt, dann betrüben wir uns darob nicht. Gott verlangt nicht, dass wir die übernatürlichen Wahrheiten mit dem Gefühl erfassen; im Dunkel des Glaubens und mit dem Willen sollen wir ihn lieben, ihm dienen. Gefühle sind soweit nützlich, als sie unsern Glauben beleben. Bei der Kommunion und unserm inneren Verkehr mit dem eucharistischen Gott wollen wir uns bemühen, uns mit dem Herrn im Glauben zu vereinigen, wie der hl. Paulus sagt: «lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes» (Gal 2, 20).
Eine zweite innere Vorbereitung, deren Unterlassung die Wirkungen der Kommunion stark vermindert, ist die Hingabe seiner selbst. Wenn Christus sich uns schenkt, geziemt es sich da nicht, dass auch wir uns ihm ganz ausliefern ?
Diese Hinopferung unser selbst ist die Übergabe unseres ganzen Lebens an den Herrn, eine Annahme seines Willens für die Gegenwart und für die Zukunft. Sie ist die hervorragendste «dispositio unionis - Vorbereitung der Einheit» und bewirkt, dass Christus nichts in uns findet, was seiner Herrschaft über die Seele entgegenwirkt.
«Kommunion» heißt «Vereinigung mit Jesus». Diese Vereinigung vollzieht sich nur dann, wenn dem Erlöser eine Seele begegnet, mit der er in seiner Heiligkeit, in seiner Liebe eins werden kann. Christus kann sich nicht mit ihr vereinigen, wenn sie nicht demütig ist, wenn sie ihn nicht voll und ganz aufnimmt, wenn sie ihre Standespflichten vernachlässigt und vornehmlich dann, wenn sie sich dem Nächsten verschließt durch Mangel an Liebe oder an Bereitschaft zum Verzeihen. Wäre es nicht falsch, zu beteuern, man vereinige sich mit dem Haupt, wenn man sich zugleich von den Nöten seiner Glieder abwendet und ihnen die Liebe versagt? Was unsere Vereinigung mit Christus hindert, ist unsere Eigenliebe, unsere Empfindlichkeit, sind unsere ehrgeizigen Zukunftspläne, unser selbstsüchtiges Streben, unsere allzu irdischen, allzu menschlichen Ansichten: das alles hindert die volle Gleichförmigkeit unseres Willens mit Jesu Willen.
Nicht unsere Schwachheit, nicht einmal unsere Sünden sind ein Hindernis für die volle Wirkung des Sakramentes, wenn wir nur keine Anhänglichkeit an sie haben, sie bereuen. Jesus kommt zu uns, um uns die Kraft zum Kampf gegen unsere Fehler zu geben. «Er hat unsere Leiden getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen» (Jes 53, 4).
Das vollendetste Vorbild für diese Hingabe seiner selbst ist Christus. Die Kirchenväter sprechen von einer hochzeitlichen Begegnung der beiden Naturen in ihm. Wenn wir kommunizieren, vollzieht sich unsere Begegnung mit Christus in der Liebe; Christus zieht uns an sich, er vereinigt uns mit sich, damit wir für immer ihm gehören.
Welches war die Grundhaltung der Menschheit Jesu von der Inkarnation an? Sie hat sich restlos hingegeben wie die Braut dem Bräutigam. «Ja, ich komme … um deinen Willen, Gott, zu tun» (Hebr 10, 7). Und Maria war ohne Zweifel ihr ganzes Leben lang von der Gesinnung beseelt, die sich in ihrer Antwort an den Engel im Augenblick der Verkündigung ausspricht: «Siehe, ich bin die Magd des Herrn.»
Die beiden Worte: «Ja, ich komme ... Siehe ich bin die Magd» klingen weiter. Sie müssen auch Ausdruck unserer Gesinnung sein, wenn wir kommunizieren. Dies ist eine echt priesterliche Haltung, sie entspricht der Sendung des Priesters in der Kirche; sie gehört zum «Imitamini - ahmt nach» und sichert uns den Empfang reicher Gnade bei unsern Kommunionen.
Außer diesen beiden Hindernissen, die sich der Wirkung des Sakramentes entgegenstellen, kennt der Priester, der sich voll Eifer der Seelsorge widmet, sicher noch ein anderes: die Schwierigkeit, vor oder nach der Kommunion einsame Zwiesprache mit dem Herrn zu halten. Er möchte beten, aber er wird jeden Augenblick gestört und belästigt.
Da hilft nur eines: er muss sich bemühen, den Mangel an Sammlung durch ganz reine Absicht wettzumachen, indem er sich sagt: «Ich diene Christus in seinen Gliedern; all mein Wirken gilt ihnen; ich übe mein Amt aus Liebe zu ihm.»
Die beste unmittelbare Vorbereitung auf die Kommunion ist die mit lebendigem Glauben dargebrachte Messe.
Ist die Danksagung gleich nach dem heiligen Opfer nicht möglich, kann man sie später durch irgendein Gebet oder durch eine Besuchung des Allerheiligsten nachholen. Die Wichtigkeit einer andächtigen und ehrfurchtsvollen Danksagung darf nicht unterschätzt werden. Aber es braucht auch niemand den Mut zu verlieren, wenn er trotz guten Willens durch dringende Erfordernisse seines Amtes daran gehindert wird; die hervorragendste «dispositio unionis - Vorbereitung der Einheit» ist die Ganzhingabe seiner selbst.
Die Gewohnheit, sich im Laufe des Tages der kostbaren Gabe zu erinnern, die man am Morgen in der Kommunion empfing, und sich auf die des nächsten Tages einzustellen, ist ebenfalls eine ausgezeichnete Übung, die uns reicheren Gewinn aus dem Empfang des Sakramentes sichert.
Jeden Morgen begegnen wir am Altar einem unendlich liebenswerten Freund, Jesus, unserm Gott. Suchen wir ihn demütig zu lieben, uns ihm vorbehaltlos hinzugeben für die Gegenwart mit ihren Wechselfällen, wie für die geheimnisvolle Zukunft. Und wenn wir wünschen, zu diesem Leben voller Vereinigung mit ihm zu gelangen, dann stützen wir uns auf nichts als auf seine Verdienste und seine Gnade. «Lieben wir Gott mit der Liebe, die er selbst uns eingibt», sagt der hl. Augustinus (Sermo 34. P. L. 38, Sp. 210).
Eine Seele, die in dieser Gesinnung lebt, wird stets inneren Gewinn von ihren Messopfern und Kommunionen haben.
XIV: DAS STUNDENGEBET
(Siehe in «Christus, das Leben der Seele» das Kapitel «Vox Sponsae», und in «Christus, das Ideal des Mönches», die beiden Kapitel «Das Opus Dei, Gotteslob und Mittel der Gottvereinigung»)
Wir hören nicht auf, Priester zu sein, wenn wir den Altar verlassen. Nach der Heiligen Messe haben wir Gott noch eine andere priesterliche Huldigung darzubringen: wir sollen ihn durch das Breviergebet verherrlichen.
War nicht das ganze Leben Jesu eine priesterliche Huldigung? Von seinem Eintritt in die Welt an steht das menschgewordene Wort als Priester vor dem Vater und während seines ganzen Erdenlebens brachte Jesus ihm ständig Anbetung und Lobpreis dar.
Denken wir an dieses immerwährende priesterliche Gebet des Erlösers, bevor wir die Horen beten und wenn wir beteuern, wir wollten diese Verpflichtung erfüllen «in Vereinigung mit der Gesinnung, die ihn selbst bei seinem Gotteslob auf Erden beseelte».
So kann der Priester durch das tägliche Breviergebet Christus nachahmen in seinem Blick auf den Vater und sein vollkommenes Gebet. Auf diese Weise erweist er dem Herrn die Verherrlichung, die ihm gebührt.
Von der Subdiakonatsweihe an ist das Leben des Dieners Christi ganz dem göttlichen Dienste geweiht. Deshalb begnügt sich die Kirche nicht damit, ihm zu empfehlen, ein Mann des Gebetes zu sein, sondern sie schreibt ihm sogar die Art seiner Gebete vor. Beim gewöhnlichen Gläubigen ist außer dem Dienen bei der Heiligen Messe und dem Empfang der Sakramente alles der privaten Frömmigkeit überlassen; doch das Bitten und der Lobpreis des Priesters sind so wichtig, dass die Kirche genaue Weisungen dafür gibt.
Und sie macht dieses Gebet zu einer strengen Pflicht.
Warum diese Strenge?
Zunächst, weil die Horen ein Ausdruck der Gottesverehrung und der Liebe sind, zu dem die Kirche selbst sich verpflichtet fühlt und den sie Gott durch seine Diener darbringen will. Ferner, weil der Priester, der nicht in moralische Mittelmäßigkeit versinken und im Eifer erlahmen will, zu dem wirksamen Mittel des stets erneuten Gebetes Zuflucht nehmen muss.
Manche klagen zuweilen, dass ihnen das Brevier «nichts gebe» und dass es keine Stütze und keinen Trost für sie bedeute, sondern eine schwere Belastung. - Es ist nicht zu leugnen, dass das tägliche Brevierbeten Mühe bereitet. Doch zweifeln wir nicht daran: wenn wir uns in die großen Glaubenswahrheiten vertiefen, an die es uns erinnert, werden wir erfahren, wie sehr unser priesterliches Leben durch das würdige Rezitieren des Breviers ins Übernatürliche erhoben werden kann.
1. Die Erhabenheit des Breviergebetes
Es ist nicht leicht, sich eine richtige Vorstellung von der Erhabenheit des offiziellen Gebetes der Kirche zu machen.
In der Dreifaltigkeit erweist Gott sich selbst eine Verherrlichung, die seiner würdig ist, einen vollkommenen Lobpreis. Das wissen wir durch die Offenbarung; der Logos, die zweite göttliche Person, ist die «Herrlichkeit des Vaters», «er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens» (Hebr 1,3). Im Schoße des Vaters ist er durch sich selbst das erhabene ewige Loblied: «Und das WORT war bei Gott» (Joh 1, 1); er ist in hervorragendster Weise der ewige Hymnus der Verherrlichung im «Schoß des Vaters». Wir können uns keine richtige Vorstellung machen von dem Lobpreis, den der Sohn dem Vater erweist, da das subsistierende Wort seine ganze Vollkommenheit ausdrückt.
Überdies hat das WORT zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist alles erschaffen: «Alles ist durch ihn geschaffen.» Diese Schöpfung hatte der Vater in seiner Weisheit ersonnen; im Verbum hatte sie schon Leben und sie war auf die Verherrlichung des Vaters ausgerichtet: «Was geworden ist. In ihm war das Leben.»
Bei der Menschwerdung hat der Sohn nicht aufgehört, das lebendige WORT, das Loblied zu sein, das er schon zuvor war; doch durch die menschliche Natur, von der seine göttliche Person Besitz ergriff, lobte er den Vater auf eine neue Weise. Von da an gab es auf Erden einen menschlichen Lobpreis, der dem menschgewordenen Verbum eigen war.
Wir unterscheiden also in Christus einen göttlichen Lobpreis, der unsere Fähigkeiten übersteigt und den wir bewundern, und einen menschlichen Lobpreis. Als Mensch lobte und liebte Jesus seinen Vater in der Freude seiner Teilnahme an der ewigen Sohnschaft. Seine Seele betrachtete im Verbum das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit.
Die ganze geschaffene Natur wurde in ihm erhoben und befähigt, den Vater auf eine neue Weise zu preisen. Jesus war sozusagen der Mund der ganzen Schöpfung. Es blieb dies stets der Lobpreis eines Gottes, doch er wurde in menschlicher Sprache dargebracht, in einer Form, die unserer Natur entspricht, vielgestaltig in seinem Ausdruck.
Betrachten wir oft das Beten Jesu in seinem Erdenleben. «Er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott» (Lk 6, 12).
Und wenn Jesus mit der jüdischen Gemeinde in der Synagoge sang oder im Tempel betete - das tat er ohne Zweifel von seinem zwölften Lebensjahr an -, dann stieg sein Gebet zu Gott empor «wie Weihrauch, mit lieblichem Wohlgeruch». Er kannte die Psalmen. Die religiöse Gesinnung, die durch diese Gesänge eingeflößt wird, gewann in ihm höchste Lebendigkeit: «Ihr Werke des Herrn, lobet den Herrn!» «Jahwe, höchster Herr, wie wunderbar ist doch dein Name auf der weiten Erde!» (Ps 8, 2).
Die Gottesverehrung durch das Gebet ist eine Pflicht der Gerechtigkeit; Jesus hat sie vollkommen erfüllt. Er ehrte seinen Vater durch Anbetung, Liebe, Lobpreis, Danksagung, Bitten. Und die Verbindung seiner Menschheit mit dem Göttlichen Wort verlieh diesen Akten unendliche Vollkommenheit und unendlichen Wert.
Bevor Christus in den Himmel auffuhr, machte er die Kirche, seine Braut, zur Erbin der ganzen Fülle seiner Verdienste, seiner Gnaden, seiner Lehre, und verlieh ihr die Macht, auf Erden das Werk der Verherrlichung des dreifaltigen Gottes, das er begonnen hatte, fortzusetzen.
Und die Kirche stützt sich auf ihren Bräutigam, «auf ihren Geliebten gestützt» (Hld 8, 5), damit ihr Gebet bis zum Thron Gottes gelange. Diesen Lobpreis macht Jesus in der Herrlichkeit zu dem seinen: «Durch ihn wollen wir Gott beständig ein Lobopfer darbringen: das Bekenntnis seines Namens als Frucht der Lippen» (Hebr 13, 15). Am Kreuz hat er sich aus Liebe zu seiner Kirche ganz hingegeben und bleibt für immer innig mit ihr vereint. Die Lobgesänge der Glieder werden eins mit denen ihres Hauptes. Deshalb kann der hl. Augustinus die überraschenden Worte sprechen: «Sie sind zwei in einem Fleisch; warum sollten sie also nicht zwei in einer Stimme sein? … Die Kirche betet in Christus und Christus betet in der Kirche; der Leib ist eins mit dem Haupt und das Haupt ist eins mit dem Leib» (Enarrat, super psalmos, II, 4. P. L. 36, Sp. 232).
Ein Vergleich lässt dieses Geheimnis besser verstehen. Die Sühne, die Jesus für die Sünden der Welt geleistet hat, war überreich. Das lehrt die Kirche. Dennoch wollte Gott, dass der Mystische Leib einen Teil der Leiden trüge. Der Apostel versichert: «Ich erfülle am eigenen Fleisch, was am Leidensmaß Christi noch abzutragen ist», «Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt» (Kol 1, 24). Was für die Sühneleistung gilt, das gilt auch für die Pflicht, Gott anzubeten, ihn zu loben und ihm zu danken. Wir sollen den Lobpreis, den Christus dem Vater erweist, fortsetzen und ergänzen.
Die Kirche regelt dieses Gebet; sie hat ihm eine Sprache und Formen verliehen, die der menschlichen Natur angemessen sind. Welches auch immer der Ausdruck sei, dessen die Liturgie sich bedient, sie setzt stets den Lobpreis des Erlösers fort; sie vereint sich mit dem Lobgesang des menschgewordenen Wortes, und durch ihn erhebt sich ihr Gebet aus der Wüste dieses Lebens bis zum Thron des Vaters.
Das «sacrificium laudis - Opfer des Lobes» im eigentlichen Sinn des Wortes ist die Messe; doch während des Tages wird diese Verherrlichung Gottes durch das Stundengebet fortgesetzt, dessen Horen gleichsam einen Strahlenkranz um das heilige Opfer bilden.
Unsere priesterliche Sendung besteht in dem Auftrag, diese hohen Funktionen zu vollziehen. Bei der Weihe wird dem Subdiakon bezw. dem Priester das Vorrecht verliehen, «zu Gott im Namen aller zu sprechen» (Hl. Bernardin von Siena, Opera omnia, Venetiis, apud Juntas, 1591, I, Sermo XX, S. 132). Er betet für die Sünder, doch auch für die Seelen, die Christus in Liebe verbunden sind. Wenn er das Offizium rezitiert, handelt er wie ein Gesandter, ein bevollmächtigter Vermittler, denn er lobt und bittet im Namen der Kirche für alle.
Dieses offizielle Gebet wird immer angenommen. «Lass mich sehen, deine Stimme hören» (Hld 2, 14). Der Priester hat jederzeit freien Zugang zu Gott. Selbst wenn sein persönlicher Seelenzustand nicht mit seiner Mission in Einklang steht, ersetzt die Sendung der Kirche vollkommen alle seine Mängel. Deshalb sagt der Missionar in der Einsamkeit des Urwaldes nicht: «Orem», sondern «Oremus - Lasset uns beten». Auch sein Gebet steigt im Namen der gesamten Christenheit zu Gott empor.
Das priesterliche Amt des Lobpreises und der Fürbitte ist für das Heil der Welt überaus wirksam. «Das Abendgebet steige zu Dir empor, o Herr, und Dein Erbarmen komme hernieder auf uns.» (Versikel nach den Psalmen, Monastisches Brevier vom Samstag, ad Vesperas). Der Herr könnte die Seelen sicher ohne uns heiligen, doch in seiner Güte wollte er sich unserer Mitwirkung bedienen. Das Offizium ist in der göttlichen Ordnung von großer Bedeutung. Gewiss, das Rezitieren des Breviers ist ein reiner Akt des Glaubens; wir sehen nicht den Erfolg unserer Bemühungen, nicht die Wirkung unseres Betens ; doch Gott kennt sie und wägt das Verdienst.
So kann man die Hochschätzung der Kirche für das Offizium verstehen, das der hl. Benedikt so schön «Opus Dei - Werk Gottes» nennt und von dem der hl. Alphons sagt, «hundert private Gebete haben nicht den Wert eines einzigen, das man im Offizium verrichtet» (CEuvres complètes, XI, p. 209. Traduction Dujardin, Tournai, Casterman, 1882). Es ist eine herrliche Aufgabe, die uns da übertragen wurde. Was erwartet Gott von seinen Priestern? Ohne Zweifel, dass sie sich hochherzig für das Heil der Seelen verbrauchen; doch diese Hingabe ihrer selbst muss befruchtet werden durch das Breviergebet. Davon müssen wir überzeugt sein.
2. Die Vorbereitung
Das Brevier ist das offizielle Gebet der Kirche; daher sein ursprünglicher Wert.
Doch dieses Gebet kann nur zum Himmel aufsteigen, wenn es von unsern Lippen, aus unsern Herzen klingt. So hat also auch die persönliche Frömmigkeit des Priesters wirkliche Bedeutung bei dem Rezitieren der Horen, wenn sie auch einer anderen Ordnung angehört. Der Glaube des Priesters, seine Liebe zu Christus, seine Absicht, Gott zu preisen, bewirken, dass er durch das Offizium geheiligt wird, Verdienste erwirbt und dass seine Fürbitte bei Gott größere Wirksamkeit erlangt.
Bevor wir das Brevier beten, sollen wir uns darauf vorbereiten. Das erste und wichtigste bei dieser Vorbereitung ist, dass wir uns einen Augenblick sammeln. Diesen Punkt kann man gar nicht genug betonen.
Bedenken wir: Ohne die Gnade sind wir unfähig, gut zu beten: «Ohne mich könnt ihr nichts tun» (Joh 15, 5). Das «O Gott komm mir zu Hilfe» zu Beginn jeder Hore erinnert uns immer wieder an diese Wahrheit.
Doch häufig ist es so: Eben war man noch mit zerstreuenden und aufreibenden Arbeiten beschäftigt, dann nimmt man eilig das Brevier und beginnt es zu beten, ohne sich zu sammeln, ohne Gott um Gnade zu bitten. Gewiss, man erfüllt damit die Pflicht, die das kanonische Recht auferlegt, aber das Gebet wird wenig Frucht bringen.
Jeder Priester, der das Brevier schon seit vielen Jahren betet, weiß aus Erfahrung, dass man sich die Mühe nehmen muss, sich geziemend darauf vorzubereiten, sonst betet man zerstreut. Die Heilige Schrift selbst mahnt uns: «Bevor du betest, bereite dein Herz, und gleiche nicht dem Menschen, der Gott versucht» (Sir 18,23). Was heißt «Gott versuchen?» Ein Werk unternehmen, ohne alles zu tun, was von uns abhängt, um es gut zu vollbringen. Wenn wir Gott im Namen der Kirche loben wollen, ohne uns zu sammeln und ohne seinen Beistand zu erbitten, so ist das eine Dreistigkeit. Der hl. Augustinus sagt: «Meine Lippen könnten Dich nicht loben, Herr, wenn Deine Barmherzigkeit mir nicht zuvorgekommen wäre. Mit Deiner eigenen Gabe lobe ich Dich» (Ennarat. super psalmos, 62, 12. P. L. 37, Sp. 750).
Und wo finden wir den Glauben, die Ehrfurcht, die Liebe, deren wir bedürfen, um diese Aufgabe zu erfüllen? Sicherlich nicht in uns. Wir müssen sie von Gott erbitten. Ohne Vorbereitung wird das Brevier notwendigerweise nachlässig und mechanisch gebetet werden.
Wenn man das Offizium zerstreut beginnt, wird man es oft ebenso beenden. Dann besteht Gefahr, dass uns die Horen zu einer Last werden statt zu einer Freude, zu einem Sonnenstrahl für unser inneres Leben.
Was soll man in diesem Augenblick der Sammlung tun? Verbannen wir zunächst durch einen Willensakt alle ablenkenden Gedanken. Sprechen wir zum Herrn: «Ich will an nichts anderes denken als an Dich und an die heilige Kirche. Ich bin schwach, mein Geist schweift oft ab, doch ich wünsche aufmerksam zu bleiben, ich will es, will mit den Engeln und Heiligen zusammen mich anbetend vor Dir niederwerfen.» Diese Absicht gilt vor Gott für das ganze Offizium, trotz der Zerstreuungen, die eintreten können; denn diese haben wir von vornherein missbilligt.
Denken wir an Gott, an unsere Sendung, Gott durch Jesus Christus zu huldigen. Auf Patmos lüftete sich vor den Blicken des hl. Johannes sozusagen der Schleier, der die jenseitige Welt verhüllt. Er sah Millionen von Engeln den Thron Gottes umgeben, die das ewige «Sanctus - Heilig» sangen. Und die vierundzwanzig Ältesten legten ihre Kronen vor dem Herrn nieder, bekennend, er sei würdig, «Preis, Ehre und Macht zu empfangen» (Offb 4, 11). Das ist die Grundhaltung, die jedem ziemt, der Gott verherrlichen will: Ehrfurcht.
Andere vereinigen sich lieber mit der streitenden Kirche; sie denken der zahllosen Priester und Ordensleute, die dem Herrn allüberall den gleichen Lobpreis darbringen.
Es ist sehr empfehlenswert, eine besondere Intention für die Rezitierung des Breviers festzusetzen. Das macht es leichter, den Geist aufmerksam zu erhalten, denn dann stehen uns die Gründe, die uns zum Gebet drängen, lebendig vor Augen. Bevor wir beginnen, denken wir an die Leiden und die Gefahren so vieler Seelen: an die Menge der Sünder, an die riesige Schar derer, die unter dem Einfluss des Teufels oder ihrer Laster stehen. Vergisst man so sich selbst, dann spürt man, dass man zum «Mund der ganzen Kirche» wird; dann ist man zur Andacht gestimmt.
Ein ausgezeichnetes Mittel, sich zu sammeln, ist dies, jedes Wort des Vorbereitungsgebetes zu erwägen: «öffne meine Lippen, Herr, damit ich Deinen Namen preise; reinige mein Herz von allen nichtigen, bösen oder ablenkenden Gedanken; erleuchte meinen Verstand; gib mir Liebe.»
Seien wir überzeugt, die Zeit, die wir der Vorbereitung widmen, ist nie verloren; im Gegenteil, es sind kostbare Augenblicke. Selbst wenn diese Übung der Sammlung durch lange Gewohnheit erleichtert wird - es ist gut, das im voraus zu wissen -, erfordert sie jedes Mal Anstrengung; doch Gott sieht unsere Bemühungen und wird sie reichlich lohnen. Es kann vorkommen, dass man infolge von Müdigkeit oder quälenden Sorgen trotz allen guten Willens unruhig oder zerstreut ist; davor ist auch der Heilige nicht gefeit. Doch auch in diesem Fall wird Gott, der die Vorbereitung des Herzens kennt, unsere Huldigung gnädig annehmen, trotz aller Schwächen, die ihr anhaften.
3. Das Beten des Breviers
Überlegen wir nun, in welcher Weise und in welcher Gesinnung das Brevier gebetet werden soll.
Im «Öffne» erbitten wir die Fähigkeit, das Offizium «würdig, aufmerksam und andächtig» zu beten.
Diese drei Seelenhaltungen sind notwendig, wenn wir unsere Aufgabe gut erfüllen wollen.
Was besagt «würdig»? Es heißt, das Offizium mit der Ehrfurcht beten, die wir der göttlichen Majestät schulden. Wir sind Mittler, Botschafter; der Botschafter ist verpflichtet, die Formen einzuhalten, die am Hofe des Königs gebräuchlich sind. Eine Vernachlässigung wäre nicht nur ein Mangel an Feingefühl, sondern ein Fehler. Nun, die von der Kirche vorgeschriebenen Rubriken sind nichts als die Etikette oder die äußere Haltung, die bei der Ausübung der heiligen Funktionen gefordert wird.
Schlagen wir das Alte Testament auf; die Übertragung der Bundeslade und die ganze Gottesverehrung war mit vielen Zeremonien umgeben. Diese waren jedoch nur «Bilder». Wir aber besitzen die Wirklichkeit, die diesen Symbolen und Riten entspricht.
Erweisen wir Gott gern diese äußere Ehrfurcht. Die Vorschriften scheinen manchem vielleicht recht kleinlich, aber die Treue in ihrer Beobachtung ist stets ein Tugendakt, und das aus drei Gründen. Erstens gehorcht man dadurch den Vorschriften, die die Kirche selbst zum allgemeinen Wohl erlassen hat; zweitens vollzieht man einen äußern Akt der Gottesverehrung, durch den man Gott mit Leib und Seele dient; und drittens ist diese Unterwerfung der Ausdruck unserer inneren Frömmigkeitshaltung gegenüber dem König der Könige.
Könnten wir Gott im Glanz seiner Majestät schauen, müssten wir sterben; selbst wenn er uns nur gestattete, ein paar Strahlen der unsichtbaren Welt wahrzunehmen, würden wir uns auf die Knie niederwerfen. Von den drei Jüngern auf Tabor wird berichtet: «Sie fielen auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr» (Mt 17,6). Woher kam diese Furcht, die sie niederwarf? Sie war die unmittelbare Wirkung der klaren Erkenntnis von Gottes Gegenwart; da ihnen eine Ahnung vom göttlichen Licht aufging, waren ihre Seelen in Anbetung versenkt.
Wir, die wir aus dem Glauben leben, sollen mit Gott stets in tiefer Ehrfurcht sprechen. Das wird uns helfen, beim Beten des Breviers eine würdige Haltung zu bewahren. Nichts ist der Frömmigkeit so förderlich und macht so tiefen Eindruck auf die Gläubigen wie die Ehrfurcht des Priesters beim Gebet.
Wenn das Wort «würdig» zu einem Großteil unsere äußere Haltung betrifft, so bezieht sich die Bezeichnung «aufmerksam» ausschließlich auf den Geist. Warum sollen wir das Offizium «mit Aufmerksamkeit» beten? Weil alle Inbrunst und alles Verdienst beim Lobpreis ihren Ursprung vor allem in der Liebe haben, und Liebe setzt Erkenntnis voraus.
Der hl. Thomas unterscheidet drei Arten von Aufmerksamkeit: «Ad verba, ad sensum, ad Deum - auf die Worte, auf den Sinn der Worte - auf Gott.» (S. th. II-lI, q. 83, a. 13. ). Die Aufmerksamkeit auf die Worte allein kann genügen, um die kirchenrechtliche Verpflichtung zu erfüllen; doch sie ist unvollkommen. Erst die Aufmerksamkeit auf den Sinn der Worte und vor allem die Aufmerksamkeit auf Gott macht das Gebet vollkommen.
Das letztere ist das wichtigste. Eine Ordensfrau, die kein Latein versteht, kann während des Rezitierens ihre Aufmerksamkeit auf die Geheimnisse richten, die gefeiert werden, auf Gott, auf die Personen der heiligsten Dreifaltigkeit, auf die göttlichen Vollkommenheiten. Wenn sie das lebhafte Verlangen hat, dem Herrn eine Huldigung darzubringen, verherrlicht sie ihn und gelangt durch die Liturgie zur echten Beschauung.
Für uns Priester wird dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes normalerweise durch das Verständnis des heiligen Textes wachgehalten werden. Wenn der Priester seine Aufmerksamkeit auf den Sinn der ausgesprochenen Worte richtet, wird seine Seele reiche Anregung von der Liturgie empfangen. Seine religiöse Überzeugung wird durch seine Teilnahme an dem offiziellen Gebet der Kirche an Tiefe gewinnen; dasselbe gilt für sein Vertrauen auf die göttliche Güte, für seine Dankbarkeit, seine Demut und seine Liebe. Wenn er auf die Glaubenswahrheiten, die durch die Texte seines Breviers in Erinnerung gebracht werden, aus ganzem Herzen antwortet: «Amen», d. h.: «Ja, Herr, ich glaube alle diese Worte, ich mache sie zu den meinen», dann wird ihm dieses Gebet jeden Tag Erbauung bringen.
Die Bemühung um Aufmerksamkeit wird erleichtert, wenn wir die Psalmen hochschätzen. In den Zeitaltern lebendigen Glaubens benützten die Christen viel mehr den «Psalter»; dieser war das «Gebetbuch» im eigentlichen Sinn des Wortes. Er war das Lieblingsbuch vieler Heiliger. «Mein Psalmenbuch ist meine Freude», schrieb der hl. Augustinus (Ennarat. super psalmos, 137. P. L. 37, Sp.1775).
Gewiss, es gibt sakrale Texte, deren Gegenstand uns fremd anmutet; doch es genügt sicher, wenn wir während des Betens - ohne anzustreben, die Anregungen aus jedem Psalmvers aufzunehmen -, manchen von ihnen ausdrücklich zustimmen. Der hl. Bernhard sagt: «Die Speise wird im Mund schmackhaft, der Psalm im Herzen» (In Canticum, VII, 5. P. L. 183, Sp. 809).
Der Psalter ist gleichsam eine göttliche Harfe, die uns die Kirche gibt, um das Lob dessen zu singen, den wir lieben. Wir finden darin den vollendetsten Ausdruck der Gesinnung des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, die uns unserm himmlischen Vater gegenüber beseelen soll.
Gott allein kennt sich selbst vollkommen, Gott allein weiß, welcher Lobpreis ihm gebührt. In den Psalmen, die vom Heiligen Geist eingegeben sind, legt er uns selbst die Worte in den Mund, durch die er von uns verherrlicht sein will. Die Psalmen lehren uns, die göttliche Majestät zu preisen, ihre unendlichen Vollkommenheiten zu verkünden, alle ihre Wohltaten und Erbarmungen anzuerkennen, dem Herrn von unsern Kämpfen zu erzählen, von unserer Sehnsucht nach Verzeihung, von unsern Freuden.
Wie heilsam ist es doch für uns, innerlich, die Seelenhaltung zu bejahen, zu der die Psalmen uns einladen. Diese Gesinnung ist echt, menschlich, unendlich wohltuend. Denken wir z. B. an den Ausdruck der Liebe, der Bereitschaft, die der Psalm 110 enthält: «So spricht der Herr zu meinem Herrn.»
Wir hören, wie der Vater «seinen Sohn verherrlicht in seinem ewigen Ausgang vom Vater und in seinem ewigen Priesterturn», «Ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern … er hat geschworen .. Du bist Priester auf ewig» (Ps 110, 3+4). Wir können Jesus Christus keinen erhabeneren und wohlgefälligeren Lobpreis darbringen als den, uns diesem Zeugnis des Vaters anzuschließen. Welche Offenbarung der Güte Gottes liegt doch im Psalm 90 ! «In Ewigkeit werde ich die Erbarmungen Gottes besingen.» Wir sehen da die Entfaltung des göttlichen Erlösungsplanes. Gott erwählte sich einen David aus unserm Geschlecht, er machte ihn zu seinem eigenen Sohn, und dieser Sohn betrachtet seinen Vater und spricht: «Vater, mein bist du.»
Im Psalm 104 überschauen wir zuerst alle Wunder der Schöpfung; dann wenden wir uns an den Herrn und sprechen in Bewunderung: «Wie herrlich sind doch Deine Werke, Herr; alles hast Du mit Weisheit gemacht.»
Wir wollen nicht noch mehr Beispiele anführen; doch wir möchten betonen, dass es nützlich ist, von Zeit zu Zeit einen Psalm oder einen andern Teil des Offiziums zum Gegenstand der Betrachtung oder des Studiums zu wählen. Wenn man das nie tut, läuft man Gefahr, diese herrlichen Gebete automatisch herzusagen wie ein Grammophon. Befolgen wir lieber den Rat des hl. Hieronymus, der uns ermahnt, die Psalmen zu beten «im Licht der Heiligen Schrift», «in der Kenntnis der Schriften» (Comment. ad Ephes. Irr, 5. P. L. 26, Sp. 562).
Wie weit entfernt von dieser Auffassung war doch ein Priester, den ich in meiner Jugend kannte: wenn er das Brevier beendet hatte, sagte er mit einem Seufzer der Erleichterung: «So, jetzt kann ich beten.» Ich glaube, man findet überall Beispiele von einer solch verkehrten Frömmigkeit.
Die Aufmerksamkeit auf Gott muss immer der Grundakkord bleiben, der die Vielfalt der inneren Regungen bestimmt. So verwirklicht sich an uns das Psalmwort : «Lobsingt Gott in Weisheit» (Ps 47, 8). Je gesammelter die Seele ist, desto mehr wird sie Erleuchtung für das Verständnis der Texte empfangen: «Du bist furchtbar und herrlich, mehr als die ewigen Berge» (Ps 76, 5).
Die Aufmerksamkeit auf Gott wird uns wesentlich leichter sein, wenn wir uns sorgfältig auf das Psalmengebet vorbereitet haben.
Andächtig: Was ist Andacht? Man versteht darunter oft fühlbare Tröstungen im Gebet. Das ist die allgemeine Ansicht, aber es ist ein Irrtum. Man kann in der größten geistlichen Trockenheit sein und dennoch in tiefer Andacht beten. Die hl. Johanna von Chantal erzählt vom hl. Franz von Sales: «Er sagte mir einmal, er achte nicht im geringsten darauf, ob er sich im Zustand des Trostes oder der Verlassenheit befinde; wenn der Herr ihm gute Regungen eingebe, nehme er sie in aller Einfachheit an; wenn er ihm keine gebe, denke er nicht daran.» (Lettres de sainte Chantal, n° 121, dans CEuvres complètes de saint François de Sales. Lyon, Périsse, 1851, S. 118). Die echte Andacht besteht also nicht in fühlbarer Innigkeit. Als Christus zu seinem Vater sprach: «Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?» (Mt 27, 46), betete er zweifellos in vollkommener Weise, und doch empfand er keinerlei Trost, im Gegenteil.
Wahre Andacht ist selbstlos, sie übergibt die Seele mit all ihrer Liebeskraft Gott. Der Sinn des Wortes «devovere» weist darauf hin; es besagt «sich hingeben, sich aufopfern».
Wir kennen das Wort Christi: «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele» (Mt 22, 37). Er sagt nicht: von Herzen und mit der Seele, sondern: von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, «ex toto corde» ... Die Wiederholung des Wortes «totus» weist darauf hin, welche Bedeutung der devotio, der Hingabe, zukommt; sie besagt Höchstmaß der Liebe.
Wenn wir das Brevier beten, sollen wir nicht nur mit dem Verstand ganz dem Gotteslob hingegeben sein, sondern mit allen Kräften unseres Herzens, vor allem durch die Liebe. Richten wir alle Fähigkeiten unserer Seele auf Gott. Diese innere Hinwendung bildet die Grundlage jeden guten Gebetes, und sie ist durchaus mit geistlicher Trockenheit vereinbar. Sie ist dem Herrn sehr wohlgefällig. Da Gott die Liebe ist, freut er sich über unsere Bemühungen.
Im Himmel werden wir verstehen, wie sehr die wahre Andacht, mit der wir dem Gotteslob oblagen, den Seelen und der Kirche genützt hat. Die Horen sind «Opus Dei - Werk Gottes». Sie gut zu beten, ist ein Werk, das reiche Frucht für viele bringt. Wenn wir uns dieser Aufgabe aus ganzem Herzen widmen, wird unsere Seele von jener heiligen Inbrunst erfüllt sein, die uns befähigt, in inneren Frieden Göttliches zu verkosten. «Man findet Honig im Wachs und Salbung in der Heiligen Schrift», «Mel in cera, devotio in littera».
Offnen wir unsere Seelen dem Wirken des Heiligen Geistes. Bei einer Symphonie achtet jeder Künstler darauf, mit vollendeter Fügsamkeit der Leitung des Dirigenten zu folgen, mag er das Tempo beschleunigen oder mäßigen. Wenn der Geist Gottes in uns eine solche Unterwerfung findet, wird er die feinsten Empfindungen unseres Herzens in Schwingung versetzen und aus ihnen einen Lobpreis hervorgehen lassen, wie Gott ihn von uns erwartet. Es ist ein wahres Wort des hl. Johannes Chrysostomus : «Jedes Mal, wenn das christliche Volk sich dem Psalmengebet widmet, wird es gleichsam zur Zither, auf der der Heilige Geist spielt» (De Lazaro. P. G. 48, Sp. 963). Um wie viel mehr müssen wir Priester beim Stundengebet den Eingebungen Gottes lauschen!
4. Geistliche Früchte des Breviergebetes: Verähnlichung mit Christus
Hauptzweck des Breviergebetes ist es, Gott zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen.
Doch der Herr in seiner Güte wendet der Seele, die diese Aufgabe mit Glauben und Liebe vollbringt, reiche Früchte zu, die ihrer Heiligung dienen. Wie die Erfahrung lehrt, ist das andächtige Rezitieren des Breviers ohne Zweifel sehr förderlich für das Innenleben des Priesters.
Eine seiner Wirkungen, und zwar die wichtigste, ist diese: wir gewöhnen uns daran, mit Christus in seinem ewigen priesterlichen Lobpreis verbunden zu sein.
Alle Verherrlichung, die Gott auf Erden und im Himmel erwiesen wird, steigt nur durch Jesus Christus zu ihm empor. Diese große Wahrheit sprechen wir jeden Morgen am Schluss des Messkanons aus: «Per ipsum, et cum ipso, et in ipso - Durch Ihn und mit Ihm und in Ihm.»
Wenn wir das Stundengebet in Vereinigung mit der ganzen Kirche beten, dann nimmt Christus als Haupt des mystischen Leibes und als Mittelpunkt der Gemeinschaft der Heiligen all unsern Lobpreis auf und fasst ihn in sich zu einer Einheit zusammen. Auch das himmlische «Sanctus - Heilig» der seligen Geister wird Gott durch seine priesterliche Vermittlung angenehm: «Per quem maiestatem tuam laudant angeli - Durch ihn loben die Engel Deine Majestät.» Wie unvollkommen und mangelhaft ist doch unsere Verherrlichung! Christus aber ersetzt, was uns fehlt. «Wenn wir unsere armseligen Bemühungen auf ihn richten», sagt Ludwig Blosius, «wird euer Blei in das kostbarste Gold verwandelt und euer Wasser in feinsten Wein.» (Miroir de l'âme, traduction des Bénedictins. Collection Pax, II. Bd., S. 44).
Denken wir auch daran, dass niemand die Erhabenheit der Psalmen so tief erfasst hat wie Jesus. Wenn er sie betete, wusste er, dass viele von ihnen sich auf ihn bezogen, auf seine Sendung, seine Herrlichkeit. Hat er nicht selbst bestätigt, dass in diesen Gesängen von ihm die Rede ist? (Lk 24, 44). Er ist unser Vorbild. Bitten wir Christus, er möge uns nahe sein; erheben wir uns zur Höhe seiner Gottesverehrung, machen wir uns seine Absicht, den Namen des Vaters zu preisen, und den Wunsch, dass sein Reich komme, zu eigen.
Glauben wir fest daran: Gott hat der heiligen Menschheit Jesu die Macht verliehen, uns bis zu ihm zu erheben: «Vater, ich will, dass sie, die Du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin» (Joh 17,24). Auf seine Verdienste gestützt, dürfen wir bis zum Thron Gottes vordringen, wo wir bei seiner Barmherzigkeit Gehör finden: «in sanctuarium exauditionis». Dort sind wir sicher, dass der Vater uns sieht, uns hört, uns liebt in seinem Sohn und dass wir als Glieder des Sohnes an seinem Lobpreis teilnehmen können.
Wenn wir uns bei der Vorbereitung ausdrücklich vorgenommen haben, mit Jesus vereint zu bleiben, dann ist es uns leichter, beim Stundengebet nicht zu vergessen, wie sehr unser Gebet gestützt und ergänzt wird durch die mächtige Mittlerschaft unseres Hohenpriesters.
Bei der Erfüllung dieser Aufgabe suche der Priester sich dem Kirchenjahr anzuschließen; auch da begegnet er Christus.
Die Ereignisse im Erdenleben Jesu sind nicht nur heilig in sich selbst, sondern sie haben auch heiligende Kraft. Den Seelen, die sie betrachten und mitleben wollen, bringen sie Gnaden, durch die ihre Verbindung mit dem Leben des Erlösers vertieft wird. Aus welchem Grund?
Alles, was Christus auf Erden getan hat, tat er sicher zur Verherrlichung des Vaters, doch auch «für die Menschen und um ihres Heiles willen». Deshalb ist jede seiner Handlungen, jedes seiner Worte, jede Phase seines Lebens eine Quelle der Gnade für uns. Bethlehem, Nazareth, Golgotha, Auferstehung, Himmelfahrt, Sendung des Heiligen Geistes sind die wichtigsten Etappen im Werk unserer Erlösung und unserer Annahme an Kindes Statt. Wenn die Kirche im Lauf des liturgischen Jahres die einzelnen Geheimnisse aufs neue in Erinnerung ruft, üben sie ihre heiligende Wirkung auf unsere Seelen aus. Für alle, vornehmlich aber für uns Priester, sollen diese Feiern nicht nur Gegenstand der Bewunderung sein; sie sind auch im weiteren Sinn des Wortes «Sakramente», oder besser «Sakramentalien», die in den Seelen ein Wachstum der Liebe und der Freude bewirken, wenn sie in der richtigen Verfassung sind.
Manche beachten bei den Festen der Kirche nur den Gesang, die Schönheit des Schmuckes, den Glanz der Lichter. Das sind Äußerlichkeiten; das ist die Franse am Gewand Christi. Suchen wir dabei vor allem eine innige Vereinigung mit dem göttlichen Meister. Er will, dass wir als seine Glieder im Glauben die großen Geheimnisse der Erlösung erleben, die er für uns durchlebte, und dass wir uns innerlich der Gesinnung seines heiligsten Herzens anschließen. So wird durch seine Gnade immer mehr unsere Lebensverbindung mit ihm bewirkt. Und ist nicht eben das unsere Bestimmung? (Diesen Gedanken hat Dom Marmion ausführlich in dem Werk «Christus in seinen Geheimnissen» behandelt; siehe die Kapitel: «Die Geheimnisse Christi sind unsere Geheimnisse»; «Wie können wir ihrer Wirkung teilhaft werden ?»).
Durch das liturgische Jahr zeigt sich uns der Herr in immer neuem Licht; er enthüllt sich unserm Herzen immer mehr, er belebt unsern Glauben, unsere Hoffnung, unsere Liebe. So öffnet sich die Seele von Jahr zu Jahr mehr dem Strom des übernatürlichen Lebens, der aus der ununterbrochenen Aufeinanderfolge der liturgischen Feste hervorgeht. Ihre Vielfalt verhindert, dass sie uns alltäglich werden und jedes Rezitieren des Offiziums will ein «Cantate Domino canticum novum - Singt dem Herrn ein neues Lied» sein.
5. Andere geistliche Früchte des Breviergebetes
Unserer Sorge sind Seelen anvertraut. Der Priester, der das Brevier mit Treue und Andacht betet, wird bei der Arbeit, die er zur Ehre Gottes leistet, oft überraschende Hilfe vom Herrn empfangen. Es liegt uns gänzlich fern, das Verdienstliche äußerer Werke auch nur im mindesten gering zu schätzen; sie sind notwendig, von der Kirche gutgeheißen, bewundernswert. Dennoch darf die Wichtigkeit, die wir ihnen zuerkennen, nicht zum Nachteil des großen und wesentlichen priesterlichen Aktes gereichen: Gott durch das Offizium zu loben und so alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Heilige Messe steht natürlich unvergleichlich höher; aber seien wir überzeugt, dass wir durch die Erfüllung unserer Verpflichtung zum Gotteslob die Seelen retten und alle Bemühungen bei der Predigt und in den übrigen Obliegenheiten unseres Amtes befruchten. Durch die Art, in der die Kirche uns zum Breviergebet verpflichtet, zeigt sie uns, welchen Wert sie ihm beimisst : sie macht es uns zu einer schweren Gewissenspflicht, es täglich zu verrichten; abgesehen von bestimmten Fällen sind wir nicht frei, uns davon zu dispensieren. Wir sind verpflichtet, die notwendige Zeit dafür aufzuwenden. Und diese Zeit ist sicher nicht verloren. Unser Brevier ist das wirksamste Gebet für das Heil und die Heiligung der Seelen.
Ahmen wir den hl. Franz von Sales nach. Wenn er das Offizium betete, vergaß er auf die Verwaltung der Diözese und dachte an nichts als an das Gotteslob. Und der Herr segnete seinen Gebetseifer. «Wenn ich aus dem Chor kam», so schreibt er, «geschah es oft, dass große Angelegenheiten, die mir viel Mühe gemacht hatten, in einem Augenblick erledigt waren» (Hamon, Vie, H, S. 411).
Eine andere Frucht des andächtigen Rezitierens unseres Stundengebetes ist eine tieferlebte Kenntnis der Heiligen Schrift. Man kann die Bibel vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gut kennen, kann über die verschiedenen Lesarten, über die Geschichte des Textes, über die verschiedenen Interpretationen unterrichtet sein. Doch den tiefen Sinn der heiligen Worte zu erfassen, ihn für das eigene Innenleben und für die Predigt fruchtbar zu machen, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Die Heilige Schrift birgt unermessliche Schätze der Herrlichkeit und der Liebe. Viele Priester ahnen das gar nicht; es ist ihnen nicht bewusst, wie viel Licht die inspirierten Texte enthalten, Licht, das es ihnen selbst ermöglichen würde, ihr Leben aus den übernatürlichen Wahrheiten zu gestalten und die Seelen zu beeinflussen. Den Bibelworten wohnt eine sakramentale Wirksamkeit inne; sie geben unsern Worten Kraft und Weihe, wenn es gilt, Leidende zu ermutigen oder Irrende zur Besinnung zu rufen.
Wenn der Priester das Brevier ohne Hast betet, werden ihm die Schriftstellen allmählich voll und ganz zum geistigen Besitz. Er wird die Erfahrung machen, dass die Texte des Alten und Neuen Testamentes, die in das «Proprium de Tempore - Eigentümlichkeit der Zeit» und das «Proprium Sanctorum - Eigentümlichkeit der Heiligen» eingeschaltet sind, ein «Promptuarium» bilden, eine Schatzkammer, die mit Licht und Gnaden angefüllt ist. Diese Erleuchtungen geben dem Glauben an die Geheimnisse Christi, der Kirche und sogar die der heiligsten Dreifaltigkeit immer größere Klarheit.
Schließlich ist das andächtig rezitierte Offizium für den Priester eine Quelle der Freude, denn das Breviergebet bewirkt, dass er jeden Tag aus der Hoffnung und dem Besitz der übernatürlichen Güter lebt, die Gott seiner Kirche gegeben hat. Die Liturgie ist erfüllt von der unerschöpflichen Freude, die der Braut Christi aus der Überfülle der göttlichen Gaben erwächst. Der Priester, der diese Aufgabe würdig erfüllt, nimmt teil an dem «Strom der Freude, der die Gottesstadt erquickt» (Ps 46, 5).
Gott ist die unendliche Freude, der nichts mangelt. Wenn wir auf menschliche Weise von ihm reden, sind wir geneigt, zu unterscheiden zwischen dem, was er ist, und dem, was er besitzt. Tatsächlich aber ist Gott seine eigene Freude.
Was ist Freude? Die Empfindung, die durch die Hoffnung auf ein Gut und vor allem durch den Besitz eines Gutes in uns geweckt wird. Gott ist das unendliche Gut; er kennt sich selbst, er besitzt sich und freut sich in vollkommener Weise seiner selbst. Seine Seligkeit ist keiner Steigerung fähig. Er hätte uns sicher nicht gebraucht, aber in seiner Güte wollte er sich mit einer wunderbaren Schöpfung umgeben, die aus einer ganzen Hierarchie der vielfältigsten und verschiedensten Wesen besteht. Diese Schöpfung lobt in ihrer Gesamtheit Gott und ist ein Widerschein seiner Freude. Deshalb fordert uns der Psalmist so oft auf, Gott in Freude zu dienen: «Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde! Dient dem Herrn mit Freude!» (Ps 99, 1+2). Wo Gott ist, erstrahlt seine Herrlichkeit und herrscht seine Freude.
Wenn wir unsere Blicke zum himmlischen Jerusalem erheben, dann sehen wir Millionen von Engeln, die das Lamm umgeben. Sie «verherrlichen Gott in gemeinsamer Freude». Sie leben in einem solchen Entzücken, dass sie gleichsam entrückt sind. Mehr noch als sie preist Maria den Herrn und dankt ihm; und ihr Glück ist grenzenlos: «Gaudens gaudebo in Domino - Voll des Frohlockens bin ich dem Herrn» (Introitus der Messe am Fest der Unbefleckten Empfängnis). Alle Seligen nehmen an diesem Lobpreis und diesem Entzücken teil, jeder nach dem Grad seiner Glorie. «Die Söhne Sions jubeln ob ihres Königs» (Ps 149, 2).
Kraft der Gemeinschaft der Heiligen sind wir nun nicht mehr «Fremdlinge und Beisaßen», sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes» (Eph 2, 19). Täglich beten wir bei der Heiligen Messe im feierlichsten Augenblick: «Communicantes - In heiliger Gemeischaft» - und durch dieses einfache Wort treten wir in Gemeinschaft mit der allerseligsten Jungfrau, den Aposteln und allen Auserwählten; wir nehmen teil an ihrem Lobgesang und ihrem Jubel; ihre Freude aber hat ihren Ursprung in der Seligkeit Gottes selbst.
Jedem der Geheimnisse Christi, jeder Feier zu Ehren der Muttergottes oder irgendeines andern Himmelsbewohners wohnt eine besondere Freude inne. Wenn wir im Gebet diese Freude in unser Herz aufnehmen, strahlt sie auf unser ganzes Leben aus; unsere Predigt, unsere Seelsorge und unsere Tätigkeit in den verschiedenen Vereinigungen wird viel dadurch gewinnen.
Bevor wir dieses Thema abschließen, wollen wir noch ein Wort über die Zerstreuungen sagen.
Priester, die darüber klagen, erhalten oft die Antwort: «Unter Zerstreuungen leiden alle.» Doch überlegen wir: wenn wir uns nicht auf das Gebet vorbereiten, sind wir für gewöhnlich selbst schuld an den Abschweifungen unseres Geistes; wir werden das ganze Offizium so beten, wie wir es begannen. Durch den Fehler, den wir am Anfang begingen, sind wir gewisser Weise verantwortlich für die Unvollkommenheit des Ganzen.
Vergessen wir nicht: Das Wesentlichste beim Brevierbeten ist die Absicht, vereint mit Christus Gott zu huldigen. Selbst wenn aus Gründen, die nicht von unserm Willen abhängen, unser Gebet wenig aufmerksam wäre, hätten wir unsere Pflicht erfüllt, weil wir uns darum bemühten. Bossuet gibt in einem seiner Briefe folgende Richtlinien: «Wenn Zerstreuungen kommen, müssen wir ohne Anstrengung, ganz sanft die Absicht erneuern, Gott zu loben ... Wir dürfen niemals etwas übereilt beginnen, aber wir müssen auch Skrupeln ausschlagen; verrichten wir das Brevier gleichmäßig, gut und einfach wie ein anderes Gebet» (Correspondance, Bd. X, S. 22. Ed. Les grands écrivains de la France, Paris, Hachette, 1916).
Beginnen wir das Breviergebet mit voller innerer Wachheit. Das wird uns von vielen Zerstreuungen befreien, die durch Nachlässigkeit verstärkt würden. Und durch dieses tägliche Bemühen, den Namen Gottes zu heiligen, bereiten wir uns auf den ewigen Lobpreis vor. Tertullian sprach diesen ermutigenden Gedanken aus, als er über das Vaterunser schrieb: «Wir stehen in der Lehrzeit für das Amt, das wir im Licht des Jenseits ausüben werden» (De Oratione, III. P. L. 1, Sp. 1259).
Mit zunehmendem Alter erwirbt man größere Erfahrung im Breviergebet, und dann entdeckt man erst seine Unergründlichkeit. Es ist gleichsam eine kurze Zusammenfassung, eine Synthese der ganzen Bibel wie auch des Lebens der Kirche und der christlichen Heiligkeit.
Bevor wir unser Stundengebet beginnen, sprechen wir: «O Gott, ich glaube, dass ich durch dieses Gebet, zu dem mein Amt mich verpflichtet, in Vereinigung mit Deinem Sohn Jesus Christus viel für die Anliegen der Kirche zu tun vermag: den Leidenden, den Sterbenden, die bald vor Dir erscheinen werden, helfen; an der Bekehrung der Sünder, der Gleichgültigen mitwirken; mich mit allen heiligen Seelen auf Erden und im Himmel vereinigen. Alles in mir möge Dich preisen und anbeten, Herr.» «Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen!» (Ps 103, 1).
XV. DER PRIESTER, EIN MANN DES GEBETES
Die moderne Welt glaubt Gott entbehren zu können; das ist ihr großes Übel. In Wirklichkeit brauchen wir Gott unbedingt. Unsere Natur ist so beschaffen, dass wir ohne ihn nicht sein, nicht bestehen können.
Im Bereich des Übernatürlichen ist unsere Abhängigkeit von ihm nicht weniger unbedingt. «Ohne mich könnt ihr nichts tun» (Joh 15, 5). Und der hl. Augustinus weist darauf hin (In Joan. 81, 3. P. L. 35, Sp. 1841), dass der Herr nicht sagt: «Ohne meine Hilfe könnt ihr nichts Großes vollbringen», sondern er beteuert: «Ihr könnt gar nichts tun». Der Kirchenlehrer, der uns so Wesentliches über die Gnade sagt, fügt hinzu: «Wie die Seele das Prinzip deines körperlichen Lebens ist, so ist Gott das Prinzip deines Seelenlebens» (In Joan. 47, 8. P. L. 35, Sp. 1737).
Wir machen täglich die Erfahrung, dass unsere Natur aus eigener Kraft, ohne die Hilfe Gottes nicht zu voller geistiger Harmonie gelangen kann.
Nun erkennen wir aber gerade durch das Gebet die völlige Unterordnung an, in der sich unser Leben vor Gott abspielt: «Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir» (Apg 17, 28).
Es ist eine allgemeine Norm, dass Gott seine Gnaden für gewöhnlich nur auf das Gebet hin gewährt. Und da wir jede Stunde etwas brauchen, müssen wir unsern Geist ohne Unterlass zu ihm erheben. «Man muss allzeit beten und nicht nachlassen» (vgl. Lk 18, 1). Bei andern Heilmitteln, wie z. B. den Sakramenten, betont das Evangelium, dass sie für eine gewisse Zeit notwendig oder nützlich seien; nur vom Beten sagt es: «allzeit». Und wir wissen, dass jedes Wort Christi seinen Wert und seine Berechtigung hat.
Die Liturgie bekennt in ihren Orationen demütig, dass sie all ihre Hoffnung auf Gott allein setzt: «Möge all unser Beten und Handeln stets von Dir begonnen, und wie begonnen, so auch durch Dich vollendet werden» (Oration der Allerheiligenlitanei). «Ohne Dich können wir Dir nicht gefallen» (18. Sonntag nach Pfingsten). Und ferner: «Ohne Dich bricht die menschliche Schwachheit zusammen» (14. Sonntag nach Pfingsten).
Mehr noch als alle andern muss der Priester, wenn er in der Wahrheit leben will, ein Mann des Gebetes sein. Jeder Schlag seines Herzens sollte ein Akt der Liebe sein; eine Antwort auf die Liebe des Herrn zu ihm.
1. Das Wesen des Gebetes
Beten, sich an Gott als Vater wenden, ob im mündlichen oder im inneren und schweigenden Gebet, ist das Vorrecht derer, die der Herr an Kindes Statt angenommen hat. Durch sein Erbarmen sind die «unergründlichen Reichtümer Christi» (Eph 3, 8), von denen der hl. Paulus so oft spricht, Besitz aller Getauften geworden. Wenn also der Christ betet, steht er nicht einfachhin als Geschöpf vor Gott, sondern als angenommenes Kind oder als Glied Christi. Der Herr bleibt sein Schöpfer, sein Meister, und wird für ihn doch «der Vater der Erbarmungen» (2 Kor 1, 3). Deshalb soll der Christ im Gebet immer sprechen, wie Jesus es ihn gelehrt hat: «Vater unser, der Du bist im Himmel.»
Die Verbindung zwischen ihm und dem himmlischen Vater muss sich auf den Glauben stützen. Weder die Erfahrung noch das Herz vermag Gott wirklich zu finden. Kunst und Dichtung können der Seele ebenso wenig Gott geben wie philosophische Gedankengänge. Alle diese Mittel können dem Gottsucher eine Hilfe sein, doch nur der Glaube öffnet ihm den Zugang zum Bereich des Übernatürlichen. Da wir als Adoptivkinder die Bestimmung haben, Gott einst im Himmel zu schauen, so wenden wir uns hienieden im Gebet direkt an ihn, wenngleich im Dunkel des Glaubens; wir breiten unser Elend vor seiner unendlichen Güte aus.
Das wahre Wesen des christlichen Gebetes ist daher in folgender Definition ausgesprochen: Das Gebet ist eine Zwiesprache des Gotteskindes mit dem himmlischen Vater.
Der hl. Johannes Damascenus und der hl. Thomas geben eine andere Definition, die betont, welche Erhebung der Seele das Gebet seinem Wesen nach in sich schließt: «Ascensus mentis in Deum.» (S. th. III, q. 21, a. 1 u. 2). Das Gebet ist «die Erhebung des Geistes und des Herzens zu Gott», um ihm zu huldigen und alles von ihm zu erbitten, dessen wir bedürfen.
Diese Definition ist richtig, aber wir müssen darunter eine übernatürliche Erhebung der Seele verstehen.
Wir wissen mit Bestimmtheit, dass seit unserer Taufe zwei Leben in uns sind: das eine empfingen wir von unsern Eltern, und es machte uns zu Kindern Adams; das andere, übernatürliche, ist eine Gabe des Himmels, eine Gnade, die uns Christus, dem eingeborenen Sohn Gottes, ähnlich machen will.
Wie das natürliche Leben die Geburt voraussetzt, der Nahrung und des Atmens bedarf, so ist es auch im übernatürlichen Leben. Die Taufe ist die Wiedergeburt der Seele; die Eucharistie ist die Nahrung des neuen Lebens; und dem unablässig wiederkehrenden Bedürfnis, den Hauch des Lebens einzuatmen, entspricht der Christ durch eine heilige Handlung: das Gebet.
Wenn die Seele betet, geht sie über die Welt der materiellen und vergänglichen Dinge hinaus und dringt in eine höhere Region ein, in die der unsichtbaren Wirklichkeiten, wo Gott wohnt. Unser Erdenleben ist gleichsam vom Übernatürlichen umgeben. Durch das Gebet erhebt sich der Mensch in dieses Reich, das von den Sinnen nicht wahrgenommen wird. Der Glaube ermöglicht es ihm, in unmittelbare Verbindung mit der Majestät des Vaters zu treten, mit Christus, der Muttergottes, den Engeln und Heiligen. Er kommt Gott ganz nahe, und mögen diese Augenblicke der Erhebung zum Herrn noch so kurz sein, sie geben dem Geist neues Leben und bringen ihn in Berührung mit der Ewigkeit. Wenn die Gnade ein göttlicher Hauch ist, der durch die Seele zieht, so atmet das Gebet ihn ein und öffnet die geheimsten Tiefen des Wesens seinem wohltuenden Einfluss.
Das Gebet ist daher auf allen Stufen, auch wenn es nur das einfache Rezitieren des Vaterunsers ist, für die Kinder Gottes eine innere Erhebung, eine Verbindung mit der übernatürlichen Welt im Glauben, ein Eingehen in das Reich des Vaters.
2. Einige Richtlinien für das Gebet
Drei wichtige Richtlinien können die Erhebung unserer Seele zu Gott erleichtern; sie stützen sich auf Definitionen, lassen uns aber besser als diese erkennen, welche Haltung wir uns beim Gebet zu eigen machen sollen.
Da das Gebet ein Gespräch übernatürlicher Art ist, müssen wir uns um die feste Überzeugung bemühen, dass Jesus uns in die Gegenwart seines Vaters zu versetzen vermag. Diese Überzeugung bewirkt, dass die Heiligen in der inneren Sammlung stets dem Herrn nahe sind.
Wenn man Gott betrachtet, der so groß und so heilig ist, könnte man Furcht haben, sich in seine Arme zu schmiegen. Deshalb müssen wir uns auf Christus stützen. - Man wird sagen: Ich bin so armselig! Doch fragen wir uns: Hat uns der Herr nicht Barmherzigkeit erwiesen? Hat er uns nicht mit seinen Verdiensten beschenkt? - Ich bin so unrein! Ja, doch das Blut Christi hat dich von deinen Sünden gereinigt. - Ich bin so fern von Gott! Nein, dank der Gnade gibt es keine Entfernung; wenn wir mit Jesus vereint sind, sind wir ihm ganz nahe. Hat Christus nicht gesagt: «Vater, ... ich will, dass meine Jünger dort sind, wo ich bin» (Joh 17, 24). Und wo ist Jesus? Der hl. Johannes verkündet es uns: «Der eingeborene Sohn ... ist im Schoße des Vaters» (Joh 1, 18). Wenden wir uns zu Beginn des Gebetes immer Christus zu; da wir an seiner Sohnschaft, an seinen Verdiensten teilhaben, dürfen wir immer überzeugt sein, dass wir durch ihn Zutritt zur Gottheit erlangen.
Was erwarten wir bei einer Unterredung vor allem von unserm Gesprächspartner? Dass er die Wahrheit sagt und zwar in einer Form, die sowohl unserer als auch seiner Stellung entspricht. Wenn wir beten, verlangt der Herr von uns die gleiche loyale Haltung. Beten wir ihn an, danken wir ihm, versichern wir ihn unseres Vertrauens, erinnern wir ihn an unsere Hilfsbedürftigkeit; doch selbst bei unseren unausgesprochenen Gedanken dürfen wir seine Allmacht und unsere Stellung nie vergessen. Dadurch wird unser Gebet «wahr». Manche haben lange Gebete verrichtet und merken dann, dass sie kein einziges Wort aus tiefstem Herzen an Gott gerichtet haben. So fern kann unser Geist von den Worten sein, die unsere Lippen sprechen.
Wenn der Herr sich uns mitteilen will, dann fordert er das Bemühen, uns in seiner Gegenwart zu halten, ganz bereit zu sein. Das sagt auch der Psalmist: «Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe, allen, die zu ihm aufrichtig rufen» (Ps 145, 18). Dieses ehrliche Suchen ist demütig. Gott verlangt es gebieterisch: «Die wahren Anbeter beten den Vater an im Geist und in der Wahrheit» (Joh 4,23).
Übergeben wir im Gebet dem Herrn vorbehaltlos unser Herz und unsern Geist. Die Heilige Schrift erinnert uns mit einem Wort, das die Liturgie oft verwendet, an das Ideal vollkommenen Betens, bei dem die Seele ganz aufmerksam, ganz Gott hingegeben ist : «Iustus cor suum tradidit ad vigilandum diluculo ad Dominum qui fecit illum» (Sir 39, 6).
Wie sich das Öl im Ewigen Licht auf unsern Altären restlos verzehrt, so soll unsere Seele in ihrer Zwiesprache mit Gott dem Allerhöchsten ganz hingegeben sein.
Seien wir überzeugt, es ist das Herz, das betet: «Mein Herz ruft zu Dir» (Ps 27, 8), sagt der Psalmist. Und der hl. Augustinus fügt hinzu: «Dein Verlangen schon ist dein Gebet» (Enarr. super Psalmos 37, 14. P. L. 35, Sp. 404).
Doch nur wenn wir innerlich frei sind, können wir uns zu Gott erheben. Machen wir uns darum los von Sorgen, von eitlen Gedanken, vor allem aber von der Begierlichkeit, die die Seele an die Erde ketten und sie hindern, sich ganz dem Herrn zu schenken.
Beten kostet immer eine gewisse Anstrengung, auch für jene, die Freude daran haben, denn die Aufmerksamkeit im Gespräch mit Gott ist ihrer Natur nach mühevoll; es ist immer mehr oder weniger ermüdend, die Seele in einer höheren Sphäre als der ihr vertrauten zu erhalten. Deshalb kann das Gebet stets als sakramentale Buße dienen. Seien wir nicht erstaunt, dass das Gebet uns Schwierigkeiten macht; sich Gott nähern, wenn auch nur ein wenig, heißt immer, über sich selbst hinausgehen.
3. Wichtigkeit des Gebetsgeistes für den Priester
Für den Priester kann es nicht genügen, wenn sich sein Gebet auf einzelne, vorübergehende Akte beschränkt. Nein, der Diener Christi muss notwendigerweise den Geist des Gebetes pflegen.
Was versteht man darunter?
Eine habituelle Geneigtheit der Seele, sich in Mühen und Mutlosigkeit, bei Freuden und Erfolgen Christus oder dem himmlischen Vater zuzuwenden als ihrem besten Freund, ihrem intimsten Vertrauten, der Stütze ihrer Schwachheit. Und nicht nur am Morgen und am Abend soll sie sich zu Gott erheben, sondern «immer»: «Meine Augen schauen stets auf den Herrn» (Ps 25,15).
Unsere Annahme an Kindes Statt erlegt uns die Pflicht auf, vor Gott einfach «wie die Kinder» zu werden: «Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen.» (Mt 18,3). Der Sohn spricht ehrfurchtsvoll mit dem Vater; doch diese Haltung hindert ihn nicht, auf seine Güte zu vertrauen und ihm sein Herz auszuschütten. Das gilt auch für den Priester; Gott kann für ihn nicht ein unzugänglicher Herr sein, dem man jeden Tag ein paar in Eile verrichtete Gebete schuldet. Nein, er ist ihm Vater, Ratgeber, Stütze. Selbst wenn man das Unglück gehabt hat, ihm zu missfallen, darf das Vertrauen auf seine Güte nicht erschüttert werden. Vor jeder wichtigen Handlung soll unser Herz ihm sagen, dass wir wünschen, sie für ihn zu tun.
So wird es uns allmählich eine liebe Gewohnheit, unsern Geist zu erheben, und wir werden oft in Verbindung mit der Welt des Unsichtbaren treten: Messe, Offizium, Betrachtung sind dann nicht mehr einzelne Handlungen, die mit unserm übrigen Leben nichts zu tun haben, sondern der innige, immer wiederholte Ausdruck unserer Freundschaft mit Gott. Die Gnade der Gotteskindschaft wird so zum Mittelpunkt unseres ganzen Lebens.
Vor allem zwei Gründe sind es, die vom Priester die Pflege des Gebetsgeistes fordern: einerseits die Sorge um seine eigene Beharrlichkeit, seine Treue in der Liebe zu Christus; anderseits die Notwendigkeit, seinem Wirken den Segen Gottes zu sichern.
Können wir Priester, wenn wir in der Seelsorge stehen, mitten in der Welt leben, ohne durch ihre Lockungen gefährdet zu werden? Trotz der Erhabenheit unserer Berufung bleiben wir schwach, unvollkommen, zuweilen starken Versuchungen ausgesetzt. Das Gebet ist für alle unerlässlich, die im Guten verharren wollen; für viele aber ist das fast ununterbrochene Gebet eine gebieterische Forderung.
Treue bis zum letzten Atemzug ist «ein vollkommenes Geschenk vom Vater des Lichtes» (Jak 1, 17). Durch gute Werke können wir es nicht eigentlich «de condigno» (vollkommen) verdienen.
Doch wenn sich zu unserm Bemühen, Gott die Treue zu halten, demütiges und inständiges Gebet gesellt, dann können wir voll Zuversicht hoffen, diese kostbare Gabe von Gottes Güte zu erlangen: «jene große Gabe der Beharrlichkeit bis zum Ende» (DH 1566), wie das Konzil von Trient sie bezeichnet. Sie macht es uns jedoch nicht unmöglich, zu sündigen; sie bewahrt uns nicht vor jeder Versuchung, doch sie schließt eine providentielle Hilfe in sich und eine Kette von Gnaden, die den Willen geneigt macht, bis zum Tode das Gute zu wählen. So ist der ganze Lebensgang des Christen bis zur letzten Vollendung von der Barmherzigkeit Gottes behütet (Vgl. S. th. I-II, q. 114, a. 9).
Wie Bettler stehen wir am Himmelstor und zeigen dem Vater unsere Gebrechen, ohne jemals das Vertrauen zu verlieren. So machten es die Heiligen. Wie immer ihr Leben verlief, eines war ihnen allen gemeinsam: die Beharrlichkeit, Gott zu suchen, sein Reich, sein Wohlgefallen. Sie alle harrten in der einmal vollzogenen Hingabe an Gott bis zum Tod treu aus. Ihr Wille war in Gott verankert, sagt die Kirche in der Bekennermesse: «Deren Wille verblieb am Tag und in der Nacht.»
Wo liegt das Geheimnis dieser Festigkeit in der Gottverbundenheit? Es ist für alle verständlich: sie nahmen unaufhörlich ihre Zuflucht zum Gebet.
Wir können niemals die Ausrede bringen, unsere Leidenschaften seien zu heftig, unsere Versuchungen zu groß. «Virtus in infirmitate perficitur- Die Kraft erweist sich in der Schwachheit» (2 Kor 12, 9). Der hl. Paulus war bis in den dritten Himmel erhoben worden und weiß doch um sein Elend; wie sehr leidet er darunter! Doch er lässt sich darob nicht entmutigen, sondern ruft voll Vertrauen: «Gern will ich mich meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi in mir wohne» (2 Kor 12, 9). Auch für uns haben Versuchungen und zuweilen sogar unsere Fehltritte eine providentielle Bedeutung; sie sollen uns nicht niederdrücken, sondern in der Überzeugung bestärken, dass wir trotz aller Gnadenfülle «zerbrechliche Gefäße» (2 Kor 4, 7) bleiben.
Unsere Schwachheit wird uns lehren, demütig und vertrauensvoll zu beten; sie wird uns vor Hochmut und Dünkel bewahren. Gott lässt diese Schwachheiten zu, damit «niemand sich vor Gott rühmen könne» (1 Kor 1,29).
Priester, die sich Studien nicht direkt religiösen Charakters zu widmen haben, wie auch solche, die mit Verwaltungsarbeiten überlastet sind, sollen sich noch mehr als andere um den Geist des Gebetes bemühen. Eine häufige Erhebung des Herzens durch Stoßgebete wird ihnen viel helfen. Sie mögen dazu solche wählen, die am besten ihren Bedürfnissen entsprechen, oder auch einen Text aus dem Brevier oder aus der Heiligen Schrift, für den ihnen die Gnade Gottes tieferes Verständnis gegeben hat.
Wie glücklich ist doch der Priester, der treu den Gebetsgeist pflegt und jede Handlung aus Liebe zu Gott und seiner Kirche vollbringt !
Das Gebet ist nicht nur von ausschlaggebender Bedeutung für die persönliche Heiligung des Priesters, sondern es ist auch unerlässlich, um den Segen Gottes auf seine Arbeiten herabzuziehen.
Seien wir überzeugt: wir können den Seelen nicht wirklich nützen, wenn unser Bemühen nicht von Gott gesegnet ist: «Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen» (1 Kor 3, 6). Gewiss, die Gnade setzt die Natur voraus, und wir können beim Wirken für das Gottesreich nicht die Bedeutung der menschlichen Intelligenz und der menschlichen Bemühungen übersehen: «Wir pflanzen, wir begießen»; das ist unsere Aufgabe, von der wir nicht dispensiert werden können. Doch vergessen wir nicht, dass unsere Arbeit fruchtlos ist, wenn nicht Gott das Gedeihen gibt.
Die Heiligen, die aus Liebe Großes vollbrachten, setzten alle ihre Kräfte für ihr Werk ein, aber sie waren auch Männer des Gebetes. Denken wir an Benediktus, [[Franz Xaver] (Spanischer Jesuit)|Franz Xaver]], Karl Borromäus, Franz von Sales, Alphons von Liguori, den Pfarrer von Ars; sie alle verbrachten ganze Stunden in Zwiesprache mit Gott.
Seien wir sicher: mag ein Priester noch so viele Talente und Kenntnisse haben, mag seine Begeisterung zu Beginn seines Wirkens noch so groß sein, wenn er nicht ein Mann des Gebetes ist, wird er nichts ausrichten, was dauernden Wert hat.
Wie der hl. Augustinus lehrt, übersteigt alles Wachstum im Gnadenleben die Kraft der Menschen und der Engel, und ist ausschließlich dem befruchtenden Wirken der Dreifaltigkeit zuzuschreiben: «Excedit hoc humanam humilitatem, exceclit angelicam sublimitatem, nec omnino pertinet nisi ad agricolam Trinitatem.» (In Joan. 80, 2. P. L. 35, Sp. 1840).
Seien wir darum «Mittler», die es mit ihrer Mission ernst nehmen, Männer des Gebetes, die dank ihrer ständigen Verbindung mit dem Herrn die Seelen heiligen, die ihnen anvertraut sind, und zugleich sich selber heiligen.
Wir Priester können uns nicht allein retten. Es ist unsere höchste Aufgabe, die Seelen in den Himmel mitzunehmen. Danken wir Gott und seien wir treu, damit unser Mangel an Eifer nie Ursache zum Erschlaffen oder gar zum Verderben einer Seele werde.
4. Die Quellen des Gebetes
A. Die Natur
Jesus sagte vom Himmel: «In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen» (Joh 14, 2). Das gleiche gilt vom Gebetsleben; es sind da zahlreiche Stufen zu unterscheiden. Die hl. Theresia nennt in ihrem berühmten Buch «Die Seelenburg» sieben «Wohnungen». Die innerste Wohnung erreicht man nicht mit einem Mal.
Bei diesem «ascensus in Deum» können uns Beispiele helfen, die drei verschiedene Ausgangspunkte oder drei verschiedene Hilfsmittel für den Aufstieg zeigen. Alle drei führen zum Haus des Vaters.
Man kann sich zu Gott erheben durch den Anblick der geschaffenen Dinge - oder durch Betrachtung der Wahrheiten, die uns durch die Heilige Schrift, besonders das Leben Jesu mit seinen Geheimnissen, geoffenbart werden -, oder dadurch, dass wir uns an Christus anschließen in dem lebendigen Glauben an seine Macht, uns in den Schoß des Vaters zu führen.
Je nach der persönlichen Neigung und den Umständen ist es uns möglich, einen dieser drei Wege zu Gott einzuschlagen. Wir verstehen den Vergleich besser, wenn wir an die drei Vorhöfe des Tempels von Jerusalem denken. Es nehme niemand Anstoß daran: es ist nur ein Mittel, um den Gedanken darzulegen.
Was sehen wir im Tempel zu Jerusalem? Dem Allerheiligsten waren Vorhöfe vorgelagert. Die Bedeutung jedes dieser Höfe war umso größer, je näher er dem Allerheiligsten lag.
Der «Vorhof der Heiden» war ein sehr großer Raum unter freiem Himmel; dort hatte jedermann Zutritt.
Durch Tore, die die Unbeschnittenen nicht durchschreiten durften, gelangte man in den Vorhof der Juden. Dort wohnte das Auserwählte Volk den Opferfeiern bei, hörte die Vorlesung aus dem Gesetz an, sang die Psalmen und konnte hinter dem Brandopferaltar jenen Teil des Heiligtums sehen, der den Priestern vorbehalten war.
Im Hintergrund des sogenannten Heiligtums, hinter dem heiligen Vorhang des Tempels, öffnete sich das geheimnisvolle Allerheiligste. Dort befand sich nach dem Hebräerbrief (9, 3-4) neben dem Rauchopferaltar die Bundeslade, die ringsum mit Gold überzogen war, und die Gesetzestafeln, ein Gefäß mit Manna und den Stab des Aaron enthielt (Die Bundeslade und andere Heiligtümer gingen bei der Zerstörung des Salomonischen Tempels und während der Babylonischen Gefangenschaft verloren, etwa um das Jahr 598 v. Chr.). Einmal im Jahr durfte der Hohepriester nach vielfältigen Reinigungszeremonien allein dieses Heiligtum betreten.
Doch zurück zu den Stufen des Gebetes.
Der erste Vorhof, jener der Heiden, versinnbildet das Gebet, bei dem die Seele sich ohne Hilfe der Offenbarung zu Gott erhebt, durch den Anblick der Ordnung und der Schönheit der Natur. - Auch St. Paulus fordert uns zur Bewunderung der geschaffenen Dinge auf, wenn er schreibt: «Das unsichtbare Wesen Gottes lässt sich seit Erschaffung der Welt durch seine Werke wahrnehmen» (vgl. Röm 1,20).
Man wird einwenden: Kann man beten, indem man die Schönheit der Natur betrachtet? Warum nicht? Gott ist der große Künstler. Alles, was er geschaffen hat, war schon vorher im WORT ersonnen. Die Schöpfung trägt die Spuren des Schöpfers. Viele finden ihre Freude in der Betrachtung der Werke Gottes; die Unermesslichkeit des Meeres, die Gipfel der Berge, die Schönheit einer Landschaft drängen sie zum Gebet, weil sie hinter dem Schleier der Natur die verborgene Gegenwart Gottes ahnen. Das ganze Universum ruft ihnen zu: «Ipse fecit nos et non ipsi nos» (Ps 99, 2). Der Prophet Baruch schreibt: «Froh leuchten die Sterne auf ihren Warten. Er ruft sie - sie sagen: Hier sind wir! Sie leuchten mit Freuden vor dem, der sie schuf» (3,34-35). - Betrachten auch wir den Sternenhimmel und lassen wir uns von diesem Anblick zur Liebe dessen erheben, der den Weltenraum schuf.
B. Das Evangelium
Im Vorhof der Juden gehört alles der Offenbarungsordnung und somit der übernatürlichen Ordnung an. Die Form des mosaischen Kultes mit seinen vielfältigen Riten und Opfern war dem Moses von Gott selbst vorgeschrieben worden. «Sieh zu, dass du die Ausführung genau nach dem Abbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist» (Ex 25, 40).
Denken wir gern daran, mit welcher Bewunderung und Liebe Maria vom Vorhof der Frauen aus den Zeremonien folgte. Und Jesus betrat den Tempel als das Haus seines Vaters. Er wusste, dass der Tempel ihn selbst versinnbildete. «Reißt diesen Tempel nieder, und ich will ihn in drei Tagen wieder aufbauen» (Joh 2, 19).
Im Vorhof war er Zeuge der Schlachtopfer des jüdischen Kultes; er, das wahre Lamm Gottes, wusste, dass dies alles Symbole und Vorbilder seiner Mission waren. Wenn der Hohepriester das Volk mit dem Blut der Opfertiere besprengte und dann allein das Allerheiligste betrat, dachte Jesus an die Rettung der Welt durch sein Blut, und seine Seele erhob sich zu den erhabenen Wirklichkeiten, von denen die jüdischen Riten nur Schatten waren, «Schatten der künftigen Güter» (Hebr 10, 1).
Was stellt der zweite Vorhof im Gebetsleben dar? Es handelt sich hier nicht mehr um eine Erhebung der Seele, die von den Wundern der Natur hervorgerufen wird, sondern um ein Gebet, das seinen Ausgangspunkt in der Offenbarung hat. Unser Gott hat sich gewürdigt, zu uns zu sprechen; und sein Wort ist in den inspirierten Büchern enthalten. So schöpft das Gebet seine Nahrung vor allem aus Schrifttexten. Der hl. Paulus schreibt: «Das Wort Christi wohne in reicher Fülle unter euch. Belehrt und ermuntert einander in aller Weisheit. Dankbaren Herzens singt Gott Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder» (Kol 3, 16).
Man kann die Heilige Schrift lesen, ohne etwas darin zu entdecken, das zum Gebet anregt; doch man kann sie auch demütig lesen, als Gotteskind, und dann wird die Seele, erleuchtet durch das Wort Gottes, inbrünstig beten.
Bemühen wir uns, in diesem Vorhof vor allem Jesus Christus und die Geheimnisse seines Lebens zu betrachten. Dabei wird uns die Liturgie eine wertvolle Hilfe sein (Siehe oben [S. 305-306], was über das Offizium gesagt wurde. Diese Art des Gebetes wird sehr erleichtert durch die Sammlung «ParoIes de vie en marge du missel», die ausschließlich aus Werken von Dom Marmion zusammengestellt wurde. Diese Auszüge wurden gewählt in Übereinstimmung mit den Festgeheimnissen oder der Eigenart der Heiligen, die die Kirche Tag für Tag feiert. Das Evangelium der Messe und die Lesung aus dem Brevier, von Dom Marmion erläutert, geben Stoff für das Gebet. Dadurch wird eine große Einheitlichkeit im geistlichen Leben des Priesters bewirkt).
In der Tat, wenn wir uns Mühe geben, über die Worte und Handlungen Jesu nachzudenken, tun wir das unsere, damit Gott sich uns mitteilen kann. Der bloße Gedanke an Jesus heiligt die Seele.
Wir können die Szenen des Evangeliums betrachten, als ob wir an der Seite des Erlösers wären und seine Worte mit eigenen Ohren hörten und sein Tun mit eigenen Augen sähen. Mit den Hirten knien wir an der Krippe nieder; in Nazareth beten wir ihn in seinem verborgenen Leben mit Maria und Josef an; wir begleiten ihn mit seinen Jüngern auf seinen Wanderungen, nehmen seine heiligen Worte auf, wir werfen uns vor ihm nieder bei der Fußwaschung und während des Abendmahles. Wir betrachten Jesus am Ölberg, in seinem Leiden und vor allem am Kreuz. Er ist Gott! Hören wir seine letzten Worte. Sagt er nicht jedem von uns: «Für dich, aus Liebe zu dir gebe ich mein Leben hin»? Dieser Gedanke überwältigte den hl. Paulus: «Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben», schreibt er an die Galater (2,20). Wenn wir Jesus in allen Phasen seines Lebens - von der Kindheit bis zur Auferstehung und Himmelfahrt - betrachten, geht eine heiligende Kraft von ihm aus: «Es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte» (Lk 6, 19).
Richten wir unsern Blick voll Glauben auf ihn, um seine Tugenden nachzuahmen, «nicht von außen, sondern von innen»: «Ut per eum quem similem nobis foris agnovimus intus reformari mereamur» (Oratio der Oktav von Epiphanie).
Noch einige kurze Erwägungen über die Art der Betrachtung.
Viele Priester betrachten nach einer bestimmten Methode; wenn diese ihnen hilft, wäre es unrecht, sie aufzugeben. Die Kirche hat nachdrücklich den Nutzen mancher Methoden betont. Dennoch wäre es ein Irrtum, die Methode mit dem Gebet gleichzusetzen, als ob man außerhalb dieses Rahmens nicht beten könnte. Die Methoden sind nur Mittel zum Zweck.
In früheren Jahrhunderten lernte man das innere Gebet vornehmlich auf die Weise, dass man sich daran gewöhnte, die Lesung der Heiligen Schrift oder eines frommen Buches zuweilen zu unterbrechen. In diesen Pausen sammelt sich die Seele, überlegt, gewinnt eine Überzeugung, sieht ihre Pflichten und vollzieht Akte der Gleichförmigkeit mit dem Willen Gottes, spricht ihre Hoffnung und ihre Bitten aus. Wenn die Anregung dazu aufhört, setzt man einfach die Lesung des inspirierten Buches fort.
Auf diese Weise übten die Wüstenväter, diese großen Lehrer der Heiligkeit, das innere Gebet. Mit dem hl. Benedikt haben die abendländischen Mönche diese Tradition übernommen. Auch die hl. Theresia von Avila empfiehlt diese Methode (Ihr Leben, von ihr selbst geschrieben, XI. u. XII. Kap.).
Sie ist sehr einfach, doch sie hat den großen Vorteil, für alle durchführbar zu sein und die Zerstreuungen zu vermindern. Wenn in der Vergangenheit so viele Seelen auf diesem Weg zur Beschauung geführt wurden, warum sollte sie nicht auch uns zu dieser Gnade verhelfen?
Jeder prüfe selbst, welche Art der Betrachtung ihm zusagt. Achten wir darauf, dass unsere Betrachtung unsern geistlichen Bedürfnissen entspreche, den Schwächen, die wir überwinden und den Aufgaben, die wir erfüllen sollen, angepasst sei und dass sie die Seele Gott gegenüber immer treuer macht.
Im Anfang wird eine gewisse Unsicherheit unvermeidlich sein; deshalb soll sich niemand scheuen, ein Buch zu Hilfe zu nehmen. Wir lesen in einer Antiphon am Fest der hl. Cäcilia: «Evangelium Christi gerebat in pectore suo, et a colloquiis divinis et ab oratione non cessabat.» Sie trug das Evangelium Christi nicht in der Tasche, sondern «in der Brust», in ihrem Herzen. Auch der Priester wird in der demütigen und innigen Betrachtung des Evangeliums, der Apostelbriefe und anderer Bücher allmählich den Geist des Gebetes erlangen. Nach einem Akt der Zerknirschung versetze er sich in die Gegenwart Gottes und öffne sich voll und ganz dem heiligenden Einfluss Jesu, dem Wirken des Heiligen Geistes; dann lese er ein wenig, schalte Unterbrechungen ein. So wird die Seele unmerklich lernen, mit ihrem Herrn zu sprechen.
Vergessen wir nicht, dass die große Offenbarung, die uns im «zweiten Vorhof» zuteil wird, die Kenntnis Jesu Christi in seinen Geheimnissen ist; wir können nicht erwarten, Kenntnis von den Wegen Gottes, seinem Willen und seinem Wesen zu erlangen, wenn wir nicht sein menschgewordenes Wort betrachten und hören.
C. Beschauung im Glauben
Betrachten wir den dritten Vorhof.
Einmal im Jahr durfte der Hohepriester allein das Allerheiligste jenseits des heiligen Vorhangs betreten. Er sprach den Namen Jahwes aus und im Wissen um die Gegenwart Gottes wendete er sich ihm in ehrfurchtsvoller Anbetung zu.
Wir sehen darin ein Sinnbild des Zugangs der Seele zur Beschauung im reinen Glauben, «durch den Schleier der heiligen Menschheit Jesu» (Hebr 10,20).
Alles, was über die Natur des Gebetes gesagt wurde, gilt in vollendetster Weise für die Beschauung ; sie ist im wahrsten Sinn das Zwiegespräch, zu dem die Kinder Gottes durch die Taufgnade eingeladen sind. Vereint mit Christus, an seiner Kindschaft teilnehmend, wird ihnen zusammen mit ihm Zugang zum Schoße des Vaters gewährt.
Es gibt eine Vorstellung von dieser Art des Gebetes, wenn wir uns an den Bauern erinnern, den der Pfarrer von Ars jeden Abend in der Kirche sah, die Augen auf den Tabernakel gerichtet, ohne die Lippen zu bewegen. Auf die Frage, was er denn tue, antwortete der Bauer: «Ich schaue Gott an und Gott schaut mich an» (Mgr. Trochu, Le cué d'Ars, S. 224). Das ist das Gebet des einfachen Blickes: man schaut sich gegenseitig an, man schweigt, man liebt. Jede gläubige Seele sollte nach einiger Zeit zu dieser Gebetsart gelangen. Im Anfangsstadium stützt sie sich noch auf das erworbene Gebet, d. h. auf jenes, bei dem wir durch eigenes Bemühen mit Hilfe der Gnade unsere Ruhe in Gott finden können.
Was hindert gottgeweihte Seelen, diese Gebetsart zu erlangen? Meist nur Kleinigkeiten. Es ist traurig: man beschäftigt sich stundenlang mit unwesentlichen Dingen, man denkt viel an sich selbst, man hängt an tausend Nichtigkeiten, und so vergeht die Zeit. Vergessen wir nicht, dass das Gebet Ausdruck der Grundhaltung unserer Seele ist.
Im Interesse seiner eigenen Heiligung wie auch im Hinblick auf die Seelenführung eifriger Christen darf der Priester nicht übersehen, dass Gott in diesem Leben treue Diener auserwählt, um sie zu einer innigeren Verbindung mit sich zu erheben. Er ist König, höchster Herr, er befiehlt; sie müssen sich für seinen Ruf bereithalten, dem göttlichen Werben folgen und sich anstrengen, ihr Leben ganz aus der Liebe zu gestalten. Diese Ruhe im Schoße des Vaters ist «der beste Teil» hienieden - «optima pars» (Lk 10,42).
Wir wollen versuchen, uns eine Vorstellung von der Erhabenheit dieses Gebetes zu machen.
Die beseligende Anschauung ist gleichsam sein höchstes Vorbild. Im Himmel werden wir Gott kraft des Glorienlichtes schauen. Dieses erhöht die Fassungskraft des geschaffenen Verstandes, so dass ihm die unmittelbare Schau möglich wird.
Dieses Licht wird den Auserwählten je nach dem Ausmaß ihrer Liebe gewährt. Die Stufe unserer Glorie im Himmel wird jener der Liebe entsprechen, die wir in der Todesstunde erreicht haben.
Bei der Beschauung auf Erden entspricht dem Glorienlicht der Glaube. Der Glaube ist eine Gewissheit, ein Schauen im Dunkel; doch je vollkommener er wird, desto mehr Lebendigkeit gewinnt er, desto mehr vermag er Gott in der Wirklichkeit seiner Geheimnisse zu erfassen.
Und wie der Grad der beseligenden Schau für jeden von uns vom Grad der Liebe abhängt, so ist es auch beim Gebet des Glaubens: die dunkle, aber höhere Erkenntnis, die der Seele verliehen wird, hat ihre verborgene Quelle in ihrer Liebesvereinigung mit Gott. Darum geschieht das Wunderbare: das Gebet, das die Seelen zum Allheiligen erhebt, verähnlicht sie dem Herrn und macht es ihnen möglich, Gott im Glauben zu erkennen und zu lieben, wie er selbst sich in der Trinität sieht und liebt (Siehe: L'enseignement de dom Marmion sur la mystique, in Vie spirituelle, Januar 1948, S.100-115).
Ein Wort der Heiligen Schrift: «Unser Gott ist verzehrendes Feuer» (Hebr 12,29), lässt uns die Erhabenheit des Glaubensgebetes besser erfassen. Wenn «Gott ein verzehrendes Feuer» ist, so wird man umso mehr von diesem Feuer ergriffen, je mehr man sich ihm nähert. Nun fällt aber der Funke nur im Gebet in unsere Seele; das Feuer flammt auf, die Seele ist hingerissen von Liebe zum Allheiligen; sie ersehnt inbrünstig, durch den menschgewordenen Sohn mit dem Vater vereinigt und in deren wechselseitige ewige Liebe, den Heiligen Geist, hineingenommen zu werden.
Verweilen wir zu den Füßen Jesu, «ruhen wir uns aus im Schatten des Geliebten» (Hld 2, 3). Was ist dieser Schatten? Die heilige Menschheit Christi. «Der Vater wohnt im unzugänglichen Licht» (1 Tim 6, 16). Das Verbum «ist ja des ewigen Lichtes Abglanz» (Weish. 7,26). Es ist die leuchtende Sonne, deren Strahlen uns blenden, deren Glut wir nicht ertragen könnten. Um also dem Göttlichen Wort zu nahen, ruht die Seele in seiner Liebe, im Schatten der heiligen Menschheit.
Wenn sie sich dieser Vereinigung erfreut, bedeuten die Welt und ihre Lockungen nichts mehr für sie; sie erfasst, dass Gott allein das «eine Notwendige» ist (Lk 10,42). Vereint mit Jesus, verborgen in ihm, spricht sie zu ihm: «Du siehst den Vater, ich bin im Dunkel, doch ich betrachte ihn mit deinen Augen.»
Wie beglückend ist es doch, zu leben, während der Blick des Vaters durch den Schleier der heiligen Menschheit hindurch auf uns gerichtet ist! «Niemand kennt den Vater als der Sohn und der, dem der Sohn es offenbaren will» (Mt 11,27).
Im Gebet des Glaubens erstrebt die Seele nicht ein Vorstellen und Erfassen Gottes durch den Verstand, sondern sie will ihn selbst besitzen und ihm ganz gehören. Tatsächlich ist keine menschliche Vorstellung imstande, der Seele den Herrn in dieser Weise zu vermitteln. Die Vereinigung vollzieht sich im Dunkel einer vollen Glaubenszustimmung.
Für gewöhnlich müssen auch sehr heilige Seelen mit dem Gebet der «ersten Vorhöfe» beginnen. Dort können wir uns durch eigenes Bemühen, unterstützt von der Gnade, vorbereiten, dass Christus unser alles werde.
Wenn Gott einen Menschen einlädt, in die Beschauung des reinen Glaubens tiefer einzudringen, lässt er ihn erleben, dass er völlig unfähig ist, sich aus eigener Kraft dazu zu erheben. In diesem Stadium gilt es, nicht das Vertrauen zu verlieren, selbst wenn das Warten lang scheint. Die Seele muss es annehmen, im Dunkel zu bleiben, und Christus bitten, er selbst möge ihr seine Züge einprägen. Wenn wir aus uns selbst zur Verähnlichung mit dem Sohn Gottes gelangen wollen, werden wir sein Werk nur stören. Nur in dem Maße, in dem wir dem Ich sterben, wirkt der Herr in uns. Sprechen wir: «Herr, wenn diese Ohnmacht, dieses Dunkel dich verherrlicht, nehme ich alles an; wenn ich vor Dir 'wie dürres Land' bleiben soll (Ps 143,6), so sei gepriesen.»
Mag unser Gebet noch so unvollkommen sein, wir Priester können der häufigen Erhebung der Seele zu Gott gar nicht genug Bedeutung beimessen. Der Vater sieht uns stets an mit einem Blick, der bis in die letzte Tiefe unserer Priesterseele vordringt. Er liebt uns in seinem Sohn Jesus: «Der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt» (Joh 16,27). Erwidern wir diesen erbarmungsvollen Blick, indem wir uns immer wieder mit Hochherzigkeit und Treue um das Gebet bemühen.
5. Das Gebet Jesu
Bitten wir Christus, er möge uns beten lehren. Er ist der große Lehrer des Gebetes, durch sein Beispiel, durch seine Worte, durch den Heiligen Geist, den er uns sendet.
Sein verborgenes Leben in Nazareth war ausgefüllt mit Schweigen und Sammlung. Während seines öffentlichen Wirkens widmete er sich vorbehaltlos der Menge und jedem einzelnen, doch sein Blick blieb stets auf den Vater gerichtet. Wie die Evangelien berichten, hat er oft allein auf einem Berg gebetet, aber er betete auch öffentlich, z. B. als er seine Jünger das Vaterunser lehrte, oder als er vor der Brotvermehrung Dank sagte (Joh 6, 11).
Jesus betete da als Mensch. Als Gott konnte er nicht beten, denn das Gebet setzt eine Inferiorität, ein Bedürfnis voraus; es kommt wesentlich dem Geschöpf zu.
Ist es uns möglich, etwas von dem Gebetsleben Jesu zu erahnen? Wir stehen hier an der Schwelle eines Heiligtums, dessen Geheimnis unsere Fassungskraft übersteigt.
Immerhin können wir uns eine Vorstellung davon machen, wenn wir an die drei Erkenntnisweisen denken, die Christus in seiner menschlichen Natur eigen waren. Die Theologen nennen sie die drei Erkenntnisweisen Christi. Jede von ihnen erleuchtete in besonderer Weise seinen Verstand, und schon auf Grund der verschiedenen Grade der Einsichten, die sie vermittelten, wurden sie für ihn zum Ursprung verschiedener Gebetsweisen.
Kraft der hypostatischen Union besaß Jesus die beseligende Anschauung Gottes. Er barg in sich ein Allerheiligstes, gleichsam die «Seelenspitze», zu dem er allein Zutritt hatte. Er blieb stets der eingeborene Sohn, der in der Gegenwart des Vaters verharrte.
Wenn wir Gott anrufen, sagen wir «Unser Vater» in dem Sinn, der für alle seine Adoptivkinder gilt. Doch Jesus betrachtete den Vater und ruhte in ihm als sein Sohn, in einer Art, die ihm allein zukommt, denn die Menschheit Jesu ist die des Göttlichen Wortes.
Jesus überwand gleichsam mit mächtigem Flügelschlag die Distanz, die das Geschaffene vom Ungeschaffenen trennt; seine Verbindung mit dem Vater war beständig. Er konnte in Wahrheit sprechen: «Der mich gesandt hat, ist bei mir; er lässt mich nicht allein» (Joh 8, 29). Durch die beseligende Schau stand die Kontemplation Jesu höher als das erhabenste Gebet eines andern Menschen. Sie vollzog sich in der höchsten Region seines Geistes. Das hohepriesterliche Gebet nach dem Letzten Abendmahl, das uns der hl. Johannes überliefert, verrät uns etwas vom Verkehr des Erlösers mit dem Vater: «Vater ... verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche» (Joh 17, 1). Diese Schau war ganz geistig und übernatürlich; Phantasie, Fleisch und Blut hatten keinen Anteil daran und selbst die Leiden der Passion konnten sie nicht verhindern.
Außer dieser intuitiven Erkenntnis - die ohne Hilfe von Vorstellungen eintritt -, gab es in der Seele des Erlösers noch eine andere Erkenntnisart, deren Gegenstand nicht Gott selbst war. Das ist das «eingegossene» Wissen. Durch sie erfasste Jesus in anderer Weise als wir die Wahrheiten, die er der Welt brachte, und das ganze Erlösungswerk. Er erkannte es durch ein übernatürliches Licht. Es war kein «erworbenes» Wissen, sondern eines, das er von oben empfangen hatte. Dadurch war es Jesus möglich, die Beschlüsse der göttlichen Weisheit hinsichtlich des Heiles der Menschheit, des Mystischen Leibes, der Kirche zu verstehen. Die Größe der Sünde, die Liebe und die Undankbarkeit der Menschen lagen vor seinem Blick offen.
Dank dieses Lichtes konnte Jesus - wie der hl. Paulus berichtet - bei seinem Eintritt in die Welt die Aufopferung seiner selbst vollziehen: «Siehe, ich komme ... um deinen Willen zu tun, o Herr» (Hebr 10, 7).
Während seines Erdenlebens war ihm diese Erkenntnis die Voraussetzung dafür, den Vater zu verherrlichen und ihm für die Früchte der Frohbotschaft zu danken: «Ich preise Dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass Du dies vor Weisen und Klugen verborgen, Kleinen aber geoffenbart hast» (Mt 11,25).
Die gleiche Erleuchtung ließ ihn den Becher des Leidens annehmen und gab ihm das Gebet letzter Hingabe und Liebe ein: «Vater, ... nicht mein Wille geschehe, sondern der deine» (Lk 22, 42).
Vergessen wir nicht, Christus war ein Mensch wie wir, uns in allem gleich, nur die Sünde ausgenommen. Darum besaß er noch eine dritte Erkenntnisweise: ein menschliches, natürliches, erworbenes, auf Erfahrung gegründetes Wissen, wie wir alle es besitzen.
Auch dieses bot seinem Gebetsleben Nahrung. Wenn er über die Berge und durch die Täler Galiläas wanderte, wenn er die Weinberge betrachtete, die Erntefelder, die Blumen, von denen er im Evangelium sprach, schien ihm die Schönheit der Natur ein Widerschein der göttlichen Herrlichkeit und weckte in seiner Seele Lobpreis. Durch den Schleier des Geschöpflichen drang er ohne Mühe zu der göttlichen Vollkommenheit vor, die es in etwa spiegelt.
Große Mystiker wie der hl. Johannes vom Kreuz und die hl. Angela von Foligno bezeugen, dass nach der Ekstase eine übernatürliche Klarheit in ihrem Geist verblieb, die sie in unbeschreiblicher Freude die Spuren Gottes in der Natur finden ließ. - Auch in Jesus war ohne Zweifel dieser Widerschein des göttlichen Lichtes, doch in unvergleichlich höherer Art. Der Glanz des Schauens von Angesicht zu Angesicht - das können wir annehmen - überstrahlte alle seine Erkenntnisse, die eingegossenen wie die erworbenen.
XVI: PRIESTER UND HEILIGER GEIST
Alle Heiligkeit in der Kirche geht vom Heiligen Geist aus. Die übernatürliche Tätigkeit der Kinder Gottes auf ihren verschiedenen Stufen hängt von seinem lebenspendenden Einfluss ab: «Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes» (Röm 8, 14). Das ist Glaubenslehre.
Es ist von großer Wichtigkeit für alle, vornehmlich aber für die Priester, eine möglichst vollkommene Übereinstimmung zwischen ihrem persönlichen religiösen Leben und dem Glauben herzustellen. Prüfen wir daher, ob wir dem Wirken des Heiligen Geistes in unserm Innenleben genug Bedeutung beimessen. Sind wir davon überzeugt, dass es für unsere Heiligung eine gebieterische Notwendigkeit ist, ihm unsere Seelen weit zu öffnen ?
Jesus ist ohne Zweifel in diese Welt gekommen, um ihr den Vater zu offenbaren: «Vater … Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart» (Joh 17,6). Doch dies war nicht das einzige Ziel der göttlichen Heilsordnung. Der Mensch sollte durch den Erlöser auch den Heiligen Geist kennenlernen und ihn in gleicher Weise verehren wie den Vater und den Sohn.
Die Jünger waren erstaunt, als Jesus eines Tages zu ihnen sagte: «Es ist gut für euch, dass ich hingehe.» Aber Christus ist doch gekommen, um uns zu erlösen, um uns zu leiten, um unser alles zu sein; und nun behauptet er, sein Scheiden nütze den Menschen? Der Grund, den der Herr dafür angibt, ist noch erstaunlicher: «Wenn ich nicht hingehe, kommt der Beistand nicht zu euch» (Joh 16, 7).
Vergessen wir es nicht: mag unser Gebet noch so armselig sein, es ist uns sehr nützlich, an die Zwiesprachen Christi mit dem Vater zu denken. Der Apostel zögert nicht, zu sagen: «Jesus ist das Ideal, zu dem wir in unserer Schwachheit aufschauen müssen, ohne je den Mut zu verlieren» (Hebr 12,2-3).
Wenn wir damals unter den Jüngern gewesen wären, hätten wir vielleicht erwidert: «Meister, wir brauchen den Heiligen Geist nicht. Du genügst uns; bleibe Du bei uns. Warum soll ein anderer Deine Stelle bei uns einnehmen?»
Doch Jesus verkündet unzweideutig: «Es ist gut für euch, dass ich hingehe.»
Nach den Plänen Gottes können seine Adoptivkinder nur durch den Glauben in Verbindung mit der Welt der Übernatur treten: durch Christus, die Kirche, die Sakramente, vornehmlich die Eucharistie; im Glauben müssen sie auf Gott hoffen, ihn lieben, ihm dienen. Voraussetzung dafür ist einerseits das Aufhören der sichtbaren Gegenwart Jesu in unserer Mitte, anderseits das unsichtbare, aber lebenspendende Wirken des Heiligen Geistes.
Seine Aufgabe ist es, die Kirche und jede einzelne Seele im besondern ihrer ewigen Bestimmung zuzuführen.
1. Der Heilige Geist belebt die Kirche
Als Aufgabe des Heiligen Geistes offenbart uns das Evangelium die Vollendung des Werkes Christi.
Welchen Beweis hatten wir für die Heilswirkung des Blutes Jesu, als er auf Kalvaria sein «Consummatum est» sprach? Gewiss, Jesus hatte gepredigt; er hatte seine Apostel herangebildet; er hatte ihnen wenige Stunden zuvor die erste Kommunion gereicht; er hatte sie zu Priestern geweiht. Dennoch schien in der Stunde seines Todes alles gescheitert zu sein: die Jünger waren von Furcht und Schrecken erfüllt, Petrus verleugnete seinen Meister.
Doch zu Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Apostel herab, und nun erneuerte sich das Antlitz der Erde: «Sendest du deinen Geist aus … und du erneuerst das Antlitz der Erde» (Ps 104, 30). Petrus verliert alle Furcht, er tritt mitten in Jerusalem auf und predigt Christus. Die Stimme der Zwölf dringt bis ans Ende der Welt, und binnen wenigen Jahren bekennen Tausende sich zu Christus. Wie geschah dieses Wunder? Wir besingen es in der Pfingstpräfation: «Christus, ... aufgefahren in den Himmel, thronend zu Deiner Rechten, hat, wie er verheißen, den Heiligen Geist über die Gnadenkinder ausgegossen.»
Von diesem Augenblick an hat die Kirche trotz aller Verfolgungen, trotz aller Glaubenskämpfe, trotz der Treulosigkeit ihrer eigenen Söhne gelebt und wunderbar gesiegt. Sie schreitet durch die Jahrhunderte, voll Zuversicht kraft ihrer Vorzüge, die unwiderlegliche Beweise für ihren göttlichen Ursprung sind. Durch ihren Glauben und ihre Verbindung mit dem Throne Petri ist sie immer einig; sie heiligt zu allen Zeiten ihre Glieder durch die ihr verliehene Kraft; sie hat das Recht, die ganze Menschheit in ihrer Hürde zu umhegen; und gestützt auf das Fundament der Apostel ist sie unerschütterlich. Die eine, heilige, katholische, apostolische und römische Kirche ist göttlich und irdisch zugleich; sie wird bekämpft, ist von Gefahren umgeben, doch sie hält stand, sie schreitet voran, bleibt sich selber stets gleich in ihrer göttlichen Konstitution, unverletzlich in ihrem Glauben und unaufhörlich «belebt vom Heiligen Geist»: «Spiritum vivificantem.»
Was wissen wir von diesem Geist? Betrachten wir die heiligste Dreifaltigkeit.
Der Sohn, der von Ewigkeit her gezeugt wird, ist das vollkommene Abbild des Vaters: «Gott von Gott, Licht vom Licht» (Credo). Doch er wendet sich zum Vater zurück, und diese Verbindung zwischen dem Vater und dem Sohn ist fruchtbar. Aus dem Hauch ihrer gegenseitigen Liebe geht der Heilige Geist hervor, der die unendliche Liebe ist und sich als solche völlig auf seinen Ursprung richtet.
Die Heiligkeit besteht darin, sich Gott aus Liebe unterzuordnen. Da die dritte göttliche Person in einem ewigen Strömen der Liebe ganz aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, wird sie im wahrsten Sinn des Wortes heilig genannt: Heiliger Geist ist ihr Eigenname.
Aus der Liebe des Vaters und des Sohnes hervorgehend, ist der Heilige Geist auch die unendliche Gabe, die ihre Verbindung besiegelt. Er ist das Ziel, die Vollendung der Mitteilung des innergöttlichen Lebens.
Als die Gabe der Liebe im Schoß der Dreifaltigkeit ist er für uns im eigentlichen Sinn die Gabe des Allerhöchsten. Mit der Kirche und im gleichen Sinn wie sie verehren wir ihn als den Gast unserer Seelen; er lebt in ihnen und macht sie zu einem Tempel des Herrn: «Denn Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr» (1 Kor 3, 17).
Auf die gesamte Kirche und auf jeden Christen kommt der Heilige Geist mit der Fülle seiner Gnade herab. «Fons vivus, Ignis, Caritas» (Hymnus: Veni creator Spiritus). Er ist der «Lebensquell» der übernatürlichen Kraft, das «Feuer», von dem Glut ausstrahlt, die «Liebe», die Ursprung der Heiligung und der Eintracht der Seelen ist.
Wenn er zu uns kommt, bringt er uns seine Gaben. Die Liturgie nennt ihrer sieben: «Sacrum septenarium.» Diese Zahl ist in der Kirche traditionell. Sie bedeutet die Fülle des Wirkens, das der Heilige Geist in unsern Seelen vollbringt.
Die Gaben gehören zum Gnadenstand. Sie sind eine eingegossene, dauernde Disposition, verschieden von den Tugenden, und vermitteln dem Christen eine ganz besondere Fähigkeit, die Erleuchtungen und Anregungen von oben aufzunehmen. Durch diese Einwirkung des Geistes wird es den Gotteskindern ermöglicht, wie von einem höheren Instinkt geleitet zu handeln, in einer Weise, die unsere verstandesmäßige Übung der Tugenden übersteigt.
(Unsere Akte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe können zwar ebenso wenig wie die eingegossenen sittlichen Tugenden ohne übernatürliche Inspiration geübt werden; aber wir vollziehen sie doch nach dem vernunftgemäßen Vorgehen, das den höheren Tätigkeiten des Menschen eigen ist: man bestimmt selbst sein Handeln, indem man die Motive und Gründe dafür abwägt. Handelt der Mensch hingegen durch die Kraft der Gaben des Heiligen Geistes, so gehen seine Gesinnung und seine Akte aus göttlichem Antrieb hervor. Sie widersprechen zwar nicht der Vernunft, sind aber nicht von ihr bestimmt; ihr psychologisches Vorgehen ist supradiskursiv ; es hat seinen Ursprung in einem göttlichen Antrieb und vollzieht sich auf eine Art, die die Theologie übermenschlich oder göttlich nennt).
Die Atmosphäre, in die der Christ durch den Gebrauch der Gaben des Heiligen Geistes versetzt wird, ist ganz übernatürlich. Durch sie vollendet sich in ihm in der erhabensten Weise seine Verähnlichung mit dem Gottessohn.
In der Praxis wirken die Tugenden und die Gaben zusammen; und je christusverbundener eine Seele lebt, umsomehr ist sie dem Einfluss des Heiligen Geistes ausgesetzt. Das beobachtet man bei den Heiligen.
2. Es ist notwendig, den Beistand des Heiligen Geistes zu erflehen
Unser Leben ist ganz dem Heiligen, Ewigen geweiht; dennoch stehen wir mitten im Wechsel des irdischen Geschehens. Beeinflusst durch unsere Umwelt, laufen wir Gefahr, unser Amt in allzu menschlicher Weise auszuüben und uns mit der buchstäblichen Erfüllung der uns gestellten Aufgabe zu begnügen, ohne uns ihrer übernatürlichen Bedeutung bewusst zu werden. Mögen die sakralen Verrichtungen noch so heilig sein, ihre oftmalige Wiederholung erzeugt durch die Macht der Gewohnheit eine gewisse Routine.
Um uns gegen den Geist des Naturalismus, der uns umgibt, und gegen das Sich-gehen-lassen zu schützen, ist es unerlässlich, dass jede unserer Handlungen vom befruchtenden Hauch des Heiligen Geistes berührt werde.
Dieser Geist wird «in unsern Herzen die Flamme der Liebe entzünden». Er allein gibt in geistlichen Belangen die volle Richtigkeit des Urteils: «Recta sapere.» Er gibt uns auch die Kindesgesinnung ein, die uns den Herrn in Wahrheit als unsern Vater anrufen lässt; er «inspiriert das Gebet»: «So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an … der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können» (Röm 8, 26).
Das sind einige der Wirkungsweisen des Heiligen Geistes in uns. Wer immer als Gotteskind leben will, muss darnach trachten, sich diesem Einfluss zu öffnen. Wie viele gibt es, sogar unter den Priestern, die diesen Geist der Liebe nicht kennen! Und doch ist er allein die Quelle des inneren Lebens, er allein befruchtet ihre priesterliche Tätigkeit.
(So entschieden Dom Marmion diese Glaubenswahrheit betont, so wird doch dadurch seine Lehre über Christus, der das Leben und die allgemeine Wirkursache der Gnade in jedem Glied seines mystischen Leibes ist, nicht abgeschwächt. Es sind zwei Aspekte der gleichen übernatürlichen Wahrheit, die keinerlei Widerspruch einschließen. Der hl. Thomas lehrt, dass Gott allein dem Menschen seine Gnadengaben spendet. Wie nur das Feuer Feuer verbreitet, so kann nur Gott allein das Geschöpf zur Teilnahme an seiner eigenen Natur führen; er vergöttlicht es. Die Gnade in uns hat also ihren Ursprung in der ganzen Trinität, doch als Werk der Liebe wird sie der Person des Heiligen Geistes «zugeschrieben». Dieselbe Mitteilung des göttlichen Lebens kann dennoch auch wirklich als Werk Christi betrachtet werden, dessen heilige Menschheit causa efficiens - nicht principalis, sondern instrumentalis - aller Gnaden ist, die den Menschen gewährt werden. Vgl. S. th. I-lI, q. 112, a. 1 ; IlI, q. 64, a. 1).
Jedes ökumenische Konzil wird mit dem «Veni Creator» eröffnet. Wenn das für die großen offiziellen Kirchenversammlungen gilt, dann sollten wir in unserm Priesterleben niemals etwas Bedeutenderes unternehmen, ohne den Beistand des Heiligen Geistes zu erbitten. Bei der Seelsorge - Beichtstuhl, Predigt, Krankenbesuch - werden wir niemals vergeblich den Geist Gottes anrufen. Er ist es, der vor allem die Herzen lenkt. Vergessen wir bei der Seelenführung nie, dass die wichtigste Aufgabe des Priesters darin besteht, die Seelen dem Wirken des Heiligen Geistes zu erschließen. Nebenbei sei bemerkt, dass der Priester im allgemeinen seinen Beichtkindern nicht gestatten soll, ihm vielseitenlange Briefe zu schreiben; er selbst wird sich für gewöhnlich damit begnügen, kurze und klare Richtlinien zu geben; die kürzesten sind oft die besten.
Es geht uns nicht darum, die menschlichen Bemühungen gering zu schätzen oder den Anteil der Hochherzigkeit, der Beständigkeit, der Klugheit in der Seelsorge zu bagatellisieren. Wir sind fest überzeugt von der Bedeutung dieser Momente; aber wir dürfen darüber nicht das Übernatürliche außer acht lassen.
Dieser Gedanke ist so wichtig, dass ich ihn etwas ausführen möchte. In den Paulusbriefen finden wir eine überraschende Stelle: «Und keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet» (1 Kor 12,3). Diese Worte wollen ohne Zweifel nicht behaupten, wir seien nicht fähig, mit den Lippen die Worte «Herr Jesus» auszusprechen oder ihren buchstäblichen Sinn zu verstehen. Das können wir alle.
Doch um in heilbringender Weise diesen Namen auszusprechen und mit der Person Jesu in christlichem Glauben und christlicher Hoffnung in Verbindung zu treten, dazu bedarf es eines Antriebes von oben. Das Konzil von Orange hat definiert, dass wir «ohne die Erleuchtung und Inspiration des Heiligen Geistes» (Can. 7) nichts tun können, was unser ewiges Heil fördert. Das ist Glaubenssatz.
Als der Herr auf Erden weilte, konnten sicherlich alle zu ihm gehen; war er doch um unseres Heiles willen auf die Erde gekommen. Und doch, wie verschieden war die Haltung jener, die ihm nahten! Die einen, z. B. die Pharisäer, hatten ein verhärtetes, verschlossenes Herz; andere hingegen ahnten das Geheimnis seiner Person und seiner Mission; sie glaubten an ihn und schlossen sich ihm an. Woher diese Verschiedenheit? Die Heilige Schrift sagt es uns an mehreren Stellen; und sie zeigt es uns vom Beginn des Heilandlebens an: Maria besucht Elisabeth und diese ruft aus: «Du bist gesegnet . .. und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.» Das Evangelium sagt uns, woher Elisabeth diese Erkenntnis hatte: «Sie wurde vom Heiligen Geist erfüllt» (Lk 1,41). Bei der Darstellung Jesu im Tempel erkannte der greise Simeon den Messias in dem Kinde der Jungfrau; und der hl. Lukas sagt, er sei «auf Antrieb des Heiligen Geistes in den Tempel gekommen» (Lk 2, 27). Das gleiche geheimnisvolle Drängen des Heiligen Geistes fühlten sicher auch die Kranken, die vertrauensvoll zum Heiland gingen, um ihre Genesung zu erbitten. Derselbe Geist weckte in Maria Magdalena Reue, so dass sie die Füße Christi mit ihren Tränen wusch. Er gab dem Petrus und den andern Jüngern ein, ihre Netze zu verlassen und Jesus zu folgen; er war es, der Johannes einlud, an der Brust des Meisters zu ruhen und ihn bis zum Fuß des Kreuzes zu begleiten.
Für uns gibt es eine ebenso innige, unmittelbare und fruchtbare Verbindung mit Jesus: die im Glauben. Nur der Heilige Geist kann diese heilbringende Verbindung schaffen. Und er tut es, indem er durch das Wirken der Gnade die Seele befähigt, auf übernatürliche Weise zu glauben, zu hoffen und zu lieben.
Solange Christus auf Erden lebte, war seine Gottheit verhüllt, die Menschheit hingegen war sichtbar; sie übte durch sich selbst eine gewisse Anziehungskraft aus, doch sie war nicht Gegenstand des Glaubens. Jetzt können wir Jesus in seiner Menschheit wie in seiner Gottheit nur durch den Glauben erreichen. So liegt es im Plan Gottes. Jede Begegnung mit Christus muss sich auf dieser Grundlage vollziehen. Diese Verbindung im Glauben ist die unerlässliche Vorbedingung für den Empfang der göttlichen Gaben. «Wer an mich glaubt, aus dessen Herzen werden ... Ströme lebendigen Wassers fließen», verkündet Jesus (Joh 7, 38). Und der Evangelist fügt hinzu: «Damit meinte er den Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glaubten» (Joh 7,39).
Die lebenspendende Begegnung mit Christus im Glauben vollzieht sich nur kraft der Gabe des Heiligen Geistes.
Man könnte ganz nahe zum Tabernakel gehen, und Christus doch sehr fern bleiben; wenn hingegen unser Leben unter der Einwirkung des Heiligen Geistes steht, wird die Verbindung ermöglicht, und wir sind Jesus ganz nahe.
Der Heilige Geist ist das Band zwischen dem Vater und dem Sohn; er ist auch das Band zwischen Christus und uns. So verstehen wir, wie wichtig es für die Ausübung unseres sakralen Amtes ist, stets seinem heiligenden Wirken unterworfen zu sein.
3. Wie sollen wir den Heiligen Geist anrufen?
Denken wir an das unauslöschliche Siegel, das unserer Seele durch die Sakramente der Taufe, der Firmung und der Priesterweihe eingeprägt wurde. Diese Merkmale verbleiben uns ständig. Kraft dieses Unterpfandes unserer Zugehörigkeit zu Christus können wir sie unaufhörlich vor Gott geltend machen. Ihnen verdanken wir es, dass wir den Heiligen Geist «herbeirufen» und so die übernatürlichen Wirkungen, die jedem Sakrament eigen sind, aufleben lassen können. Der hl. Paulus bezeugt dies ausdrücklich für die Priesterweihe: «Ich ermahne dich, Timotheus, lass die Gnadengabe Gottes, die kraft der Auflegung meiner Hände in dir ist, wieder aufleben» (2 Tim 1, 6).
Bei der Taufe wird nach dem Wort Jesu der Mensch zu einem neuen Leben geboren «aus dem Wasser und dem Heiligen Geiste» (Joh 3, 5). Von da an lebt der Heilige Geist in der Seele des Getauften. «Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz» (Gal 4, 6).
Der Taufcharakter allein ist schon unser Anwalt bei Gott. Stützen wir uns daher auf ihn, wenn wir den Heiligen Geist bitten, er möge uns lehren, als Gotteskinder zu beten, im höchsten Herrn unsern Vater zu sehen; er möge uns leiten, damit wir unser Leben aus der Fülle der Taufgnade gestalten, nach dem Bild Jesu, des eingeborenen Gottessohnes.
Was tut Christus bei der Firmung durch die Vermittlung des Bischofs? Er streckt die Hand über das Haupt des Firmlings aus und salbt ihn mit dem heiligen Chrisam; im Augenblick, da er ihm ein Kreuz auf die Stirn zeichnet, spricht er: «Ich bezeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes.» Dieses sichtbare Kreuzzeichen versinnbildet das unsichtbare Merkmal, das der Seele eingeprägt wird. Nun trägt sie das Siegel Christi, das leuchtend vor dem Blick der Engel und Heiligen steht. Es bezeugt, wessen Eigentum sie ist und wem ihre Liebe gilt. Der Bischof spricht ferner: «Ich stärke dich mit dem Chrisam des Heiles ...», das heißt, ich mache dich stark, ich vollende die Wirkung der Taufe, ich mache dich zum ganzen Christen, zum Soldaten Christi, der fähig ist, seine Sache zu verteidigen. Das heilige Chrisam, mit dem die Stirn gesalbt wird, versinnbildet die Salbung des Heiligen Geistes, der in die Seele Einzug hält und von ihr Besitz ergreift, um sie zu stärken.
Wenn wir uns auf dieses Merkmal berufen, bitten wir den göttlichen Geist, er möge uns in den Kämpfen und Schwierigkeiten des Lebens die Kraft geben, treue Soldaten Christi zu sein, stolz, ihm zu dienen, eifrig in der Verteidigung und Ausbreitung seines Reiches.
Die Seele des Priesters trägt noch ein drittes heiliges Zeichen, das der Priesterweihe, aus dem ihm ein besonderes Anrecht auf den ständigen Beistand des Heiligen Geistes erwächst. Wenn wir jeden Morgen voll Glauben die Hände zum Himmel erheben, können wir dem Herrn unsere Seele zeigen, die mit dem Siegel Christi gezeichnet ist. Das Priestertum Christi, sein Blut, sein Tod sind in uns eingeschrieben. Öffnen wir vor Gott unsere so «gezeichnete» Seele, rufen wir dadurch den Heiligen Geist und bitten ihn, die Gnade in uns aufleben zu lassen, die wir bei der Priesterweihe empfingen.
Schätzen wir die Siegel, die uns durch diese Sakramente verliehen wurden, sehr hoch. Stützen wir uns auf sie, denn unser ganzes übernatürliches Leben besteht darin, beharrlich die Gnaden in uns zu entfalten, die zu unserer Berufung als Getaufte, Gefirmte und Priester Christi gehören.
Dieser Ruf kann in einer einfachen Erhebung des Herzens bestehen, im Gebet zum Heiligen Geist, in einer der innigen Anrufungen, an denen die Pfingstliturgie so reich ist: «Komm, Vater der Armen ... Spender der Gnade ... süßer Gast der Seele . .. Heile, was verwundet ist ...» Es ist sehr wertvoll, diesen Aufschwung der Seele tagsüber immer wieder durch Stoßgebete zu erneuern. Der Jesuitenpater Peter Faber wendete sich sogar beim Breviergebet zwischen den Psalmen immer wieder an den Herrn: «Himmlischer Vater, sende mir Deinen Geist.» (Monumenta historica Societatis Jesu. Monumenta Fabri ... Matriti 1914, S. 505. - Dom Marmion blieb von seinem Noviziat an (1887) dieser Übung treu. S. «Un maitre de la vie spirituelle», SS. 453 und 485).
4. Die Gaben des Heiligen Geistes beim Zelebrieren der Messe. Die Gaben der Furcht, der Frömmigkeit, der Stärke
Unser ganzes Leben lang, bei jeder Handlung unseres heiligen Amtes sollen wir das heiligende Wirken des Gottesgeistes erflehen. Betrachten wir den Einfluss, den er im erhabensten Augenblick unseres priesterlichen Tagewerkes übt: bei der Heiligen Messe.
Es ist eine große Ehre für uns, dem Opfer Jesu Christi zugesellt, zu Dienern des Gottessohnes beim erhabensten priesterlichen Akt angenommen zu sein.
Nur der Heilige Geist kann bewirken, dass unsere innere Haltung der Größe dieser Handlung entspricht.
Von der Hinopferung Christi auf Kalvaria sagt der hl. Paulus nachdrücklich, der Erlöser habe sie «in der Kraft des Heiligen Geistes» (Hebr 9, 14) vollzogen. Das soll auch für uns gelten. Öffnen wir also unsere Seele dem Wirken des Geistes der Liebe, wenn wir dieses eine erhabene Opfer darbringen.
Wir möchten zeigen, welch heilbringende Wirkungen der Heilige Geist durch seine Gaben in uns hervorbringen kann, während wir die Heilige Messe feiern. Es ist nicht unsere Absicht, hier alle Gaben des Heiligen Geistes zu behandeln, sondern nur einen kurzen Überblick zu geben über die Fülle der Gnaden, die sie in sich schließen. (Dom Marmion behandelte dieses Thema in dem Buch «Christus, das Leben der Seele» in dem Kapitel «Der Heilige Geist, Geist Jesu». Siehe auch «Christus in seinen Geheimnissen», das Kapitel «Die Sendung des Heiligen Geistes»).
Zunächst: Sind die Gaben der Furcht und der Frömmigkeit während des Zelebrierens von Wichtigkeit? Ohne Zweifel; sie müssen die grundlegende Seelenhaltung des Priesters schaffen.
Am Altar dürfen wir niemals die unermessliche, unergründliche, unendliche Majestät des dreimal heiligen Gottes außer acht lassen, dem das Opfer dargebracht wird: «Nimm an, heiliger Vater ... Nimm an, heilige Dreifaltigkeit ...» Das Geschöpf würde sich gegen die Wahrheit verfehlen, wenn es nicht in Anbetung und im Wissen um sein Nichts vor dem Herrn stünde; diese Gesinnung wird niemals nachdrücklicher gefordert als bei der Heiligen Messe. Wie wir schon mehrmals betonten, muss das heilige Opfer «mit Furcht und Ehrfurcht» dargebracht werden. Es ist seinem Wesen nach ein Kultakt, durch den die unumschränkten Rechte Gottes anerkannt werden, eine Huldigung an seine volle Souveränität. Christus bietet dem Vater sein Kreuzesopfer in jener inneren Ehrfurcht dar, die bei einem so heiligen Akt sowohl dem Opferpriester wie auch der Opfergabe geziemt. Wenn wir der Gottheit so nahe kommen, vereinigen wir uns mit dieser Gesinnung des Herzens Jesu.
Wie im Erlöser, so soll auch in uns eine starke Abneigung gegen alle Sünden der Welt, gegen die Beleidigungen, die dem Allheiligen zugefügt werden, leben. Und hegen wir den inbrünstigen Wunsch, wieder gut zu machen.
Unter dem Einfluss des Antriebes, den der Heilige Geist durch die Gabe der Frömmigkeit ausübt, wird der Priester innewerden, wie sehr die Atmosphäre, in der sich die Opferhandlung abspielt, vom Geist der Kindschaft beherrscht ist. Die Liturgie ruft den Herrn mit dem Namen «Vater» an. Und wir können frei, sicher und vertrauend zur göttlichen Majestät hinzutreten «durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern Herrn». So innig ist unsere Verbindung mit dem Vater, dass wir das Wohlgefallen der Liebe, mit dem er dem Sohn zugewandt ist, auf uns zu beziehen wagen: «Ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii tui.» Der Priester am Altar identifiziert sich mit Jesus. Wie wichtig ist es doch da, dass er auch von Kindesgesinnung beseelt ist !
Bitten wir den Heiligen Geist, er möge uns lebendigen Glauben an die Liebe Gottes zu uns und grenzenloses Vertrauen zu unserm himmlischen Vater verleihen.
Unter dem Einfluss des Gottesgeistes fühlen wir uns am Altar auch gedrängt, alle Nöte der Menschheit auf uns zu nehmen, denn durch die Gabe der Frömmigkeit vereinigen wir uns mit der Liebe, die das Herz Jesu erfüllt. Wir denken an die vielfältigen Leiden dieser Welt, an die Sünder, für die Christus sein Blut vergossen hat; und wir bitten um Barmherzigkeit für die Betrübten, die Kranken, die Sterbenden, für alle, die in diesem gewaltigen Chor des Elends aus unserm Tränental zu Gott rufen. Oder vielmehr: es ist Christus, der durch unsern Mund den Vater um Erbarmen für sie bittet. Jesus wollte «unsere Leiden tragen» (vgl. Jes 53, 4). Glauben wir das fest. Wenn wir dem himmlischen Vater Jesus darbringen, dann fleht Jesus selbst, gleichsam bedeckt mit den Wunden seiner Glieder, die göttliche Güte an.
Diese Gesinnung der Frömmigkeit geht mit der Ehrfurcht Hand in Hand, wie es ein liturgisches Gebet ausspricht: «Herr, lass uns immerdar Deinen heiligen Namen zugleich fürchten und lieben» (2. Sonntag nach Pfingsten).
Treten wir nicht mit kaltem Herzen zum heiligen Opfer; bei der Betrachtung dieser Wahrheiten wird es erglühen. Dann wird der Heilige Geist in uns sein und uns zu innigerem Gebet befähigen.
Fragen wir uns, welche geistige Hilfe die Gabe der Stärke dem Zelebranten vermittelt.
Diese Gabe ist notwendig, weil großer Glaube von uns gefordert wird und wir gegen diese Tugend versucht werden können. Jeder Mensch ist Versuchungen gegen den Glauben ausgesetzt, doch der Priester ganz besonders.
Das scheint erstaunlich. Wir wollen die Gründe dafür betrachten.
Die Gläubigen sehen die heilige Hostie im feierlichen Augenblick der Wandlung, wenn alle Anwesenden auf die Knie sinken, um sie anzubeten, oder in der Monstranz, von Lichtern und Weihrauch umgeben, oder auch in den Augenblicken der Sammlung bei der Kommunion. Doch niemals dürfen sie die heiligen Gestalten berühren; nie sind sie in so enger Verbindung mit ihnen wie der Priester.
Der Priester steht immer in unmittelbarem Kontakt mit den heiligen Gestalten, unter denen sich Christus wie unter einem Schleier verbirgt. Er spricht die Worte aus, die Jesus beim Letzten Abendmahl sprach; er berührt die heilige Hostie, bricht sie, trägt sie von einem Ort zum andern; sie ist ganz in seiner Gewalt. Der Teufel kann diese unaussprechliche Willfährigkeit Jesu ausnützen, um seinen Diener zu versuchen. Da braucht der Priester die Gabe der Stärke, damit sein Glaube stets der Größe des Aktes entspreche, den er vollzieht; er braucht sie, um jede Versuchung zu überwinden und in der Überzeugung festzustehen, dass er sich wirklich in der Gegenwart seines Erlösers befindet, als ob er ihn mit seinen Augen sähe.
Die gleiche Gabe wird uns auch den Mut verleihen, uns jeden Tag Gott hinzuopfern wie Opfergaben, die ganz seinem Willen ausgeliefert sind, auch wenn er Schwerstes fordert. Scheint es uns schwer, das Kreuz anzunehmen oder es zu tragen, bitten wir den Heiligen Geist, er möge uns etwas von der übernatürlichen Kraft einflößen, die Jesus im Augenblick seines Opfers erfüllte.
5. Die Gaben der Wissenschaft, des Verstandes und des Rates
Betrachten wir die Gaben der Wissenschaft, des Verstandes und des Rates. Man möge nicht Anstoß daran nehmen, dass wir hier die gewohnte Reihenfolge ändern. Es ist beim Zelebrieren weniger wichtig, zu wissen, dass der Herr durch diese oder jene Gabe in uns wirkt, als vielmehr in lebendigem Glauben die Seele aufmerksam und aufnahmebereit für den Einfluss Gottes zu halten.
Seien wir überzeugt, die erhabensten Gedanken über die Heilige Messe vermögen uns Gott nicht nahezubringen, wenn sie nicht vom Licht des Heiligen Geistes erhellt sind. Es ist ohne Zweifel ausgezeichnet, gute theologische Kenntnisse zu besitzen, besonders über das heilige Opfer; doch man kann hochgelehrte Bücher über diesen Gegenstand lesen und nachher so kalt sein wie zuvor. Warum ? Weil das Gehirn alle Arbeit getan hat. Bemühen wir uns daher beim Studium auch um das übernatürliche Verständnis der göttlichen Geheimnisse; es genügt nicht, den Wortlaut des Textes zu erfassen. Der Geist der Liebe nur befähigt uns, das eucharistische Opfer in seiner ganzen Tiefe zu erleben.
Durch die Gabe der Wissenschaft bewirkt der Heilige Geist eine übernatürliche Hochschätzung der geschaffenen Dinge, das heißt, er lässt uns ihre Wichtigkeit oder Nichtigkeit in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes beurteilen. Die Heilige Schrift spricht von der «Wissenschaft der Heiligen» (Weish 10, 10). Dank der höheren Orientierung des Urteils erlagen die Heiligen nicht den Lockungen der Welt und konnten mit dem Apostel sprechen: «Ich betrachte das alles als Kehricht, um Christus zu gewinnen» (Phil 3, 8).
Diese Gabe ermöglicht es auch, den unvergleichlichen Wert der Glaubenswahrheiten und der sakralen Kultakte zu erfassen. Deshalb bitten wir vor dem Zelebrieren den Gottesgeist, uns richtiges Verständnis für den Wert der Heiligen Messe zu geben, eine Wertung, die mit dem Gedanken Gottes selbst über das erhabene Opfer übereinstimmt.
Diese Erkenntnis ist nicht Frucht einer Beweisführung. Sie ist unmittelbar; doch die innere Sicherheit, die sie verleiht, ist für den Priester überaus fruchtbar.
Möge der Heilige Geist sich würdigen, uns im Schweigen des Gebetes die Geheimnisse, die sich täglich unter unsern Händen vollziehen, so schätzen zu lehren, wie Gott sie schätzt.
Durch die Gnade des Verstandes verleiht der Heilige Geist Klarheit über die Glaubenswahrheiten an sich. «Der Geist ergründet alles, selbst die Tiefen der Gottheit», sagt der hl. Paulus; er ist es, der uns erkennen lässt, «was uns von Gott geschenkt ist» (1 Kor 2, 10 u. 12).
Im gewöhnlichen Leben vermag unser Verstand den Sinn oder die Bedeutung des Gelesenen aus eigener Kraft zu verstehen. Darum schreibt der hl. Thomas: «Intelligere, quasi intus legere.» (S. th. lI-lI, q. 8, a. 1).
In der übernatürlichen Ordnung geht etwas Ähnliches vor sich: eine geheimnisvolle Klarheit ermöglicht es unserm Geist, ein wenig in die Wahrheit einzudringen, die von Gott erhellt wird. Gewiss, der Christ nimmt diese Wahrheit schon durch einen einfachen Akt des Glaubens an; er hält sie für wahr, doch gleichsam wie von außen; durch die Gabe des Verstandes enthüllt sich die Wahrheit in sich selbst.
Die Kirche bezeugt in vielen ihrer Gebete die Wirklichkeit dieser inneren Erleuchtungen: «Wir bitten, o Herr: der Tröster, der von Dir ausgeht, möge unsern Geist erhellen und in alle Wahrheit einführen, wie es Dein Sohn verheißen hat» (Quatembermittwoch in der Pfingstwoche). So können wir in gewisser Weise bis ins Heiligtum der Gottheit vordringen.
Es ist ohne weiteres verständlich, wie nützlich diese Gabe für jene ist, die das heilige Opfer darbringen oder ihm beiwohnen. Auf dem Altar vollzieht sich göttliches Geschehen; weder Mensch noch Engel vermögen seine Bedeutung zu erfassen, seine Tragweite zu ermessen. Der Sohn Gottes ist da; er opfert sich unter den heiligen Gestalten; er schenkt sich. Der Vater blickt den Sohn an. Nur Licht von oben könnte uns ein wenig Verständnis für diese Geheimnisse geben und sie unserer Seele zugänglich machen.
Wenn wir die Worte der Heiligen Schrift oder der Liturgie lesen, glauben wir fest, dass der Heilige Geist uns - wie den Jüngern nach der Auferstehung des Herrn - ihren Sinn erhellen kann: «Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift» (Lk 24, 45). Wenn wir diese Worte ehrfurchtsvoll im Herzen bewahren, werden sie mehr und mehr die Gottesliebe in uns entfachen.
Die Gabe des Rates lässt uns wie durch einen höheren Instinkt erkennen, was nützlich ist, um uns und andere unserer übernatürlichen Bestimmung zuzuführen. «Nur jene, die sich vom Geist Gottes führen lassen, sind wahrhaft Kinder Gottes», sagt der hl. Paulus (Röm 8, 14). Durch diese Gabe sichert uns der Heilige Geist im Alltag gegen das Impulsive unserer Natur, gegen unsern Hochmut und unser selbstgefälliges Urteilen. Diese Fehler sind in der Seelenführung Ursachen von Täuschungen und Fehlgriffen; sie verleiten uns, zu handeln, ohne uns genügend Klarheit darüber zu verschaffen, welche Absichten Gott mit der einzelnen Seele verfolgt.
Bei der Feier des heiligen Opfers scheint die Gabe des Rates keine große Bedeutung zu haben. Doch für den Priester ist die Heilige Messe der Zeitpunkt, in dem er die Erleuchtungen erbittet, deren er so sehr bedarf. Wie oft braucht er doch diese Erleuchtungen für sein Reden, seine Entscheidungen, sein ganzes seelsorgliches Wirken!
Doch denken wir daran, dass der Glaube des Priesters an den Beistand des Heiligen Geistes ihm nicht das Recht gibt, bei der Erfüllung seiner Pflichten die Vernunft und die menschlichen Mittel zu vernachlässigen. Gott gibt die Gabe des Rates seinen Kindern nicht, um die Tugend der Klugheit überflüssig zu machen, im Gegenteil, diese Gabe soll die Tugend der Klugheit «unterstützen und vollenden» (S. th. lI-lI, q. 52, a. 2. ).
6. Die Gabe der Weisheit
Die erhabenste unter den Gaben des Heiligen Geistes ist die Gabe der Weisheit.
Sie ist eine Erkenntnis Gottes und des Göttlichen, die mit einem Leben der Gottvereinigung unzertrennlich verbunden ist. Diese Weisheit ist eine Frucht der Liebe; sie gehört daher einer andern Ordnung an als theoretisches und durch Denken erworbenes Wissen; sie ist ein «Verkosten» der Wahrheit, «sapida cognitio», und stellt eine innige, lebendige Verbindung zwischen der Seele und Gott her.
Wie ist das möglich? Durch das geheime Wirken des Heiligen Geistes. Wenn der Christ betet und Gott aus Liebe mit großer Treue dient, wenn seine Seele sich mit dem Herrn beschäftigt, gibt der Heilige Geist ihr diese übernatürliche Weisheit. Dann «verkostet» die Seele die Gegenwart Gottes. Sie erfährt sozusagen in ihrem Innern seine erbarmungsvolle Güte und die Mitteilung seines Lebens, die er seinen Adoptivkindern gewährt.
Durch diese Gabe bewegt der Geist Gottes die Seele, ohne Zögern die Seligkeit der Vereinigung mit Gott allen Freuden dieser Welt vorzuziehen und mit dem Psalmisten zu sprechen: «Wie lieblich sind Deine ZeIte mir, o Herr ... Ein Tag in Deinen Höfen ist besser als tausend fern von Dir» (Ps 84, 2 u. 11).
Doch wir können uns nur dadurch bereit machen, dieser geistlichen Freude teilhaft zu werden, dass wir aus unserm Leben die Wünsche und Eitelkeiten der WeIt verbannen: «Der natürliche Mensch erfasst nicht, was vom Geiste Gottes kommt» (1 Kor 2, 14).
Bei der Heiligen Messe dringt der Priester viel tiefer in die Geheimnisse der Eucharistie ein als durch ein verstandesgemäßes Studium. Dann fühlt er sich ganz wunderbar zur Hingabe gedrängt: «Imitamini quod tractatis - Ahmt nach, mit was ihr euch beschäftigt!»
Bedürfen wir überdies nicht alle im höchsten Maße der göttlichen Hilfe, um das eucharistische Brot geistig zu «verkosten»? Wir sprechen oft: «Brot vom Himmel … das alle Süßigkeit in sich enthält». Und wenn wir dann kommunizieren, kommt es vor, dass wir kein Verlangen nach diesem Lebensbrot haben!
Die Gabe der Weisheit bringt unserm Herzen auch inneren Frieden, der uns inmitten der Schwierigkeiten und Trübsale des Lebens durchhalten lässt. Deshalb sieht die Liturgie im Heiligen Geist den Tröster im eigentlichen Sinn des Wortes; sie lässt uns oftmals bitten, «dass wir uns seines Trostes allzeit erfreuen mögen». Wie wünschenswert ist doch dieser
Friede, der von Gott stammt, für den Priester! Wenn dieser Friede in seinem Innern herrscht, dann wird er beim heiligen Opfer immer mehr die Wirkungen der ewigen Güte verspüren.
Wenn auch diese Darlegungen ganz unvollständig sind, so können sie doch unsern Glauben und unsere Hoffnung auf das Wirken des Gottesgeistes bei der Feier der heiligen Geheimnisse beleben und uns helfen, die Routine zu überwinden.
Wir können vor der Messe die Gedanken des Gebetes aus dem Missale aufnehmen: «Dein Geist der Liebe durchdringe mein Herz. Ohne Geräusch lasse er sich vernehmen. Ohne Worte lehre er mich alle Wahrheit über das göttliche Opfer. Wie tief sind doch die Wirklichkeiten dieses von einem heiligen Schleier bedeckten Geheimnisses!» (Praeparatio ad missam, die dominica).
Die liturgische Tradition verkündet den Glauben der Kirche an die Mitwirkung des Heiligen Geistes beim Messopfer. Wir wollen uns nicht bei der Frage der alten Formeln der Epiklese aufhalten; beachten wir z. B. die gegenwärtig üblichen Opferungsgebete. Zusammen mit Brot und Wein wird die Selbsthingabe der Anwesenden aufgeopfert: «Suscipiamur a te - bei Dir Aufnahme finden…» Was tut da der Priester? Er breitet die Hände über die Opfergaben aus und bittet, dass der Heilige Geist kommen möge. «Veni, sanctificator omnipotens, aeterne Deus - Komm Heiligmacher, allmächtiger ewiger Gott ...»
Bei der Weihe des Altares, einer der schönsten liturgischen Zeremonien, wird zunächst der Opfertisch durch Besprengung mit Weihwasser gereinigt und mit heiligem Öl gesalbt. Dann legt man auf die fünf Kreuze, die die fünf Wundmale Jesu versinnbilden, Weihrauchkörner und zündet sie an. Während sich der Weihrauch verzehrt, betet der Bischof zusammen mit seinem ganzen Klerus: «Veni, sancte Spiritus - Komm, Heiliger Geist …» Das ist einer der feierlichsten Augenblicke dieser eindrucksvollen Zeremonie. Man bittet den Heiligen Geist, das Feuer der Liebe, er möge auf den Altar herabkommen, auf dem sich Jesus wie einst am Kreuze «per Spirit um Sanctum - durch den Heiligen Geist » darbringen wird. Man bittet ihn, alle Opfergaben zu heiligen, die darauf niedergelegt werden, und das Opfer der christlichen Gemeinde auf das innigste mit dem göttlichen Schlachtopfer zu vereinen.
Durch die Handauflegung des Bischofs haben wir in ganz besonderer Weise den Heiligen Geist empfangen; dieser göttliche Geist hat unserer Seele ein unauslöschliches Merkmal eingeprägt und sie mit der Gnade des Priestertums erfüllt. Seine Herabkunft in uns ist unsichtbar, doch sie sichert uns den Beistand des Himmels für unser ganzes Leben; in ihrer Kraft können wir die heiligen Geheimnisse feiern, predigen, die Seelen mit Weisheit leiten und die Betrübten trösten. Ehren wir den Heiligen Geist wie den Vater und den Sohn durch Anbetung, durch tiefe Dankbarkeit und völlige Hingabe, durch beständige Treue gegen seine Einsprechungen. Dadurch werden wir befähigt, Gott zu dienen «mit Freude im Heiligen Geist» (1 Thess 1, 6).
«Heiliger Geist, Liebe des Vaters und des Sohnes, nimm Du Wohnung im Innersten unseres Herzens und lenke stets unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Handlungen wie Feuerflammen bis ins Innerste des Vaters, damit unser ganzes Leben ein 'Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto - ein Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist' sei.
(Dieses Gebet ist ein Ausschnitt aus der «Weihe an die heiligste Dreifaltigkeit», die Dom Marmion im Jahre 1908 schrieb. Diesen Weiheakt vollzog er als Abschluss einer wichtigen Periode seines inneren Lebens und sie wurde zum Ausgangspunkt neuen Aufstiegs. Wir haben einen Kommentar zu dieser Weihe gegeben, der ganz aus Exzerpten aus den Schriften Dom Marmions besteht. Siehe den vollständigen Text S. 430-431).
XVII: HEILIGUNG DURCH DEN ALLTAG
Viele glauben, Heiligkeit bestehe darin, dass man viele Stunden im Gebet verbringt. Andere sehen sie vornehmlich in großen Verzichten und Leiden, die man aus Liebe auf sich nimmt; sie meinen, Heiligkeit müsse alles natürliche Empfinden im Menschen ertöten.
Solch einseitigen Auffassungen stellt der hl. Benedikt folgenden aszetischen Grundsatz entgegen: «Man muss in jedem Augenblick Gott dienen durch den Gebrauch der Güter, die er selbst uns verliehen hat» (Vorwort zur Regel). Das ist eine sehr fruchtbare Regel für das geistliche Leben; sie erstrebt die Unterwerfung unter Gott und die Harmonie des Menschlichen mit dem Göttlichen in uns. Wir machen Fortschritte durch den Gebrauch unserer natürlichen Fähigkeiten, durch die Erfüllung der Pflichten an dem Platz, an den die Vorsehung uns gestellt hat.
Das Tagewerk vieler Priester ist mit vielfältiger Arbeit überladen; das scheint ein Hindernis für das innere Leben zu sein. Doch das darf den Priester nicht entmutigen; er kann sich durch seine Tätigkeit heiligen, selbst durch die alltäglichste. Das lehren die Briefe der Apostel Paulus und Johannes.
Doch nur unter bestimmten Vorbedingungen geht von diesen Tätigkeiten eine heiligende Wirkung aus: sie müssen «wahr» sein, - von übernatürlicher Liebe eingegeben, - mit den Verdiensten der Handlungen Jesu vereint, - und unsere priesterliche Heiligung muss auf das Wohl der Kirche hingeordnet sein.
Es ist nicht notwendig, ständig an diese Bedingungen zu denken; es genügt, sich von Zeit zu Zeit daran zu erinnern, um unsern Glauben zu beleben und uns zu helfen, alles zur Ehre Gottes zu tun. Seien wir überzeugt, das geistliche Leben ist nicht unruhig und geschäftig, sondern friedvoll: wir betrachten Gott als Vater und erwarten in heiliger Hoffnung die Vereinigung mit ihm nicht so sehr durch unsere Gedanken, als vielmehr von der Macht seiner Gnade und unserer Treue.
Die Übung, sich im Lauf des Tages zu Gott zu erheben, verlangt gewiss Anstrengung; doch in dieser Welt wird nichts Dauerhaftes ohne Mühe erreicht.
Denken wir auch an das Dogma von der Gemeinschaft der Heiligen. In vielen Klöstern bringen gottgeweihte Seelen tagtäglich dem Herrn ihre Opfer und Gebete für die Heiligung der Priester dar. Schätzen wir den Wert und die Schönheit dieser Handlungsweise und gewinnen wir Zuversicht aus dem Gedanken an diese hochherzigen Opferseelen.
1. «In der Wahrheit wandeln»
Dieses Wort gebraucht der hl. Johannes mehrmals in seinen Briefen (2 Joh 4; 3 Joh 3) . Was will der Apostel damit sagen ?
«In der Wahrheit wandeln» heißt, unser ganzes Verhalten unserm Stand entsprechend nach den Gedanken und Absichten Gottes einrichten (Siehe in »Christus, das Leben der Seele», die Kapitel «Die Wahrheit in der Liebe» und «Unser übernatürliches Wachstum», wo Dom Marmion ausführlich diesen Gedanken darlegt).
Gott als Urheber unserer Natur und der Gnadenordnung will, dass unsere Handlungen unserer Stellung als Geschöpf und unserer doppelten Würde eines Adoptivkindes des Vaters und eines Priesters Christi vollkommen entsprechen. Wir müssen also jederzeit die Pflichten erfüllen, die sich aus dem Naturgesetz, sowie aus Taufe und Priestertum ergeben. Das sind die Gedanken Gottes in Bezug auf uns. Wenn unser Tun in Übereinstimmung mit diesem göttlichen Willen steht, vollbringen wir «Werke der Wahrheit» und «wandeln in der Wahrheit».
Der Herr sieht gern diese vollkommene Harmonie zwischen unsern Handlungen und den Gesetzen unseres Lebens. Fehlt diese Übereinstimmung, dann entsprechen unsere Werke nicht den Forderungen Gottes, mögen sie noch so gut scheinen.
Eine erste Folgerung aus dieser Lehre kann man für uns Priester etwa so formulieren: Wegen unserer ganz besonderen Berufung zur Heiligkeit sind wir mehr noch als die Weltchristen verpflichtet, die natürlichen Tugenden zu pflegen. Seien wir voll und ganz gerecht und billig in unseren Urteilen, wahrhaftig in unsern Worten. Geben wir niemals zu, dass sich in unser Handeln etwas einschleiche, was gegen die natürliche Ehrenhaftigkeit verstößt. Unter keinem Vorwand, auch nicht unter dem, der Religion einen Dienst zu erweisen, dürfen wir die Verpflichtungen außer acht lassen, die sich für jeden Menschen aus seinem gesunden, natürlichen Empfinden ergeben.
Unser priesterliches Wirken setzt mit Recht diese moralische Grundlage voraus.
Die Gaben der Natur mit denen der Gnade in Einklang bringen zu wollen, ist sicher ein ideales Streben. Doch täuschen wir uns nicht: in der Praxis ist dieses Ideal nicht zu verwirklichen ohne Verzicht auf vieles, was die Natur ersehnt, was ihr Befriedigung gibt; diese Dinge sind nicht immer mit unserm Stand vereinbar. Manche Opfer sind unerlässlich, sei es im Interesse der eigenen Seele des Priesters, sei es im Hinblick auf seine Aufgabe als Seelsorger. In der Ehe ist es zum Beispiel berechtigt, den Trost menschlicher Liebe zu suchen; vom Priester hingegen wird um der VorbehaltIosigkeit seiner Hingabe willen und im Interesse der Ausgeglichenheit seines Innenlebens hochherziger Verzicht darauf gefordert.
Wie die Gnade die Natur nicht zerstört, so vernichtet sie auch nicht die Persönlichkeit. Sie wird ohne Zweifel gegen den Hochmut vorgehen, gegen die Härte und viele andere Fehler, die kraftvollen Naturen eigen sind; doch wo sie große natürliche Gaben des Geistes, des Herzens und des Willens findet, die die beste Grundlage der wahren menschlichen Persönlichkeit bilden, da knüpft sie daran an. Das sehen wir bei den Heiligen aller Zeiten. Die Gaben der Gnade ließen sie über die gewöhnliche Mittelmäßigkeit hinauswachsen; die meisten waren tapfere Menschen, starke Persönlichkeiten, die großen Einfluss auf ihre Umwelt ausübten. Die Gnade hat ihre natürlichen Gaben nicht ausgelöscht, sondern vielmehr verübernatürlicht; sie bewirkte die völlige Unterwerfung unter Gott gemäß der Ordnung und darüber hinaus in der Fülle der Liebe.
Wir sind immer wieder vor die Wahl gestellt. Statt uns gehen zu lassen und uns um unser Wohlbefinden zu sorgen, leben wir lieber gemäß unserer Bestimmung als Menschen und gemäß der Heiligkeit unserer priesterlichen Berufung. Der Psalmist lädt uns ein, dieses Ideal zu erstreben, wenn er uns sprechen lässt: «Ich habe den Weg der Wahrheit gewählt» (Ps 119,30).
2. Omnia cooperantur in bonum
«Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten gereicht. Sie sind ja nach seinem Ratschluss (zu Heiligen) berufen» (Röm 8, 28). Und wurden wir nicht von Jesus «erwählt» (Joh 15, 16) ?
Manche sind der Meinung, dass nur die Messe, das Breviergebet und die religiösen Übungen die Seele mit Gott vereinen. Diese Auffassung ist nicht richtig. Gewiss, die religiösen Übungen entfalten und erhalten unser inneres Leben; durch sie wird die Überzeugung von dem Primat des Übernatürlichen belebt und die Reinheit der Absicht in der Seelsorge erhalten. Deshalb vermag ein heiliger Priester, der eng mit Gott verbunden ist, jeden zu stärken und zu trösten, der immer zu ihm kommt.
Die religiösen Übungen sind die Seele des Apostolates; das muss man immer wieder betonen. Dennoch ist wahr, wenn der hl. Paulus sagt, jede Handlung des Jüngers Christi, auch die allergewöhnlichste, trage zu seiner Heiligung bei.
Prüfen wir unsern Tageslauf von diesem Gesichtspunkt aus. Die Pflichten der Seelsorge nehmen viel Zeit in Anspruch. Ist es möglich, sich durch sie zu heiligen? Ganz sicher.
Die Tätigkeiten unseres Amtes sind an und für sich nicht zu unserer persönlichen Heiligung da, sondern zum geistlichen Nutzen des Nächsten. Wir müssen in ihnen vor allem die Gelegenheit sehen, uns andern zu widmen; doch sie können indirekt zu einem Mittel werden, unsere Seele zu reinigen, zu erleuchten, zu erheben, denn diese Aufopferung ist ohne Zweifel eine Quelle von Verdiensten und Gnaden für uns.
Beichthören und die andern Sakramente spenden, Religionsunterricht erteilen, Kranke besuchen sind Werke der Barmherzigkeit. Daher führen sie zu einem Wachstum des göttlichen Lebens in uns. Das gilt auch, wenn wir ein Begräbnis halten oder in den Vereinigungen der Pfarrei oder sozialen Werken mitarbeiten. Wenn wir diese Pflichten in frommer Gesinnung erfüllen, heiligen sie uns. Viele von uns opfern sich zu jeder Tageszeit und oft auch nachts im Dienst der Nächstenliebe. Die Gläubigen jeden Alters erwarten bei den verschiedensten Gelegenheiten unsern Dienst. Muss uns diese Hochherzigkeit nicht Gott näher bringen?
Zur unermüdlichen Hilfsbereitschaft soll sich noch eine andere Tugend gesellen: die Geduld. Sie allein «vollendet das Werk», wie der hl. Jakobus sagt, «Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen» (1,4). Diese Haltung ist uns im Verkehr mit den Seelen ganz besonders notwendig. Sie trägt viel dazu bei, unserm Leben übernatürliche Prägung zu geben. Hier tritt uns Gleichgültigkeit und Unzugänglichkeit, dort Feindschaft und Hass entgegen. Dennoch dürfen wir uns durch nichts von der Sanftmut Christi abbringen lassen. In unserer unmittelbaren Umgebung werden zuweilen Ansichten vertreten, die den unsern entgegengesetzt sind; Verständnislosigkeit schmerzt uns. Wie oft werden unsere guten Absichten durchkreuzt, unsere Bemühungen vereitelt. Sollen wir deshalb den Mut verlieren? Gewiss nicht. Suchen wir vielmehr in der Geduld des Erlösers die Kraft, unsere Geduld zu bewahren. Die Tugenden erstarken, wenn wir treu die kleinen und großen Gelegenheiten benützen, sie zu üben. Zu Gott gelangt man weder durch fruchtlose Klagen über die Vergangenheit noch durch schöne Pläne für die Zukunft, sondern durch die Erfüllung der Pflicht, die jede Stunde mit sich bringt.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es uns sehr nützlich, uns eine «Lebensregel» aufzustellen und uns daran zu halten, wenn auch ohne Kleinlichkeit und Ängstlichkeit.
Eine kluge Tageseinteilung hat verschiedene Vorteile: Zeitgewinn, Erfüllung unserer Pflichten im Geist des Gehorsams gegen den Willen Gottes; das ist die Hauptsache; und schließlich bildet diese Regelung ein sehr wirksames Mittel gegen unsere Neigung zu Nachlässigkeit und Müßiggang. Erwägen wir den letzten Punkt.
Manche Priester sind mit Arbeit überlastet, andere haben genügend freie Zeit. Die Erfahrung lehrt, dass es für jeden Priester notwendig ist, stets eine ernste Beschäftigung zu haben, der er sich im Wissen um seine Verantwortung widmet. Denn der schlimmste Feind des Priesters ist der Müßiggang. «Denn einem Müßigen fällt viel Schlechtigkeit ein» (Sir 33, 29).
Ein wirklich träger Priester hat keinerlei Ordnung in seinem Tageslauf. Er ist unfähig, seinen Geist mit einem Gegenstand zu beschäftigen, der der Aufmerksamkeit wert ist, und verliert seine Zeit. Oft ist er im Rückstand mit dem Breviergebet. Kann er in diesem Zustand nicht leicht eine Beute des bösen Feindes werden? In einer Predigt, die dem hl. Augustinus zugeschrieben wird, heißt es : «Nicht während der Arbeit erlagen Samson, David und Salarnon den Lockungen der Sinne, sondern in den Stunden des Müßiggangs. Halten wir uns weder für heiliger noch für stärker und weiser als sie» (Sermo 17, in Append. S. Augustini. P. L. 40, Sp. 1264).
Arbeitsgeist spielt eine große Rolle bei der Heiligung des Priesters. Ohne ihn bleiben die besten Eigenschaften, die reichsten Talente unfruchtbar. Der Nutzen des Nächsten und die Würde seines Standes fordern von jedem Diener Christi ein ständiges Bemühen, die Zeit gut zu nützen.
Das Gesetz der Arbeit gilt allgemein. Das Wort, das Gott an Adam richtete, betrifft uns alle: «Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen» (Gen 3, 19).
Jesus, der neue Adam, unser Vorbild, wollte alle Mühsale unseres Lebens kennenlernen, ausgenommen die Sünde: «einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat» (Hebr 4,15). Die harte Notwendigkeit zu arbeiten lastete auf ihm ebenso wie auf uns. Und er unterwarf sich in Liebe dieser Forderung des Vaters. Galt er nicht als Sohn eines Arbeiters? «Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns?» (Mt 13,55).
Arbeiten wir gern, wie Jesus, Maria und Joseph in Nazareth arbeiteten. Und wenn die Umstände es erfordern, scheuen wir uns nicht, neben der ausgesprochen priesterlichen Tätigkeit unscheinbare manuelle Arbeiten zu verrichten. Erinneren wir uns auch an das Beispiel des hl. Paulus: «Ihr wisst, dass diese meine Hände mir und meinen Begleitern den Lebensunterhalt verschafft haben», sagte er zu den Ephesern (Apg 20, 34). Und an die Thessalonicher schreibt er: «Um keinem von euch zur Last zu fallen, haben wir Tag und Nacht hart und schwer gearbeitet» (2 Thess 3, 8). Wie viele Heilige, vom Apostel angefangen bis in unsere Tage, haben sich durch die gewöhnlichsten körperlichen Arbeiten geheiligt!
In gewissen Kreisen herrscht die Auffassung, dass nur der wirklich arbeitet, der Spaten und Kelle handhabt. Der Architekt, der Pläne entwirft, der Unternehmer, der sich um die Leitung einer Fabrik und den Warenabsatz kümmert, sind in ihren Augen nichts als Faulenzer. Heutzutage denken viele das gleiche, wenn es sich um geistige Arbeit auf religiösem Gebiet handelt. Sie sind sicher im Irrtum. Wir wissen aus Erfahrung, dass die geistige Arbeit und die Obliegenheiten der Seelsorge oft mühevoller und erschöpfender sind als körperliche Arbeit.
Unter den geistigen Arbeiten soll der Priester vor allem das Studium der Theologie und der Heiligen Schrift hochschätzen: «Nostrae divitiae sint, in lege Domini meditari, die ac nocte», schreibt der hl. Hieronymus. Und ferner: «Ama scientiam scripturarum, et carnis vitia non amabis» (Epistolae 30 und 125. P. L. 22, Sp.442 und 1078).
Dafür Sorge tragen, dass uns die im Priesterseminar erworbene Bibelkenntnis und das theologische Wissen erhalten bleiben, ist die gediegenste Vorbereitung auf den Dienst des Wortes. Doch es gereicht nicht nur der Predigt zum Vorteil, wenn der Priester Wissen auf religiösem und auch auf profanem Gebiet erwirbt; er gewinnt dadurch ein höheres geistiges Niveau und größeren Einfluss auf die Seelen.
Es wird uns leichter, die Tugenden zu üben, wenn wir uns nach der Arbeit eine gewisse Entspannung gönnen; auch im Leben des Priesters muss für Erholung gesorgt sein. Vernünftig ausgewählt, trägt auch sie zu unserer Heiligung bei. Es gibt allerdings Arten von Erholung, die wohl dem Weltchristen gestattet sind, sich aber nicht mit unsern priesterlichen Obliegenheiten vertragen.
Pflegen wir häufig brüderlichen und freundschaftlichen Verkehr mit unseren Confratres: «Frater qui adiuvatur a fratre quasi civitas firma» (Spr 28, 19). Wenn Stunden kommen, in denen wir unter der Einsamkeit leiden, scheuen wir uns nicht, einen Mitbruder aufzusuchen, dem wir uns ganz mitteilen können. Hat nicht Jesus selbst am Ölberg den Jüngern seine Todesangst anvertraut? Es tut sehr wohl, wenn wir unser Herz einem treuen Freunde erschließen; manchmal ist eine solche Aussprache geradezu unerlässlich. Doch machen wir uns nicht allzu abhängig von menschlichem Trost; suchen wir Kraft und Freude vor allem bei Gott.
3. «In der Liebe festgewurzelt»
In der gegenwärtigen Ordnung der Vorsehung hat der Mensch nur ein letztes Ziel: den Himmel mit der beseligenden Anschauung Gottes. Daher ist es von höchster Wichtigkeit, dass er alle Willensakte seines Lebens auf dieses Ziel hinordnet.
Nur wenn wir Gott als unser höchstes Gut lieben, tun wir alle unsere Handlungen für ihn. Diese Ausrichtung auf Gott gibt ihnen übernatürlichen Wert. Daher sagte der hl. Paulus: «Wenn ich allen Glauben hätte, so dass ich Berge versetzte ... und wenn ich alle meine Habe den Armen austeilte, und wenn ich meinen Leib den Flammen preisgäbe, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts» (1 Kor 13, 2-3). Der hl. Franz von Sales drückt dieselbe Wahrheit in der ihm eigenen Sprache aus: «Ein Rüffel, den man mit zwei Unzen Liebe erträgt, ist mehr wert als das Martyrium, mit einer Unze Liebe ertragen.» (Hamon, Vie II, S. 360. Siehe auch das IV. Kapitel, «Das größte Gebot»).
Es genügt nicht, dass der Mensch dem Herrn dient und seine Pflicht erfüllt aus rein menschlichem Gefühl für Schicklichkeit oder aus natürlicher Gewissenhaftigkeit. Bei den alltäglichsten Handlungen wie bei den bedeutendsten muss er seinen Blick auf Gott richten und die Absicht haben, seinen Willen zu erfüllen und ihm zu gefallen.
Es ist uns nicht möglich, ständig an Gott zu denken; doch wenn sich unsere Seele von Zeit zu Zeit liebend zu ihm erhebt, dann wird sich das Wort des hl. Johannes in unserm Leben verwirklichen: «Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm» (1 Joh 4, 16).
Wenn das Herz so ganz in der Liebe verwurzelt ist, hat die Art unserer Tätigkeit verhältnismäßig wenig Bedeutung für unsere Heiligung. Wir wollen das näher erklären.
Worin besteht der Unterschied zwischen Heiligen und Unvollkommenen? Liegt er in der Art der Arbeit, die sie verrichten? Sicher nicht. Wir vollziehen während unseres ganzen Lebens die erhabensten Funktionen und am Ende sind wir vielleicht der Heiligkeit noch fern. Einfache Christen hingegen - z. B. Anna Maria Taigi, Matt Talbot, ein Hafenarbeiter in Dublin - die sich den ganzen Tag den unscheinbarsten Beschäftigungen widmeten, sind Heilige geworden. Woher kommt diese Verschiedenheit? Sie liegt in der Liebe. Die Liebe, immer mehr losgelöst von allem, was nicht Gott ist, hat aus diesen - äußerlich betrachtet glanzlosen Leben ein ständiges Loblied, ein ununterbrochenes Gebet gemacht.
Betrachten wir Nazareth: Maria und Joseph oblagen oft den gleichen Beschäftigungen wie andere arme Leute. Dennoch war jede ihrer Handlungen eine unvergleichliche Verherrlichung des dreifaltigen Gottes. Warum? Nicht nur wegen der erhabenen Würde der seligsten Jungfrau und ihres Bräutigams, sondern auch, weil jede ihrer Handlungen in vollkommener Liebe vollbracht wurde.
So ist auch im geistlichen Leben die Liebe von ausschlaggebender Bedeutung.
Doch wir möchten manchmal glauben, wenn uns diese Aufgabe übertragen oder jene Verpflichtung abgenommen würde, wenn wir von der Gegenwart einer lästigen Person befreit wären, dann machten wir schnellere Fortschritte im religiösen Leben.
Das ist eine große Illusion. Diese vermeintlichen Hindernisse sollen uns Stufen zu Gott werden, denn - wie gesagt das Wesen der Heiligkeit hängt weder von unserer Beschäftigung noch von unserer Umgebung ab, sondern von der Liebe, die unser Handeln bestimmt.
Erfahrungsgemäß sind jedoch nur wenige Seelen auf den Wegen der Liebe so fortgeschritten, dass sie sich bei jedem Geschehen ausschließlich von übernatürlicher Liebe leiten lassen. Die meisten bedürfen menschlicher Hilfe. Widersprüche, Schwierigkeiten, Kreuze sind in sich nicht unfehlbare Mittel der Heiligung. Der Jünger Christi soll genügend klarsehend, genügend stark, genügend hochherzig sein, um sie aus der Hand Gottes anzunehmen und in der Prüfung durchzuhalten, ohne sich entmutigen zu lassen.
Ein Seelenführer kann für gewöhnlich von einer gläubigen Seele nicht alles fordern, was für ihren Fortschritt nützlich wäre. Er wird die Vollkommenheit nicht aus dem Auge verlieren, die erreicht werden soll, aber er wird gut daran tun, sich über den Grad der Schwachheit des einzelnen Rechenschaft zu geben und über die Zeit, die zur inneren Entfaltung notwendig ist.
Wir wissen, dass die Liebe von Gott kommt; sie ist das Kennzeichen der Kinder Gottes. Jesus ist uns auch hierin leuchtendes Vorbild: in all seinem menschlichen Tun richtete er den Blick auf den Vater, um aus Liebe in voller Übereinstimmung mit ihm zu handeln: «weil ich immer das tue, was ihm gefällt» (Joh 8, 29).
Auch wir sollen nach dem Rate des hl. Paulus «in der Liebe festgewurzelt und festgegründet sein» (Eph 3, 17). «Alles geschehe bei euch in Liebe» (1 Kor 16, 14). Der heilige Bischof von Genf fordert nachdrücklich, dass unser ganzes Leben von der Gottesliebe beherrscht sei: «Wir sollen kein Gesetz und keine Bindung kennen als die der Liebe» (CEuvres de saint Franyois de Sales, XIII (Bd. III der Lettres), Ed. d'Annecy, p. 184). Um dieses erhabene Ziel zu erreichen, ist es gut, wenn man im Laufe des Tages oft - jedoch ohne den Geist zu ermüden - die Absicht erneuert, alle Handlungen aus Liebe zu vollbringen. Drücken wir diese Meinung in einem Gebet aus. Wir können dazu etwa einen Psalmvers benützen: «Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke» (Ps 17, 1), oder die Anrufung des hl. Augustinus: «Mache, Vater, dass ich Dich suche» (Soliloquia, I, 6. P. L. 32, Sp. 872), oder das Gebet aus der Prim: «Dirigere et sanctificare ...» Jede Seele muss hierin dem Antrieb des Heiligen Geistes folgen. Doch seien wir überzeugt: im geistlichen Leben wird nichts Dauerhaftes ohne Beharrlichkeit erreicht.
Wenn wir uns fragen, welches der letzte Grund für die überragende Bedeutung der Liebe ist, so gibt es darauf nur eine Antwort: Gott ist in seinem innersten Leben Liebe. «Gott ist die Liebe» (1 Joh 4, 8). Der Vater zeugt das Wort und hat sein Wohlgefallen an ihm. Der Sohn betrachtet den Vater und wendet sich ihm liebend zu. Aus ihrer gegenseitigen Liebe geht der Heilige Geist hervor. Je mehr unser Erdenleben dank der Liebe das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit widerstrahlt, desto mehr nähert es sich der Vollkommenheit.
4. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus
In einem Leben, das ganz von der Liebe beherrscht sein soll, wird der Fortschritt nur durch die Vereinigung mit Christus erzielt. So lehrt der hl. Paulus: «Wir sollen ... in Liebe hineinwachsen in ihn, der das Haupt ist» (Eph 4, 15). Und weiter: «Was immer ihr tun mögt in Wort oder Werk, das alles tut im Namen des Herrn Jesus. Durch ihn danket Gott dem Vater» (Kol 3,17).
Bemühen wir uns, diesen Gedankengang des Apostels recht zu erfassen.
Stellen wir uns einen Botschafter vor. Er kann in seinem eigenen Namen handeln, als Privatmann, oder auch in seiner Eigenschaft als Gesandter. In diesem Fall beruft er sich nicht auf seine Verdienste oder seine persönlichen Talente, sondern auf die Autorität des Souveräns, mit dem er durch sein Beglaubigungsschreiben identifiziert wird. Hier handelt es sich um eine äußerliche und vorübergehende Identifizierung.
Ganz anders ist es bei unserer Vereinigung mit Christus. Er hat uns für immer zu seinem Eigentum gemacht. Wir tragen unser Beglaubigungsschreiben in unseren Seelen; es hat Gültigkeit für die Ewigkeit. Es ist die heiligmachende Gnade, das Siegel, das bei Taufe und Priesterweihe unserer Seele eingedrückt wurde. Diese göttlichen Gaben bezeugen in der Tiefe unseres Wesens für immer und unwiderleglich unsere Ähnlichkeit mit Christus.
Die Worte des Apostels: «Was immer ihr tut ...» haben einen tiefen Sinn. Sie enthalten nicht nur den Rat, vor jeder Handlung die Worte auszusprechen: «Im Namen Christi, unseres Herrn», sondern sie besagen, dass wir im Gebet, bei der Arbeit, vor allem in der Seelsorge das Recht haben, in unserer Würde als Glieder Christi und Diener seines Priestertums vor Gott zu treten. Hier liegt das Geheimnis, das uns Zugang zum Vater und unserem Wirken bei den Seelen Fruchtbarkeit sichert.
Jeder Priester besitzt das unschätzbare Vorrecht, «im Namen Christi», unter Berufung auf ihn mit Gott sprechen zu dürfen. Manche denken nicht an diesen Vorzug, weil ihr Glaube nicht stark genug ist. Je mehr man sich auslöscht, wenn man vor Gott tritt, desto tiefer erfasst man das Geheimnis Christi. Denn unser unbegrenztes Vertrauen auf die Verdienste des Erlösers bekundet die Festigkeit unseres Glaubens an seine Gottheit.
Der hl. Johannes schreibt in einem seiner Briefe: «Wenn wir das Zeugnis von Menschen annehmen, so steht doch das Zeugnis Gottes höher. Dies aber ist das Zeugnis Gottes: Er hat von seinem Sohn Zeugnis abgelegt. «Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis Gottes in sich» (1 Joh 5, 9-10). Das heißt, dass der Glaube an die Gottheit Jesu uns an dem persönlichen Wissen des Vaters teilnehmen lässt: er betrachtet das Wort, das er zeugt, von Ewigkeit her als seinen wesensgleichen Sohn, sein Ebenbild. So ist also unser Glaube, dass Christus wahrer Gott ist, ein Echo aus dem Leben des Vaters selbst.
Glauben wir darum ganz fest: der Sohn Gottes gehört uns, wir besitzen ihn als Eigentum mit allen seinen Verdiensten, mit allem, worauf seine göttliche Person ihm Anrecht gibt. Der hl. Paulus steht in Bewunderung vor der Größe dieser Gabe und frohlockt: «Wie sollte er mit ihm nicht alles schenken» (Röm 8, 32). Er findet gar nicht Worte genug, um den «unergründlichen Reichtum Christi» (Eph 3, 8) zu preisen; sieht er uns doch «in ihm an allem reich geworden», so dass es uns «an keiner Gnadengabe mangelt» (1 Kor 1, 5 u. 7).
Ist unser Glaubepsleben nicht herrlich, wenn wir es so auffassen? Bei vielen Christen ist das Vertrauen auf die Person und die Verdienste des Gottmenschen geschwächt; sie denken nicht daran, «im Namen Christi» vor den Vater zu treten, sich auf ihre Eigenschaft als Getaufte, als Gotteskinder zu berufen. Gehen wir trotz unseres Elends und unserer Unwürdigkeit mit einer heiligen Kühnheit zum Herrn.
Wenn wir der Gefahr entgehen wollen, einer naturalistischen Lebensauffassung zu verfallen, dann erinnern wir uns daran, wie Jesus alle Handlungen geheiligt hat, die unser armseliges Erdenleben ausfüllen. - Er hat gleich uns gebetet, gearbeitet; wie wir hat er mit seinen Zeitgenossen gesprochen; er saß mit ihnen zu Tisch. Auf seinen apostolischen Wanderungen wurde er müde: «Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen» (Joh 4, 6). Er schlief im Schiff und die Rufe der Jünger, die durch den Sturm in Gefahr geraten waren, mussten ihn wecken. Die Regungen seines Herzens waren die gleichen wie die unseren: er liebte die Seinen wirklich; Traurigkeit und Bangen erfüllten seine Seele; er litt unter der Undankbarkeit, und vor allem in seiner Passion wurde er mit Leiden ohne Maß überhäuft.
Jesus vollbrachte diese menschlichen Handlungen in unaussprechlicher Liebe zum Vater und zu uns; durch jede von ihnen hat er uns auch die Gnade erworben, ihn nachzuahmen, seine Liebe in uns aufleben zu lassen. Seien wir sicher, es ist der Wunsch des göttlichen Meisters, allen seinen Gliedern, und vornehmlich seinen Priestern, die Kraft zu schenken, seinem Beispiel zu folgen.
Sind wir Priester nicht berufen, sein Wirken gewissermaßen fortzusetzen? Gleich ihm weihen wir unser ganzes Leben der Aufgabe, bei den Menschen für die Rechte Gottes einzutreten und seinen Namen zu verherrlichen. Wenn wir das Joch unserer Standespflichten willig auf uns nehmen, ahmen wir den Gehorsam des Erlösers gegen den Willen des Vaters nach. In unserm Leben der Hingabe, der Geduld, der Keuschheit lebt sein Beispiel fort.
In unsern Arbeiten, unsern Mühsalen und Schwierigkeiten sind wir niemals allein. Jesus leistet uns von außen her Beistand als Vorbild aller Heiligkeit, aber mehr noch stärkt er uns innerlich als unser Lebensquell. Hat er uns nicht «das Wort der Versöhnung übertragen», walten wir nicht «an Christi Statt unseres Amtes»? (2 Kor 5, 20). In unserm priesterlichen Wirken handeln wir «mit der Kraft, die Gott verleiht»(1 Petr 4, 11). Da Christus uns auserwählte, betrachtet er jeden von uns als ein anderes Ich; er freut sich, wenn in uns das Geheimnis der Ähnlichkeit und der Vereinigung mit ihm immer deutlicher erkennbar wird. Wir sollten diese Gedanken oft erwägen; sie sind die Quelle tiefer Freude und nie erlahmenden Eifers.
Lassen wir Jesus im Innersten unseres Herzens leben. Jeden Morgen feiern wir die heiligen Geheimnisse, empfangen wir seinen Leib und sein Blut. So soll auch jede unserer Handlungen ihren Ursprung in diesem göttlichen Mittelpunkt haben.
5. Christus liebte die Kirche …
Nicht als Einzelne sind wir zur Heiligung berufen, sondern in der Einheit des mystischen Leibes Christi.
Als Christen sind wir Glieder dieses Leibes; doch als Priester obliegt es uns darüber hinaus, ihn durch die Gnade der Sakramente und durch den Dienst des Wortes zu beleben. Unsere persönliche Heiligung, die sich im Schoße der Kirche vollzieht, soll der Kirche selbst zum Nutzen gereichen. Im mystischen Leib Christi strahlt die Heiligkeit vom Haupt auf alle Glieder aus, und vom Priester geht sie auf die ihm anvertrauten Gläubigen über. Wenn sich also der Priester heiligt, so gereicht es den Seelen zum Nutzen.
So wird er immer mehr den göttlichen Meister nachahmen, von dem der hl. Paulus sagt: «Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben». Und warum opferte er sich hin bis zum Tod am Kreuze? Damit die Kirche «strahlend rein, ohne Flecken, ohne Runzeln ... heilig und makellos» vor ihm erscheinen könne (Vgl. Eph. 5, 25, 27).
Die Heiligung des Priesters zum Heil der andern setzt bei ihm einen sehr starken Glauben an die Kirche selbst voraus.
Das Fundament unseres ganzen religiösen Lebens ist zweifellos der Glaube an die Gottheit Christi. Doch wenn dieser Glaube vollkommen sein soll, darf er nicht nur der Person des Erlösers gelten, sondern muss sich auch auf die sichtbare Gemeinschaft erstrecken, die er gegründet hat und der er die Bestimmung gab, die Menschen zu ihrem ewigen Glück zu führen. Wie wir an Christus als wahren Gott glauben, so ist auch die göttliche Wirklichkeit der Kirche ein Gegenstand des Glaubens für uns.
Dieser Glaube erinnert uns daran, wie innig und lebensvoll die Verbindung zwischen Christus und der Kirche ist. Der hl. Paulus vergleicht sie mit der, die zwischen Haupt und Gliedern oder zwischen Ehegatten besteht (Eph 5, 30. 32). Die Kirche setzt auf Erden die Aufgabe des Heilandes fort; sie vollendet das Erlösungswerk. Jesus selbst wirkt in ihr weiter. Bevor er in den Himmel aufstieg, hat er in unmissverständlicher Weise verkündet, dass seine Verbindung mit ihr unlösbar ist: «Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt» (Mt 28, 20).
Unser Glaube an den übernatürlichen Charakter der Kirche schließt die Anerkennung ihrer «göttlichen Konstitution» in sich. Hierarchie, Weihegewalt und Jurisdiktionsgewalt, Unfehlbarkeit des Papstes, eucharistisches Opfer, Sakramente - all das hat seinen Ursprung nicht in Menschengedanken oder in zufälligem Geschehen, sondern es ist die in der Zeit vollzogene Verwirklichung eines Planes, den die Ewige Weisheit ersann. Gewiss, bei der organischen Entwicklung der Kirche und der Ausarbeitung der Lehrsätze hat sich der Herr der Mitwirkung von Menschen bedient; er wollte ihre Mitarbeit. Doch er allein ist durch die unaufhörliche Einwirkung seines Geistes, der den mystischen Leib belebt - Spiritum vivificatem - der absolute Herr dieser Entfaltung geblieben.
Wenn wir fest an den göttlichen Ursprung der Kirche glauben, wird es uns leicht zu denken, zu urteilen, zu wollen, zu handeln wie sie selbst denkt, urteilt, will und handelt: «Sentire cum Ecclesia». Das ist der «Dienst des Glaubens» (Phil 2, 17), der «Glaubensgehorsam» (Röm 16,26), den der Apostel so sehr betont.
Gott verlangt diese Unterwerfung von jedem Christen, vor allem jedoch vom Priester. Die Protestanten lehnen bekanntlich diesen Verzicht auf die Freiheit des Geistes, der von den Katholiken verlangt wird, ab. Sie bekennen sich vielmehr zur freien Schriftforschung. Sie gleichen einem Schiffer, der ohne Kompass den Ozean befährt. Es steht ihm frei, sich dorthin zu wenden, wo es ihm gut scheint, und er bewahrt seine volle Selbstbestimmung. Der Katholik hingegen ist wie ein Steuermann, der sich bei seiner Fahrt am Kompass orientiert. Der unfehlbare Kompass, der ihn führt, ist die Autorität der Kirche. Sie überprüft seine Ansichten, leitet sein Denken und Handeln. Dank dieser Richtlinien kann der Jünger Christi kühn vorwärtsstreben; er wird niemals an den Klippen des Irrtums zerschellen.
Der lebendige Glaube drängt zur Tat. Wir Priester dürfen daher keine Anstrengung scheuen, um die Kirche, das Reich Gottes auszubreiten. Weiden wir den Teil der Herde Gottes, der uns anvertraut ist. Die Kirche ist Mutter - «Mater Ecclesia». Sie ist von Gott bestimmt, allen Menschen das übernatürliche Leben zu geben und es in ihnen zur Entfaltung zu bringen. Diese wunderbare Fruchtbarkeit kann sie nur durch das hingebende Wirken der Priester erlangen. Die Wiedergeburt der Seelen und ihre Umgestaltung nach dem Bild Christi vollzieht sich durch den Einsatz des Priesters: durch das Spenden der Sakramente, den Dienst des Wortes, seine Liebestätigkeit. Diese Arbeit gibt ihm das Recht, mit St. Paulus zu seinen Schäflein zu sprechen: «In Christus Jesus habe ich euch gezeugt» (1 Kor 4, 15). Und weiter: «Ich leide Geburtswehen um euch, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat» (Gal 4, 19).
Nichts ermutigt so zur Hingabe seiner selbst wie das Vertrauen auf den Endsieg. Ist die Kirche göttlichen Ursprungs, dann dürfen wir große Zuversicht haben. Christus sagt von seiner Kirche: «Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen» (Mt 16, 18).
Wenn wir uns auf diese göttliche Verheißung stützen, wird stete Siegesgewissheit in uns sein. Heutzutage zweifeln manche an der universellen Erlösungskraft der Braut Christi; die Kirche entspricht ihrer Meinung nach wenig den Forderungen der Gegenwart. Wir Priester dürfen niemals das Vertrauen zur Kirche verlieren: die Frohbotschaft, deren Träger wir in ihrem Namen sind, enthält den Ursprung des Heiles für alle. Sprechen wir mit dem hl. Paulus voll Stolz: «Ich schäme mich des Evangeliums nicht; es ist ja die Gotteskraft zur Rettung für jeden, der glaubt» (Röm 1, 16).
Beim Letzten Abendmahl, nach der Einsetzung des Priestertums, sprach Jesus: «Vater . .. für sie heilige ich mich», das heißt, ich verlasse die Welt, um mich zu opfern und mich ganz mit Dir zu vereinigen, «damit sie in Wahrheit geheiligt seien» (Joh 17, 19).
Diese Worte sprach Jesus vor seinen Aposteln aus, aber er dachte dabei nicht nur an sie, sondern auch an uns, seine künftigen Priester; er dachte an die ganze Kirche. Für alle gab er sich als Schlachtopfer hin, damit jede Seele und die ganze Kirche an seiner Heiligkeit teilhabe.
Zu der erhabenen Aufgabe, die Kirche in Christus zu heiligen, indem wir uns selber heiligen, hat Christus uns auserwählt, uns eingeladen. Antworten wir aus ganzem, liebendem Herzen auf diesen Ruf. Es ist unsere vornehmste Aufgabe, es ist auch das sicherste Mittel, die Gnade Gottes auf unser Wirken herabzuziehen.
XVIII: MARIA UND DER PRIESTER
(Siehe in «Christus das Leben der Seele» das Kapitel; «Die Mutter des menschgewordenen Wortes» ; in «Christus in seinen Geheimnissen» das Kapitel; «Die Jungfrau Maria; die Geheimnisse der Kindheit und des verborgenen Lebens»).
Maria ist die Königin und die Mutter aller Christen; sie ist es besonders für den Priester. Wegen seiner Ähnlichkeit mit ihrem göttlichen Sohn sieht Maria in jedem Priester Jesus. Sie liebt ihn, nicht nur in der gleichen Weise wie alle Glieder des mystischen Leibes, sondern auch wegen des priesterlichen Charakters, der seiner Seele eingeprägt ist, und wegen der heiligen Geheimnisse, die er «in persona Christi» feiert.
Niemand erfasst so tief wie sie die Aufgabe des Priesters in der Kirche. Setzt doch der Priester das Werk ihres Sohnes fort durch den Dienst des Wortes, die Verwaltung der Sakramente und vor allem, weil er die Hinopferung des Gottessohnes unter dem Schleier der heiligen Gestalten ständig vergegenwärtigt. Maria will jedem von uns in allen Lagen Beistand leisten: uns in unserer Schwachheit stützen, unsere Seele zu Gott erheben.
Seien wir überzeugt: es ist uns von größtem Nutzen, wenn wir am Altar und in unserm ganzen Leben oft die mächtige Fürsprache unserer himmlischen Mutter erbitten. Sie kennt die erhabene Würde, die uns verliehen ist, und weiß, wie sehr wir der Gnade Gottes bedürfen.
Da sie vor der Sünde bewahrt blieb, hat sie das menschliche Elend nicht kennengelernt. Dennoch war Maria in gewissem Sinn unter allen Geschöpfen jenes, dem Gott die größte Barmherzigkeit erwies. Die göttliche Güte hat sich ihr nicht zugewendet, um ihr Verzeihung zu gewähren, sondern um sie vor jeder Makel zu bewahren. Zweifeln wir nicht, dass Maria voll Erbarmen auf uns blickt: «Salve Regina, Mater misericordiae.»
Es ist schwer, über Maria zu sprechen, denn alles, was man von ihr sagen kann, bleibt weit zurück hinter dem, was man gern sagen und den andern zeigen möchte. Doch wir wollen kurz die theologischen Grundlagen unserer Marienverehrung überblicken und überlegen, in welcher Weise wir ihr unsere kindliche Huldigung darbringen können.
1. Die Vorherbestimmung Mariens
Das Wort «devotio» bedeutet vor allem Hingabe - völlige oder teilweise - seiner selbst und seiner Tätigkeit an eine Person oder ein Werk. Wir Priester weihen uns selbst und alle unsere Kräfte Gott und der Sache Gottes.
Doch wenn Gott in seiner Güte eines seiner Geschöpfe besonders liebt und mit Ehren überhäuft, dann verpflichtet uns die Ehrfurcht vor der Majestät des Allerhöchsten, seine Haltung nachzuahmen und diesem bevorzugten Geschöpf auch unserseits zu huldigen.
Und ist die heiligste Dreifaltigkeit nicht Maria mit Gnaden zuvorgekommen? Ihre Vorzüge haben sie über alle Geschöpfe erhoben, und jetzt frohlockt sie zur Rechten Jesu als Königin der Engel und der Heiligen.
Um aus der Fülle unseres Glaubens heraus zu erfassen, welche Verehrung Maria zukommt, müssen wir den Ratschluss Gottes betrachten. Daraus erkennen wir: So sehr hat der Vater «die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie dahingab» (Joh 3, 16). Der Sohn Gottes hätte im Mannesalter unter uns erscheinen können. Durch einen einfachen Willensakt hätte er die menschliche Natur anzunehmen vermocht ohne die Mitwirkung einer Mutter. Gewiss, in diesem Fall wäre der Erlöser nicht wirklich «Menschensohn» gewesen, doch hätte Gott seine Verzeihung nicht auch an eine andere Art der Wiedergutmachung knüpfen können? In seiner Weisheit hat Gott einen anderen Weg gewählt: der Erlöser der Menschen sollte wie sie alle von einer Frau geboren werden (Gal 4, 4). Darum hat Gott in den Plan der Menschwerdung die Auserwählung einer Frau einbezogen, die Mutter des Erlösers, Mutter Gottes werden sollte.
Die unvergleichliche Würde Mariens erfasst man nur, wenn man ihre Auserwählung betrachtet. Die Jungfrau lebte in den Gedanken Gottes vor allen andern Geschöpfen. Darum singt die Kirche von ihr: «Der Herr besaß mich von Anbeginn seiner Wege» (Spr. 8, 22). Besteht nicht ein unlösbares Band zwischen ihr und dem menschgewordenen Wort? In den ewigen Plänen hat der gleiche göttliche Wille die Mutterschaft Mariens bestimmt, der das ganze Erlösungswerk beschloss.
Der hl. Beda schreibt über die einzigartige Würde der Gottesmutter: «Christus hat sein Fleisch nicht aus dem Nichts oder anderswoher genommen, sondern von der Jungfrau. Wäre es nicht so gewesen, dann könnte man ihn nicht mit Recht 'Menschensohn' nennen, denn dann hätte er keinen menschlichen Ursprung» (In Luc. 4, 11. P. L. 92, Sp. 480). Nicht ohne Grund sprach der Engel zu Maria: «Du wirst einen Sohn gebären» (Lk 1, 31). Und als Maria Jesus im Tempel wiederfand, sagte sie zu ihm: «Mein Kind, warum hast du uns das getan?» (Lk 2, 48). Sie nennt Jesus ihr Kind. Und Christus selbst schämt sich wegen seiner Geburt «in der Gestalt des sündigen Fleisches» (Röm 8, 3) nicht, die Menschen seine Brüder zu nennen (Hebr 2, 11).
Wie hoch wurde doch Maria erhoben! Das Kind, das sie gebar, ist eine göttliche Person; es ist ihr Schöpfer.
Auch aus dieser Tatsache ersehen wir, wie sehr Gott Maria ehren wollte. Der Engel verkündete ihr, welche Auserwählung ihr zuteil geworden; doch Gott wollte ihr die Würde der Gottesmutterschaft nicht ohne ihre Zustimmung verleihen. Der Herr machte sozusagen die Menschwerdung des Erlösers vom «[[Fiat]» der Jungfrau abhängig. Erst als sie ihr «Fiat» gesprochen hatte, wurde der Sohn Gottes Mensch.
(In seinen theologischen Unterweisungen wies Dom Marmion gern darauf hin, dass die zweifache Geburt Jesu - die göttliche und die menschliche - nicht eine zweifache «Filiation», Sohnschaft, voraussetzt. Die Bezeichnung «Filiation», Sohnschaft, besagt bei den Menschen den Ursprung des ganzen in sich bestehenden Wesens, der Person. Die göttliche Person Jesu existierte schon vor der Menschwerdung. Wenn Maria Jesus ihren Sohn nennt, behauptet sie nicht, der Ursprung seiner Person zu sein, so wie unsere Mütter es für uns sind, sondern nur, dass sie ihn in ihrem Schoß getragen, aus ihrem Fleisch geformt und zur Welt gebracht hat. «Christus dicitur realiter filius virginis matris ex relatione reali maternitatis ad Christum», lehrt der hl. Thomas - S. th. III, q.35, a.5).
So machte der Vater Maria zu einem einzigartig privilegierten Geschöpf. Alles hing in jenem Augenblick von ihr ab; alles verdanken wir ihr.
Der Grund für diese Vorzüge der Jungfrau ist die Gottesmutterschaft. Um dieser Würde willen wurde sie ohne Erbsünde empfangen, vor jeder persönlichen Sünde bewahrt, geheiligt. Ihre Heiligkeit wuchs der aufsteigenden Morgenröte gleich, «velut aurora consurgens (Antiphon vom Fest Maria Himmelfahrt)», von der Kindheit an bis zu dem Tag, da sie in den Himmel aufgenommen und zur Rechten Jesu mit Macht und Herrlichkeit gekrönt wurde.
Wir sehen also, dass die Marienverehrung nicht ein Werk der Übergebühr ist; sie gehört zum Wesen des Christentums. Man würde aufhören, ein echter Jünger Christi zu sein, wenn man seiner Mutter die Huldigung der Ehrfurcht versagte, die durch die Menschwerdung gefordert wird. Diese unvergleichliche Größe anerkennt die Kirche durch einen Kult, der über den andern Heiligen erwiesenen Kult hinausgeht, die Hyperdulie.
Wenn die Clunyazenser Mönche in früheren Zeiten das «Te Deum» sangen, neigten sie sich tief bei den Worten: «Um unseres Heiles willen ... scheutest Du nicht den Schoß der Jungfrau». Wenn wir auch nicht diesen Ritus nachahmen, so hegen wir doch wenigstens in unserm Herzen eine tiefe Verehrung für das selige Geheimnis der Liebe, das Maria in ihrem Schoße trug.
2. Maria, unsere Mutter
So gewichtig diese erste Begründung unserer Marienverehrung auch ist, wir wollen doch noch einen andern Grund erwägen, aus dem wir der seligsten Jungfrau huldigen: sie ist unsere Mutter. Wenn wir ihr kindliche Verehrung erweisen, gleichen wir uns Jesus an, der ebenfalls in ihr seine Mutter liebte und ehrte.
«Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es» (1 Joh 3,1) ; also sind wir auch wirklich Kinder der seligsten Jungfrau. Das ist kein Bild, kein Gleichnis, sondern Glaubenslehre.
Worauf beruht unsere beglückende Gewissheit, Kinder der Himmelskönigin zu sein ?
Vor allem auf dem Dogma, dass wir Glieder des mystischen Leibes Christi sind. Ist eine Frau nicht von dem Augenblick an Mutter, da sie für andere zum Ursprung des Lebens wurde, ihnen ihr eigenes Leben mitteilte? Woher kommt in der übernatürlichen Ordnung das göttliche Leben, das nicht mit dem Tode endet wie unser leibliches Leben, sondern das bestimmt ist, sich in der Ewigkeit herrlich zu entfalten? Eva hat uns das natürliche Leben gegeben und die Sünde vererbt; doch das Leben der Gnade ist uns durch Maria vermittelt worden. Maria ist die neue Eva, die zur Gefährtin des neuen Adam bestimmt war und an der Erlösung mitwirken durfte. Bei der Verkündigung hat Gott, wie wir schon sahen, das Kommen seines Sohnes gleichsam von ihrer Zustimmung abhängig gemacht. Sie nahm die Mutterschaft an und sprach ihr Ja zu der ganzen Fülle der göttlichen Absichten. Nach Gottes Plan aber sollte sie nicht nur die Mutter Christi sein, sondern auch die aller seiner Glieder.
Deshalb jubelt die Liturgie: «Volk der Erlösten, preise die Jungfrau, die dir das Leben gebracht».
Der hl. Augustinus spricht denselben Gedanken aus: «Maria ist die Mutter Christi im natürlichen Sinn des Wortes; sie wurde geistigerweise die Mutter aller Glieder des Leibes ihres Sohnes». Und warum? «Weil sie in ihrer Liebe mitgewirkt hat (mit ihrem Sohn) an der Geburt der Gläubigen, seiner Glieder, in der Kirche» (De saneta virginitate, VI. P. L. 40, Sp. 399).
Doch erst unter dem Kreuze wurde Maria unter tausend Schmerzen voll und ganz zur Mutter des Menschengeschlechtes geweiht. War sie in jenem Augenblick nicht auf dem Höhepunkt ihres Erdenlebens angelangt? Hat sie damals nicht das «Fiat», das sie bei der Menschwerdung gesprochen, ganz wahrgemacht und die Aufgabe erfüllt, die ihr von der höchsten Weisheit zugedacht war? Sie war der Hinopferung ihres Sohnes zugesellt und in Liebe völlig eins mit ihm; darum hatte sie auch kein anderes Wollen als er: die Unterwerfung unter den Vater - und keine andere Absicht als die, zu leiden und die ewigen Ratschlüsse zu erfüllen. Durch dieses geistige Einssein und durch die vorbehaltlose Unterwerfung unter den einzigen Mittler wurde Maria zur Miterlöserin. So gebar sie uns für das übernatürliche Leben und wurde wahrhaft unsere Mutter.
Jesus selbst wollte uns in das Verständnis dieser großen Wahrheit einführen. Gehen wir im Geiste auf Kalvaria. Am Kreuz spricht der sterbende Erlöser ein Wort, dessen tiefer Sinn in der Kirche erst allmählich voll erfasst wurde. Die letzten Worte, die ein Sohn im Augenblick des Sterbens ausspricht, sind für ein Mutterherz heilig. Maria liebte Jesus mehr, als je ein anderes Geschöpf es vermochte. Als Mutter, und noch dazu als eine Mutter, die die Fülle der Gnaden besaß, liebte sie ihren Sohn mit der ganzen Glut ihres Herzens.
Und welches sind die letzten Worte, die Jesus an seine Mutter richtete? Maria stand ganz nahe beim Kreuz; ihre Blicke hingen am Antlitz ihres Sohnes; sie vernahm jedes seiner Worte: «Vater, verzeihe ihnen» (Lk 23, 34). «Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein» (Lk 23, 43). Dann blickte Jesus auf sie und seinen Lieblingsjünger. Was würde er sagen? Mit brechender Stimme sprach er die Worte: «Frau, siehe da deinen Sohn» (Joh 19,26).
Für Maria bedeuteten die letzten Worte Jesu ein Testament von unvergleichlichem Wert.
Im hl. Johannes können wir alle gläubigen Seelen sehen, deren Mutter Maria werden sollte; doch vergessen wir nicht, er war am Vorabend zum Priester geweiht worden. So dürfen wir sagen: In der erhabensten Stunde, im Augenblick seines Todes hat Jesus zu uns Priestern gesprochen; in der Person des Lieblingsjüngers, hat er uns seiner Mutter anvertraut.
Wenn wir bereit sind, Kinder Mariens zu sein, entsprechen wir voll und ganz den liebevollen Plänen des Herrn. Hat der Vater uns nicht vorherbestimmt, dem Bild seine Sohnes gleichförmig zu werden? « hat er auch im voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben» (Röm 8, 29).
Dieses Wort gilt jedem Christen, doch vornehmlich den Priestern. Da der Priester das Weihesakrament empfangen hat, soll seine Vollkommenheit vollendeter als die der übrigen Gläubigen das Bild Christi widerspiegeln.
Christus ist seinem Wesen nach Sohn Gottes und Sohn Mariens. Wäre er nicht wirklich das dem Vater wesensgleiche Wort, so wäre er nicht Gott; und wäre er nicht aus dem Schoß Mariens hervorgegangen, «consubstantialis matri», wie der hl. Beda sagt (A.a.O.), so wäre er nicht der Mittler, der im Namen seiner Brüder Genugtuung leistet für ihre Sünden und ihnen alle Gnaden erwirbt. Um Christus ganz nachzuahmen, müssen wir gleich ihm Kinder Gottes sein - allerdings Adoptivkinder - und Kinder Mariens. Jesus will ohne Vorbehalt alles mit uns teilen, was er an Kostbarem besitzt, alles, was er ist.
Da wir in der Taufe, und mehr noch durch die Priesterweihe, Christus ähnlich geworden sind, erweisen wir uns dieser Gnade würdig, indem wir der seligsten Jungfrau Ehrfurcht, Vertrauen und Ergebenheit bezeugen. Bemühen wir uns, in der Gesinnung des Sohnes zu ihr zu stehen. Die Haltung Jesu seiner Mutter gegenüber ist unser bestes Vorbild.
Wie beglückend ist doch das Wissen, dass durch die Verehrung Mariens, durch die Liebe zu Maria unsere Verähnlichung mit dem Erlöser allmählich vollendet wird!
3. Ausspenderin der Gnaden
Die Vollmacht Mariens, Gnaden zu vermitteln, ist ein weiterer Grund für die Verehrung, die wir ihr entgegenbringen.
Ohne Zweifel gibt es, wie St. Paulus lehrt, «nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen: den Menschen Christus Jesus» (1 Tim 2, 5). Das ist die gottgewollte Ordnung.
Doch der Herr wollte zu unserm Heile noch eine andere Vermittlung zulassen, die uns - in völliger Unterordnung unter Christus, seine Verdienste und sein Wirken in den Seelen - den Zugang zum Übernatürlichen erleichtern sollte. Daher das Mittleramt der sichtbaren Kirche; daher das Vorrecht der Gottesmutter, Mittlerin zu sein; daher auch die Bedeutung, die der Fürbitte der Heiligen zukommt.
Maria war die Königin der Martyrer; sie teilte mehr als irgend jemand die Leiden und Demütigungen Jesu. Deshalb kann man - unter Wahrung des richtigen Verhältnisses - das Wort auf sie anwenden, das der hl. Paulus von Jesus sagt: «Gott hat sie erhöht, «exaltavit illam», und ihr einen Namen gegeben, der über alle Namen ist» (Phil 2, 9). Er hat sie mehr verherrlicht als die Engel und Heiligen, er hat sie zur Königin des Himmels und zur Ausspenderin der Gnadenschätze gemacht.
Nach der Ansicht vieler Theologen ist sie die Vermittlerin aller Gnaden. Gott wollte den Menschen seinen Sohn nur durch sie geben; so will er auch, dass ihnen alle Gnaden durch Maria zukommen. Bossuet schreibt darüber: «Gott wollte uns einmal Jesus durch die heilige Jungfrau geben; und die Gaben Gottes sind unwiderruflich; diese Ordnung wird nicht mehr geändert. Es ist wahr und bleibt immer wahr, dass wir den Ursprung aller Gnaden durch die Liebe Mariens empfingen; und sie vermittelt uns noch immer jene Gnaden, deren wir in den vielfältigen Lagen unserer christlichen Existenz bedürfen ...» (CEuvres oratoires, Ed. LEBARQ, V, S. 609).
Es ist also dem Herrn wohlgefällig, wenn wir seine Mutter als Vermittlerin seiner Verzeihung und seiner Gaben anrufen. Sie ist unsere Fürsprecherin bei seiner Barmherzigkeit. Mit ihren Gebeten und ihren Verdiensten tritt sie unaufhörlich für uns ein, so dass die christliche Frömmigkeit sie seit Jahrhunderten die «fürbittende Allmacht» nennt.
Wenn wir vor Maria knien, können wir sprechen: «Ich bin Priester ... Wende deine barmherzigen Augen mir zu.» Unsere Liebe Frau sieht in uns nicht nur ein Glied des mystischen Leibes ihres Sohnes, sondern einen Gesandten Jesu, der an seinem Priestertum Anteil hat. Sie muss in uns ihren göttlichen Sohn sehen und kann uns darum nicht zurückweisen: das hieße ja, Jesus selbst zurückweisen. So darf der Priester mehr noch als der einfache Gläubige zuversichtlich sprechen: «Es ist niemals gehört worden, dass jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm und dich um deinen Beistand anflehte, von dir sei verlassen worden» («Memorare»).
Wird uns die Größe unseres Elends bewusst, dann erinnern wir uns auch der Worte des hl. Bernhard: «Wenn Versuchungen deine Seele bestürmen, rufe Maria an ... Wenn deine Sünden dich bedrücken und du vor dem Gericht zitterst, wenn du in einen Abgrund der Traurigkeit oder der Mutlosigkeit zu versinken drohst, denke an Maria, 'Mariam cogita'. ) (Homelie 2 «Super Missus est». P. L. 183, Sp. 70).
Die Gottesmutter weiß, dass sie selbst alles der Gnade verdankt. Die höchste Güte hat ihr alle die Vorzüge verliehen, die zu ihrer erhabenen Auserwählung gehören. Die heiligste Dreifaltigkeit wählte sie zur Mutter des menschgewordenen Wortes. Ihre unbefleckte Empfängnis gleicht einem Diadem, das bei ihrem Eintritt in diese Welt für sie bereitet war. Sie verdankt es der göttlichen Heilsordnung, dem Leiden und Sterben ihres Sohnes. «Ex morte Filii sui praevisa», wie es im Kirchengebet vom 8. Dezember heißt. Wenn die seligste Jungfrau von der Sünde unberührt blieb, wenn die trüben Fluten, denen keiner von uns entgeht, sie nicht erreichten, so ist dies einer ganz unverdienten Fügung der göttlichen Barmherzigkeit zuzuschreiben.
Maria wusste, dass sie Gegenstand unendlicher Liebe Gottes war: «Gebenedeit unter den Frauen», und sie dankte dem Herrn unaufhörlich dafür, dass er «herabgeschaut auf seine geringe Magd» und «Großes an ihr getan» (vgl. Lk. 1, 48-49).
Deshalb weiß unsere Mutter, wie schwach wir armen Sünder von Natur aus sind und dass wir die Hilfe der Gnade brauchen. Ohne diese Hilfe vermöchte sich unsere Seele, die in so häufigem Kontakt mit der Welt steht, nicht in jener übernatürlichen Atmosphäre zu halten, die für den Priester Christi unerlässlich ist.
Haben wir daher ein grenzenloses, kindliches Vertrauen auf die Mittlerschaft der seligsten Jungfrau. Stellen wir unser Beten und unsere guten Werke unter ihre Obhut. Wenn wir als Seelsorger verhärtete Seelen treffen, die von Hochmut oder von Verzweiflung erfüllt sind, Seelen, denen man scheinbar gar nicht helfen kann, dann vertrauen wir sie Maria an.
4. Unsere Marienverehrung
Im allgemeinen kann man sagen, dass die Marienverehrung des Priesters darin besteht, Maria in der Gesinnung zu begegnen, in der Jesus selbst es tat.
Welches soll der erste Akt sein, durch den wir Maria ehren? Die heiligste Dreifaltigkeit hat Maria frei erwählt, Mutter Christi zu werden. Wir können diese göttliche Wahl gleichsam nachahmen durch unsere eigene Weihe. Frei und ungezwungen soll jeder von uns seine Person und sein Leben Maria weihen. Das ist einer der wichtigsten Akte der Marienverehrung und wir sollen ihn oft erneuern, zum Beispiel nach der Heiligen Messe. Schenken wir uns unserer Mutter und bitten wir sie, über uns als über ihre Kinder zu wachen.
Ehren wir die seligste Jungfrau außerdem durch besondere Frömmigkeitsübungen. Jedoch man soll sich mit solchen Dingen nicht überladen. Sie sind wie Blumen in einem Garten; es genügt, die eine oder die andere davon zu wählen.
Wenn wir zum Beispiel Maria zu Ehren jeden Tag eine liturgische Vorschrift mit großer Sorgfalt beobachten, sollte das Unserer Lieben Frau nicht Freude bereiten? Im «Communicantes - In heiliger Gemeinschaft» der Heiligen Messe ist bei der Nennung ihres Namens eine Neigung des Kopfes vorgeschrieben; vollziehen wir diese Geste in Ehrfurcht und Liebe. Beim Breviergebet kommt öfters das «Vater unser» und das «Ave Maria» vor; beten wir es andächtig. Am Schluss jeder Hore gibt uns die marianische Antiphon eine herrliche Gelegenheit, Maria zu ehren.
Wenn die Liturgie ein Marienfest feiert, opfern wir das Breviergebet und die Heilige Messe ausdrücklich zur Ehre der Gottesmutter auf. Danken wir dem Herrn, dass er «Großes an ihr getan» (Lk 1, 49). Die Vollkommenheit Gottes zu bewundern, sich daran zu freuen und sie zu preisen, ist eine erhabene Form der Gottesliebe. Das gleiche gilt von Maria: wenn wir uns an ihren Privilegien, ihrer Gnadenfülle, der Vollkommenheit all ihres Tuns freuen und Gott dafür danken, so ist das ein Akt der Liebe zu Maria. Und jedes liturgische Fest der seligsten Jungfrau wird zu einem wunderbaren Loblied.
Man trifft zuweilen Menschen, die den Rosenkranz verachten und meinen, er sei ein Gebet für Kinder und alte Frauen. Doch hat Jesus nicht gesagt, dass nur jene in den Himmel eingehen werden, die demütig sind wie die Kinder? (Vgl. Mt. 18,3).
Ein Vergleich wird uns helfen, die Wirksamkeit des Rosenkranzgebetes zu verstehen. Wir kennen die Geschichte Davids, der Goliath besiegte. Wie war es dem jungen Israeliten möglich, den Riesen niederzuringen? Er schleuderte einen Stein nach ihm und traf ihn mitten auf die Stirn. Im Philister können wir das Böse und alle seine Auswirkungen sehen: Irrglauben, Unreinheit, Hochmut. Und die kleinen Steine, die es überwinden können, sind die Ave Maria des Rosenkranzes. Die Wege Gottes sind von den unsern ganz verschieden. Wenn wir Großes erreichen wollen, glauben wir uns machtvoller Mittel bedienen zu müssen. Gott urteilt nicht so. Er liebt es, die schwächsten Werkzeuge zu wählen: «Infirma mundi elegit ut confundat fortia - Die Schwachen der Welt hat Gott erwählt, damit die Starken beschämt werden» (1 Kor 1, 27).
Warum ist das Rosenkranzgebet so wirksam? Vor allem wegen der Erhabenheit der Gebete, aus denen es zusammengesetzt ist. Das Vaterunser ist uns vom ewigen Vater, der ganz Liebe und Heiligkeit ist, geschenkt worden; er hat es uns durch seinen Sohn gelehrt. Das Ave Maria ist der Gruß, den der Engel Gabriel vom Himmel brachte. Und die Kirche, die die Nöte ihrer Kinder kennt, fügt an diese beiden Gebete eine Bitte an: hundertfünfzig Mal sollen wir Maria anflehen, sie möge bei uns sein, «jetzt und in der Stunde unseres Todes». Auch der Priester hat nichts Wichtigeres zu erbitten.
Das Rosenkranzgebet leitet uns überdies zur Vergegenwärtigung der Phasen unserer Erlösung an. Von allen Ereignissen des Lebens Christi geht gleichsam eine göttliche Kraft aus, die in uns wirksam wird, wenn wir die Szenen des Evangelium betrachten. Im Rosenkranzgebet erweisen wir dem Erlöser durch Maria eine Huldigung liebenden Gedenkens an seine Kindheit, sein Leiden und seine Verherrlichung. Durch diese Begegnung mit ihm im Glauben wird uns vielfältige göttliche Hilfe zuteil.
Überdies ist uns das so schlichte und doch so hochherzige Verhalten Mariens ein Beispiel; wir finden in ihm Motive für unsere Hoffnung, unsere Liebe, unsere Freude.
Denken wir zum Beispiel an das erste Geheimnis: die Verkündigung. Wie beglückend ist es doch, das Zwiegespräch der Jungfrau mit dem Engel zu betrachten. Wie er grüßen wir Maria, die Gnadenvolle, die Gesegnete unter den Frauen. Der hl. Johannes sagt von der Menschwerdung, das Wort «hat unter uns gewohnt». Doch hier können wir sprechen: «Das Wort wohnt in Maria». Der Logos lebt in ihr als Sohn, den sie vom Heiligen Geist in ihrem jungfräulichen Schoß empfangen hat.
Beim Geheimnis der Heimsuchung Elisabeths erkennen wir Mariens Güte. Elisabeth sollte noch im vorgeschrittenen Alter einen Sohn gebären; so bedurfte sie sicher des Beistandes ihrer Base. Maria «ging eilends in das Gebirge» (Lk 1, 39). Sie hatte kaum Elisabeths Heim betreten, da wurde die Greisin vom Heiligen Geist erfüllt und rief: «Du bist gebenedeit unter den Frauen.» Und sie fügte hinzu: «Selig, die du geglaubt hast.» Warum? «Du hast an den Worten des Engels nicht gezweifelt, wie mein Gatte es tat; und so empfingst du die wunderbare Botschaft Gabriels.»
Nun sang die Jungfrau dem Herrn ein Danklied : «Er hat herabgeschaut auf seine geringe Magd ... Großes hat er an mir getan ...» Die Worte des Magnifikat sind der Bibel entnommen, doch Maria eignete sie sich an, um ihrer grenzenlosen Dankbarkeit und Freude Ausdruck zu geben. Die herrlichen Verse enthüllen uns ihr Innenleben: ihre Demut, ihre Bewunderung der Ratschlüsse Gottes, ihre Liebe. Der Geist Jesu wohnte in ihr, und diese Worte waren von ihm eingegeben.
Die Kirche will in ihrer Weisheit, dass wir dieses Loblied alle Tage bei der Vesper singen. Sie lehrt uns, den Herrn in Vereinigung mit seiner Mutter zu preisen.
In ähnlicher Weise können wir auch die andern Ereignisse betrachten, die der Rosenkranz uns vor Augen stellt. Wie leicht würde uns doch das Beten, wenn Geist und Herz von der Erinnerung an diese Geheimnisse erfüllt wären.
Viele klagen über innere Leere bei der täglichen Betrachtung. Das ist nicht erstaunlich, wenn die Seele nicht aus heiligen Gedanken ihre Nahrung zieht.
Wenn jemand den Rosenkranz geringschätzt, ist es oft ein Zeichen dafür, dass er sich nie Mühe gegeben hat, ihn andächtig zu beten.
Manche meinen, man könne den Rosenkranz gedankenlos hersagen. Das ist ein Irrtum; beim Gebet müssen wir uns des Sinnes der Worte bewusst sein, die wir aussprechen, oder wenigstens an den denken, dem sie gelten.
Wenn eine Seele den Gehalt des Rosenkranzgebetes erfasst, findet sie viel Freude daran. Der hl. Alphons von Liguori hatte während seiner letzten Krankheit stets den Rosenkranz in der Hand. Er wurde von einem Bruder aus seiner Kongregation gepflegt, mit dem nicht immer leicht auszukommen war. Eines Tages wollte er dem Kranken eine Mahlzeit verabreichen, bevor dieser das letzte Ave Maria eines Rosenkranzgesätzleins beendet hatte. «Einen Augenblick», sagte der Heilige; «ist ein Ave Maria nicht mehr wert als alle Mahlzeiten der Welt?» Ein andermal bemerkte der Bruder: «Aber Monsignore, Sie haben doch schon den Rosenkranz gebetet; sie müssen ihn doch nicht zehnmal von vorn anfangen.» Da antwortete der Heilige: «Wissen Sie denn nicht, dass von dieser Andacht mein Seelenheil abhängt ?» (P. BERTHE, Saint Alphonse de Liguori, II, S. 579).
Haben wir niemals arme alte Frauen kennengelernt, die andächtig den Rosenkranz beteten? Tun auch wir alles, was in unserer Macht steht, um ihn gut zu beten. Machen wir uns ganz klein, werfen wir uns Jesus zu Füßen; es ist gut, sich klein zu fühlen, wenn man sich in der Gegenwart eines so großen Gottes befindet (Die Gedanken Dom Marmions über das Rosenkranzgebet sind in der Broschüre «Les mystères du rosaire» (Editions de Maredsous) zusammengefasst. Über jedes Geheimnis sind Texte aus den Schriften Dom Marmions entnommen worden).
Verehren wir Unsere Liebe Frau außer durch das Rosenkranzgebet auch dadurch, dass wir in kindlicher Liebe oft an sie denken. Denken Kinder nicht gern an das, was ihre Mutter einst für sie tat, und wie sie ihnen auch jetzt noch in schwierigen Lagen hilft? Sprechen wir in der Predigt oft von der Mutter Jesu und unserer Mutter.
Doch über diesen Kult hinaus sollen wir Maria auch im praktischen Leben als ihr Kind gehorchen. Worin sollen wir ihr gehorchen? Befiehlt sie uns denn etwas ?
Die Antwort auf diese wichtige Frage gibt uns das Evangelium. Bei der Hochzeit von Kana wies Maria auf Jesus und sagte zu den Dienern: «Tut alles, was er euch sagen wird» (Joh 2, 5). Richtet sie an uns nicht die gleichen Worte ? Wenn wir der seligsten Jungfrau gefallen wollen, ahmen wir die Diener von Kana nach. Jesus spricht zu ihnen; sie hören zu. Er befiehlt ihnen, die Krüge, die zur Reinigung der Juden bestimmt waren, mit Wasser zu füllen, und sie befolgen den Befehl, obwohl ihnen diese Arbeit nutzlos scheint.
Maria gehorchen, das besagt auch für uns Unterwerfung unter Jesus, Aufmerksamkeit auf seine Worte, sein Beispiel; Ausrichtung unseres Verhaltens nach den Richtlinien derer, die für uns seine Stellvertreter sind. Sie wünscht, dass wir treue Jünger und eifrige Priester Christi seien, und dass wir dem Vater, den Menschen und auch ihr gegenüber von der gleichen Gesinnung beseelt seien wie Jesus. Das ist die beste Verehrung, die wir unserer himmlischen Mutter erweisen können.
Maria wird uns auch helfen, das heilige Opfer in der rechten Weise darzubringen. Obwohl sie nicht zum Priestertum zugelassen werden konnte, nahm sie zu Füßen des Kreuzes in einzigartiger Weise am Opfer ihres Sohnes teil. Durch die große Liebe ihres Herzens vereinigte sie sich mit ihm so innig, dass sie ihren Schmerz, ihr Opfer, ihre Ergebung, ihre Hinopferung von denen Jesu nicht trennen konnte.
Kann man von ihrem «Mit-leiden» auf Kalvaria nicht sagen, was Jesus von seiner eigenen Passion sagte, dass es «ihre Stunde» war ?
Niemand vermag besser als sie uns die Gesinnung einzuflößen, die Jesus im Priester sehen will, wenn dieser die heiligen Geheimnisse feiert. Wenn wir uns nicht in besonderer Weise dazu gedrängt fühlen, versuchen wir nicht, die ganze Messe in fühlbarer Verbindung mit Maria darzubringen. Das ist eine außerordentliche Gnade, die Gott nicht allen seinen Priestern gewährt. Doch stellen wir uns unter den Schutz unserer himmlischen Mutter, bevor wir an den Altar treten.
Wir können zu diesem Zweck das Gebet sprechen, das Leo XIII. approbiert hat: «Mutter der Güte und des Erbarmens ... wie du deinem geliebten Sohn zur Seite standest, als er am Kreuze hing, so würdige dich gütigst, auch mir armem Sünder und allen Priestern beizustehen, die heute hier und in der ganzen Kirche das heilige Opfer feiern, damit sie mit deiner Hilfe der heiligen und unteilbaren Trinität eine würdige, willkommene Gabe darbringen.»
Eines möchten wir zum Abschluss noch betonen. Bevor Jesus starb, vertraute er seine Mutter dem hl. Johannes an. In diesem feierlichen Augenblick machte er seinem Jünger das kostbarste Vermächtnis. - Und wie verhielt sich der Apostel, der Priester, dem Jesus seine Mutter übergab? Als Sohn «nahm er sie zu sich» (Joh 19, 27).
Nehmen auch wir Maria zu uns» wie ein liebender Sohn seine Mutter aufnimmt; lassen wir sie bei uns wohnen, lassen wir sie an unseren Arbeiten, unsern Leiden und Freuden teilnehmen.
Niemand wünscht mehr als sie, uns zu helfen, heilige Priester zu werden und das Bild Jesu widerzustrahlen.
XIX: VERKLÄRUNG
Das geistliche Leben des Priesters hat sein Fundament in Jesus Christus, richtet sich an ihm aus und findet in ihm seine Erfüllung.
Es ist Gnade, ein Werk der Verklärung. Diese Worte drücken einen Gedanken aus, der alles zusammenfasst, was wir im Vorhergehenden ausführten.
Der hl. Paulus sagt, nach den Plänen der göttlichen Vorsehung bestehe die Heiligkeit für jeden Menschen darin, «dem Bild des Gottessohnes gleichförmig zu werden» (Röm 8, 29).
In der Taufe wird durch die Eingießung der heiligmachenden Gnade unsere Gleichförmigkeit mit Christus angebahnt. Diese Ähnlichkeit soll von Tag zu Tag vollkommener werden. Wenn sich das übernatürliche Leben im Gotteskind entfalten soll, verlangt es sozusagen seiner Natur nach eine zweifache Verklärung: die Verklärung Christi, der sich der Seele immer mehr als Ursprung der Heiligkeit zu erkennen gibt, und die Verklärung der Seele, die sich durch ihre Treue gegen die Gnade allmählich in ein lebendes Abbild des göttlichen Meisters verwandeln möchte.
Das gilt vom einfachen Christen, vor allem aber von uns Priestern.
Eine Stelle in der Heiligen Schrift erhellt diese Lehre. Die Evangelisten wissen uns zahllose Wunder aus dem öffentlichen Leben Jesu zu erzählen; ihre Berichte wiederholen sich, ähneln einander. Doch eine Episode ist ganz einzigartig: die Verklärung Christi. Im Leben des Erlösers gibt es kein ähnliches Geschehen.
Wir kennen den Hergang. Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit sich auf einen hohen Berg, um dort zu beten. Auf dem Gipfel angelangt, verändert sich sein Aussehen, «während er betet» : er wird verklärt, sein Antlitz leuchtet wie die Sonne, seine Kleider werden weiß wie Schnee. In diesem Glanz sehen die Jünger Moses und Elias, die mit ihrem Meister sprechen. Unbeschreibliche Freude erfüllt ihre Seelen. «Herr, hier ist gut sein», ruft Petrus, ganz außer sich. Da «überschattete sie eine lichte Wolke, und eine Stimme erscholl aus der Wolke: 'Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören'» (Mt 17,5).
Die für die Jünger gänzlich unerwartete und geheimnisvolle Verklärung Jesu wurde für sie ohne Zweifel zur Quelle einer besondern Gnade: sie festigte ihren Glauben an die Gottheit Jesu. Von da an wussten sie mit Bestimmtheit, dass unter dem «Äußern eines Menschen», mit dem sie täglich verkehrten - «Sein Leben war das eines Menschen» (Phil 2, 7) der wahre Sohn Gottes seine Hoheit verbarg. Dieser Glaube wurde zu Pfingsten durch die Herabkunft des Heiligen Geistes gestärkt.
Doch das Wort des Vaters, das sie aus der Wolke vernommen hatten, galt nicht nur den Jüngern allein. Es war für alle kommenden Generationen der Christenheit gesprochen. Der hl. Leo sagt: «Die drei Jünger vertraten die ganze Kirche, die aufmerkt, um das Zeugnis des Vaters entgegenzunehmen» (Sermo 51, 8. p, L. 54, Sp, 313).
Als Petrus später der oberste Hirt der Kirche geworden war, erinnert er die ersten Christen an die Herrlichkeit, die er auf dem heiligen Berg schauen durfte (2 Petr 1, 18).
Deshalb erinnert die Liturgie mehrmals an diese Episode. Sie tut es besonders am Quatembersamstag in der Fastenzeit, an dem die Priesterweihe erteilt zu werden pflegt (An eben diesem Tag, Samstag, den 12. März 1881, wurde Dom Marmion in der Basilika St. Johannes im Lateran in Rom zum Subdiakon geweiht. Das erste Brevier, das er betete, war das von der Verklärung Christi. Er betrachtete das offenbar als Gnade. Seine Exerzitienpredigten schloss er oft mit der Darlegung dieses Geheimnisses ab. Es schien uns, dass der tiefe Sinn dieser Ausführungen klarer erkennbar wird, wenn wir sie an das Ende des Buches setzen; so werden sie die Lehre Dom Marmions über die Heiligung des Priesters durch Christus und in Christus zusammenfassen und gleichsam krönen. Auch in dem Buch «Christus in seinen Geheimnissen» widmet er dieser Episode des Evangeliums ein Kapitel). Und sie wiederholt es am folgenden Tag, dem zweiten Fastensonntag. Überdies feiert sie am 6. August ein eigenes Fest zur Erinnerung an dieses Geschehen.
Was beabsichtigt die Kirche damit? Ohne Zweifel will sie ihre Kinder, und vornehmlich die Priester, auf die Erhabenheit und das letzte Ziel ihrer Berufung hinweisen.
Christus ist stets bereit, sich jedem von uns in seiner Verklärung zu zeigen, und die Stimme des Vaters verkündet noch immer durch das Lehramt der Kirche die Gottessohnschaft Jesu. Gewiss, Christus ändert sich nicht, er bleibt immer derselbe: «Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit» (Hebr 13, 8). Er zeigt sich uns immer als jener, der «uns von Gott her zur Weisheit, zur Rechtfertigung, Heiligung und Erlösung geworden» ist (1 Kor 1,30).
Doch wir selbst erfassen nur ganz allmählich die Göttlichkeit seiner Person, den unvergleichlichen Wert der Erlösung, die Unermesslichkeit seiner Verdienste, die Größe der Liebe, die sich in seinem Kommen zu den Menschen offenbart.
- So sind wir eingeweiht in die «alles überragende Erkenntnis Christi Jesu» (Phil 3, 8), von der der Apostel spricht. Doch diese Erkenntnis ist keine bloß verstandesmäßige; sie besteht vielmehr in einer inneren Glaubenserleuchtung.
In dem Christen, dem diese innere Offenbarung zuteil wird, erwacht der Wunsch, sein Leben immer mehr dem Leben Christi gleichförmig zu gestalten.
Dieser Wunsch soll im Herzen des Priesters besonders stark und lebendig sein. Wollte sich uns der Erlöser nicht in reicherem Maße offenbaren, als er uns durch eine bevorzugende Berufung an sich zog wie Petrus, Jakobus und Johannes? Lädt er uns nicht darum ein, täglich an den Altar zu treten, damit wir immer tiefer in sein unaussprechliches Geheimnis eindringen ?
Der hl. Paulus pries die Verklärung, die sich schon auf Erden an den Dienern Christi vollzieht. Er weist die Korinther darauf hin, wie sehr das Angesicht des Moses strahlte, als er nach seiner Zwiesprache mit Jahwe vom Sinai herabstieg. Moses trug die steinernen Tafeln, auf die das Gesetz eingemeißelt war; doch als er dem Volke verkündete, dass der Herr einen Bund mit Israel geschlossen, musste er sein Antlitz verhüllen, weil die Juden den Glanz nicht ertrugen, der darauf lag. «Wenn schon der Dienst der Verdammung glänzend war, um wie viel mehr ist da der Dienst der Rechtfertigung glanzerfüllt.» Und er fügt hinzu: «Ja, der dort vorhandene Glanz verblasst ganz vor diesem überwältigenden Glanz» (2 Kor 3, 9-10).
Worin besteht dieser «überwältigende Glanz», den St. Paulus dem Priestertum zuschreibt? Nur darin, dass wir «unverhüllten Antlitzes» die Gabe Christi und den Neuen Bund verkünden? Sicher nicht. Die Herrlichkeit des Priestertums besteht vielmehr darin, dass es eine Teilnahme am Priestertum des Gottessohnes ist und dass wir berufen sind, «wie ein Spiegel die Herrlichkeit des Herrn widerzustrahlen, und so von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu dem gleichen Bild umgestaltet» zu werden. «Das ist das Werk des Geistes in uns», «wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn» (2 Kor 3, 18).
Diese Worte des hl. Paulus zeigen klar, dass unsere Umgestaltung in Christus in diesem Leben einem Gesetz des Wachstums unterworfen ist, das sich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes vollzieht.
Zweck unserer Ausführungen war, die Größe dieser Gnade bewusst zu machen und zu treuer Mitwirkung mit ihr zu ermutigen.
Wir versuchten, gestützt auf die Briefe des Völkerapostels die erhabene Größe und die unvergleichlichen Vorrechte des Priestertums Christi aufzuzeigen. Der Sohn Gottes, das menschgewordene Wort, ist als höchster Mittler zu uns gekommen; er ist zugleich Priester und Opfergabe seines eigenen Opfers. Dieses Opfer begann im Augenblick der Menschwerdung, wurde beim Abendmahl in geheimnisvoller Weise vollzogen und endlich am Kreuz in blutiger Weise vollbracht. Vollendet wird es im Himmel, im ewigen Lobpreis.
Christus wollte sein einzigartiges Priestertum und sein einmaliges Opfer durch die Mitwirkung von Menschen, die er zur Teilnahme an seiner Macht beruft, verewigen. Alle priesterliche Gewalt hat ihren Ursprung in der seinen. Von Gott berufen, setzt der Priester in der «spiritualis potestas - geistliche Macht», die ihm durch die Priesterweihe verliehen wird, inmitten der Menschen das Geheimnis und das Werk der erlösenden Menschwerdung fort. Er ist in Wahrheit ein anderer Christus.
Da wir an der Macht Christi teilhaben, ergeht an uns die Forderung, eine Heiligkeit zu erstreben, die einer solchen Erhebung entspricht. Diese Heiligkeit, deren Vorbild und Quelle der Erlöser ist, wird in uns die Züge und die Handlungen des Gottessohnes, des Hohenpriesters, aufleben lassen.
Wir verwirklichen sie durch die Nachahmung der Tugenden Jesu und durch unsere Vereinigung mit ihm innerhalb der Grenzen, die uns in unserer Existenz gezogen sind.
Unter den Tugenden gibt es keine, die für den Priester von so ausschlaggebender Bedeutung ist wie der Glaube.
Gewiss, die Seele Christi erfreute sich der Anschauung Gottes; sie bedurfte nicht des Glaubens. Doch für uns bildet auf dieser Erde der Glaube das Lebenselement.
Wir wiederholen es: diese Wahrheit ist entscheidend für unsere Heiligung und für die Fruchtbarkeit unseres Wirkens. Der Mittelpunkt dieses Glaubens ist die Gottheit Christi: die Göttlichkeit seiner Person, seiner Aufgabe, seines Opfers, seiner Verdienste. Wir können die Überzeugung davon gar nicht tief genug in uns verankern. Das Evangelium berichtet, dass der Vater nur dreimal seine Stimme vernehmen ließ und jedes Mal - namentlich am Tabor - tat er es, um feierlich zu verkünden, dass Jesus sein geliebter Sohn sei, auf den wir hören sollen. Dieses Zeugnis ist die erhabenste und kostbarste Offenbarung, die Gott der Welt zuteil werden ließ. Und alle Heiligkeit besteht darin, dieses Zeugnis anzunehmen und sein Leben danach zu gestalten.
Der Glaube an die Gottheit Christi ist das Licht, das über unserm ganzen Priesterleben strahlen soll. Dieser Glaube stellt uns die Gestalt Jesu vor Augen und enthüllt uns dadurch die Bosheit der Sünde, die Größe der Demut, die Kraft des Gehorsams. Er lehrt uns, in unserm Verkehr mit Gott nach einer Haltung tiefer Ehrfurcht zu streben und die Liebe über alles zu stellen. Er lässt uns im Nächsten Christus selbst sehen.
Tagtäglich erinnert er uns an die Herrlichkeit des Messopfers, an die Erhabenheit des Lebens, zu dem uns das eucharistische Mahl einlädt, an den Wert des Breviergebetes.
Unser Gebetsleben in Vereinigung mit dem Heiligen Geist, unsere Heiligung durch die alltäglichen Handlungen wäre ohne das Licht dieses Glaubens unmöglich.
Und da unsere Ähnlichkeit mit Jesus nur dann vollkommen ist, wenn wir wie er Kinder Mariens sind, lässt uns der Glaube auch zur seligsten Jungfrau unsere Zuflucht nehmen, der Gott die Bestimmung gab, uns in der Menschwerdung Jesus zu schenken und am Fuße des Kreuzes unsere Mutter zu werden.
In der stets wachsenden Klarheit dieses lebendigen Glaubens enthüllen sich Christus und seine Geheimnisse allmählich unseren Blicken. Und durch die treue Übung der Tugenden, durch den täglichen Kontakt mit dem Ursprung unserer Heiligkeit in der Messe und beim Gebet, durch unsere Fügsamkeit gegenüber den Einsprechungen des Heiligen Geistes arbeiten wir an unserer Umgestaltung nach dem Bild des einzigen Priesters. So kommen wir - soweit es die uns zugemessene Zeit und unserer Schwachheit zulässt - täglich dem näher, der das Idealbild unserer Vollkommenheit ist. Die hochherzige Liebe, mit der wir uns darum bemühen, wird wiederum Quelle neuer Erleuchtungen: «Wenn jemand mich liebt, werde ich mich ihm offenbaren», sagt Jesus (Joh 14,21).
So wird es sein, bis wir - nach dem Worte des hl. Paulus zur «Mannesreife Christi gelangen» (Eph 4, 13) und in das ewige Leben eingehen.
Wird diese Gnade der zweifachen Verklärung noch im Himmel zur Vollendung unserer Heiligkeit beitragen? Ganz sicher.
Durch die Wirkung des Glorienlichtes werden wir Christus im Glanz seiner Gottheit von Angesicht zu Angesicht schauen. Im Licht des göttlichen Wortes wird seine heilige Menschheit sich zeigen, strahlend in der Herrlichkeit, die dem eingeborenen Sohn des Vaters eigen ist, «voll der Gnade und Wahrheit». Staunend werden wir die Fülle betrachten, aus der wir alles empfangen haben. Die Majestät Christi, des ewigen Hohenpriesters, dem der Vater «einen Namen gegeben hat, der da ist über alle Namen», wird sich uns vollkommener enthüllen als den Aposteln auf Tabor. Dann werden wir die tiefe Wahrheit der Worte des «Gloria» erfassen, die wir so oft aussprachen: «Du allein bist der Heilige, Du allein der Herr, Du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, in der Herrlichkeit des Vaters.»
Überdies wird jeder der Auserwählten bei seinem Eintritt in die himmlischen Wohnungen zu vollendeter Ähnlichkeit mit dem Sohn Gottes umgestaltet. So mächtig ist die Gnade unserer Annahme an Kindes Statt, dass sie es in ihrer letzten Entfaltung vermag, uns dem Bild Gottes gleichförmig zu machen. Der hl. Johannes sagt: «Bei seiner Erscheinung werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn schauen, wie er ist» (1 Joh 3, 2). Wieso wird die Gottesschau unsere Seelen so verklären? Weil unsere Seele einem Spiegel gleicht; und wenn sie die unaussprechliche Schönheit betrachtet, wird sie auf ewig das lichte Abbild dieser Schönheit.
Das gilt für jeden Christen; aber uns Priestern ist auf Grund des priesterlichen Charakters eine besondere Fülle von Herrlichkeit vorbehalten. Dieses Merkmal, das unsere Ähnlichkeit mit Christus bewirkt, ist hienieden unsichtbar; doch es wird einst in hellem Licht erstrahlen. Die Wahrheit des Wortes: «Du bist Priester auf ewig» wird sich uns dann in seiner ganzen Tiefe enthüllen. Die Priesterwürde wird uns für alle Ewigkeit ein unvergleichliches Glück, Grund zu Danksagung, Lobpreis und reinster, unaussprechlicher Freude sein.
In der Stunde, da Jesus das Priestertum einsetzte und seine Apostel zu Priestern weihte, betete er für sie. Für sie und für alle Priester, die sein Erlösungswerk fortsetzen sollten:
«Heiliger Vater ... für sie bitte ich, die du mir gegeben hast ... Ich bitte nicht: Nimm sie aus der Welt, sondern: Bewahre sie vor dem Bösen ... Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt … Damit sie meine Freude vollkommen in sich haben … Damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind ... Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleichwie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass sie, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir verliehen hast. Denn du hast mich geliebt, noch ehe die Welt ward» (Joh 17,9-24).
Literatur
- Dom Columba Marmion: Christus, das Ideal des Priesters, Nova & vetera Verlag Bonn 2014 (392 Seiten, ISBN 978-3-936741-97-1).