Weihnachtsansprachen Papst Benedikts XVI.
von Papst
Benedikt XVI.
an das Kardinalskollegium und die Mitglieder der Römischen Kurie beim Weihnachtsempfang
| Allgemeiner Hinweis: Was bei der Lektüre von Wortlautartikeln der Lehramtstexte zu beachten ist |
2005
am 22. Dezember
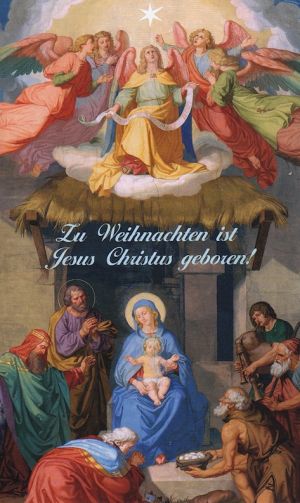
hochwürdige Mitbrüder im Bischofs- und Priesteramt,
»Expergiscere, homo: quia pro te Deus factus est homo – Erwache, o Mensch; denn für dich ist Gott Mensch geworden« (Augustinus, Reden, 185). Mit dieser Aufforderung des hl. Augustinus, den wahren Sinn des Geburtsfestes Christi zu erfassen, beginne ich jetzt vor dem nahen Weihnachtsfest meine Begegnung mit euch, liebe Mitarbeiter der Römischen Kurie. An jeden von euch richte ich meinen herzlichen Gruß und danke euch für eure Treue und Zuneigung, die der Dekan des Kardinalskollegiums in sehr eindrückliche Worte gefaßt hat, wofür ich ihm danke. Gott ist für uns Mensch geworden: Das ist die Botschaft, die in jedem Jahr von der stillen Grotte in Betlehem ausgeht und jeden noch so abgelegenen Teil der Erde erreicht. Weihnachten ist das Fest des Lichtes und des Friedens, es ist ein Tag innerer Ergriffenheit und Freude, die das Universum erfüllt, denn »Gott ist Mensch geworden«. Von der armseligen Grotte in Betlehem aus wendet sich der ewige Sohn Gottes, der zu einem kleinen Kind geworden ist, an jeden von uns: Er spricht uns an, er lädt uns ein, in ihm neu geboren zu werden, damit wir zusammen mit ihm für alle Ewigkeit in der Gemeinschaft der Heiligen Dreifaltigkeit leben können.
Das Herz erfüllt von der Freude, die diesem Bewußtsein entspringt, gehen wir in Gedanken zurück zu den Geschehnissen des Jahres, das nun zu Ende geht. Hinter uns liegen große Ereignisse, die im Leben der Kirche tiefe Spuren hinterlassen haben. Ich denke dabei vor allem an den Tod unseres geliebten Heiligen Vaters Johannes Paul II., dem ein langer Leidensweg und der schrittweise Verlust der Sprachfähigkeit vorausgegangen ist. Kein Papst hat so viele Texte hinterlassen wie er; kein Papst vor ihm hat wie er die ganze Welt besuchen und unmittelbar zu den Menschen aller Erdteile sprechen können. Aber am Ende wurde ihm ein Weg des Leidens und des Schweigens zuteil. Uns bleiben die Bilder vom Palmsonntag unvergeßlich, als er mit dem Ölzweig in der Hand und vom Schmerz gezeichnet am Fenster stand und uns den Segen des Herrn erteilte, im Begriff, den Weg zum Kreuz anzutreten. Dann sah man ihn in seiner Privatkapelle, wo er mit dem Kruzifix in der Hand am Kreuzweg im Kolosseum teilnahm, wo er viele Male an der Spitze der Prozession gestanden und selbst das Kreuz getragen hatte. Schließlich folgte der stumme Segen am Ostersonntag, in dem wir durch allen Schmerz hindurch die Verheißung der Auferstehung, des ewigen Lebens leuchten sahen. Der Heilige Vater hat uns in seinen Worten und Werken große Dinge geschenkt; aber nicht weniger wichtig ist die Lektion, die er uns vom Lehrstuhl des Leidens und des Schweigens aus erteilt hat. In seinem letzten Buch »Erinnerung und Identität« (Weltbild Buchverlag 2005) hat er uns eine Deutung des Leidens hinterlassen, die keine theologische oder philosophische Theorie ist, sondern eine Frucht, die auf seinem persönlichen Leidensweg herangereift ist, den er mit dem Halt, den ihm der Glauben an den gekreuzigten Herrn geschenkt hat, gegangen ist. Diese im Glauben erarbeitete Deutung, die seinem Leiden, das er in Gemeinschaft mit dem Leiden des Herrn durchlebte, einen Sinn verlieh, sprach durch seinen stummen Schmerz und verwandelte diesen in eine großartige Botschaft. Sowohl am Anfang als auch noch einmal am Ende des erwähnten Buches zeigt der Papst sich tief beeindruckt von der Macht des Bösen, die wir im soeben zu Ende gegangenen Jahrhundert auf dramatische Weise erfahren mußten. Er sagt wörtlich: »Das Böse des 20. Jahrhunderts war nicht ein Übel in Kleinformat… Es war ein Übel von gigantischen Ausmaßen, ein Übel, das sich der staatlichen Strukturen bedient hat, um sein unheilvolles Werk zu vollenden, ein Übel, das zum System erhoben wurde« (S. 207f.) Ist das Böse denn unüberwindlich? Ist es wirklich die letzte Macht der Geschichte? Aufgrund seiner Erfahrung mit dem Bösen war die Frage nach der Erlösung für Papst Wojtyla zur eigentlichen und zentralen Frage seines Lebens und Denkens als Christ geworden. Gibt es eine Grenze, an der die Macht des Bösen zunichte wird? Ja, es gibt sie, antwortet der Papst in diesem Buch und auch in seiner Enzyklika über die Erlösung. Die Macht, die dem Bösen eine Grenze setzt, ist die göttliche Barmherzigkeit. Der Gewalt, der Überheblichkeit des Bösen stellt sich in der Geschichte – als »das ganz andere« Gottes, als Gottes eigene Macht – die göttliche Barmherzigkeit entgegen. Das Lamm ist stärker als der Drache, könnten wir mit dem Buch der Offenbarung sagen.
Am Ende des Buches hat Johannes Paul II. im Rückblick auf das Attentat vom 13. Mai 1981 und auch auf der Grundlage der Erfahrungen, die er auf seinem Weg mit Gott und der Welt gemacht hat, diese Antwort noch weiter vertieft. Die Grenze, die der Gewalt des Bösen gesetzt ist, die Macht, die es endgültig besiegt, ist – so sagt er – das Leiden Gottes, das Leiden des Gottessohnes am Kreuz: »Das Leiden des gekreuzigten Gottes ist nicht nur eine Form des Leidens neben den anderen… Christus hat, indem er für uns alle litt, dem Leiden einen neuen Sinn verliehen, er hat es in eine neue Dimension erhoben, in eine neue Ordnung eingeführt: in die Ordnung der Liebe… Die Passion Christi am Kreuz hat dem Leiden einen radikal neuen Sinn verliehen, es von innen her verwandelt… Es ist das Leiden, welches das Böse mit der Flamme der Liebe verbrennt und aufzehrt… Jedes menschliche Leiden, jeder Schmerz, jede Gebrechlichkeit birgt eine Verheißung des Heiles… in sich… All dieses Böse existiert in der Welt auch, um in uns die Liebe zu erwecken, die eine Selbsthingabe ist… im… Dienst an denen, die vom Leiden heimgesucht sind… Christus ist der Erlöser der Welt: ›Durch seine Wunden sind wir geheilt‹ (Jes 53,5)« (S. 208f.). All dies ist nicht nur gelehrte Theologie, sondern Ausdruck eines im Leiden gelebten und zur Reife gekommenen Glaubens. Sicher, wir müssen alles tun, um Leid zu mildern und Ungerechtigkeit, durch die Unschuldige leiden müssen, zu verhindern. Wir müssen jedoch auch alles tun, damit die Menschen den Sinn des Leidens erkennen können und so in die Lage sind, das eigene Leiden anzunehmen und es mit dem Leiden Christi zu vereinen. Auf diese Weise wird ihr Leiden eins mit der erlösenden Liebe und folglich zu einer Kraft gegen das Böse in der Welt. Die Reaktion, die die ganze Welt auf den Tod des Papstes zeigte, war eine ergreifende Dankesbezeugung dafür, daß er sich in seinem Dienst ganz Gott übergeben hatte für die Welt. Es war der Dank dafür, daß er uns in einer von Haß und Gewalt erfüllten Welt wieder gelehrt hat, zu lieben und für andere Menschen zu leiden; er hat uns sozusagen in seiner Person den Erlöser, die Erlösung gezeigt, und er hat uns die Gewißheit gegeben, daß das Böse wirklich nicht das letzte Wort in der Welt hat.
Zwei weitere Ereignisse, die noch von Papst Johannes Paul II. in die Wege geleitet wurden, möchte ich jetzt, wenn auch nur kurz, erwähnen: Es handelt sich um den Weltjugendtag in Köln und die Bischofssynode zur Eucharistie, die zugleich das von Johannes Paul II. eröffnete Jahr der Eucharistie abgeschlossen hat. Weltjugendtag in Köln
Der Weltjugendtag ist allen, die dabeigewesen sind, als großes Geschenk in Erinnerung geblieben. Über eine Million Jugendlicher haben sich in der Stadt Köln, die am Rhein liegt, und in den umliegenden Städten versammelt, um gemeinsam das Wort Gottes zu hören, um gemeinsam zu beten, um die Sakramente der Versöhnung und der Eucharistie zu empfangen, um gemeinsam zu singen und zu feiern, um sich des Lebens zu freuen und um den Herrn in der Eucharistie in den großen Begegnungen am Samstagabend und am Sonntag anzubeten und zu empfangen. In diesen Tagen herrschte einfach Freude. Außer Ordnungsdiensten hatte die Polizei nichts zu tun – der Herr hatte seine Familie versammelt, wobei alle Grenzen und Schranken spürbar überwunden wurden, und er hat uns seine Gegenwart in der großen Gemeinschaft untereinander erfahren lassen. Das Motto, das für jene Tage gewählt worden war – »Wir sind gekommen, um ihn anzubeten « –, enthielt zwei große Bilder, die von Anfang an die Voraussetzungen schufen, den richtigen Zugang zu finden. Da war vor allem das Bild der Pilgerreise, das Bild des Menschen, der über seine Geschäfte und seinen Alltag hinausblickt und sich auf die Suche macht nach seiner wahren Bestimmung, nach der Wahrheit, nach dem rechten Leben, nach Gott. Dieses Bild des Menschen, der sich auf dem Weg zum Ziel des Lebens befindet, enthielt noch zwei weitere deutliche Anspielungen. Da war vor allem die Aufforderung, die Welt, die uns umgibt, nicht nur als Rohmaterial, mit dem wir etwas machen können, zu betrachten, sondern zu versuchen, in ihr die »Handschrift des Schöpfers« zu entdecken, die schöpferische Vernunft und die Liebe, aus der die Welt entstanden ist und von der das Universum zu uns spricht, wenn wir aufmerksam sind, wenn unsere inneren Sinne erwachen und Wahrnehmungskraft für die tieferen Dimensionen der Wirklichkeit gewinnen. Als zweites Element kam dann die Aufforderung hinzu, der geschichtlichen Offenbarung Gehör zu schenken, die allein für uns der Schlüssel zum Verständnis des stillen Geheimnisses der Schöpfung ist, indem sie uns konkret den Weg zum wahren Herrn der Welt und der Geschichte zeigt, der sich in der Armut des Stalls von Betlehem verbirgt. Das andere im Motto des Weltjugendtags enthaltene Bild war der anbetende Mensch: »Wir sind gekommen, um ihn anzubeten«. Vor jedem Handeln und jeder Veränderung der Welt muß die Anbetung stehen. Nur sie macht uns wirklich frei; nur sie gibt uns die Kriterien für unser Handeln. Gerade in einer Welt, in der die Kriterien, die Orientierung bieten, immer weniger werden und die Gefahr besteht, daß jeder nur sich selbst zum Kriterium nimmt, ist es sehr wichtig, die Anbetung hervorzuheben. Allen, die dabeigewesen sind, bleibt das tieferlebte Schweigen jener Million Jugendlicher unvergeßlich, ein Schweigen, das uns alle vereinte und unsere Herzen erhob, als der Herr im Sakrament auf dem Altar ausgesetzt wurde. Wir bewahren die Bilder von Köln in unseren Herzen: Sie sind ein Fingerzeig, der weiterwirkt. Ohne einzelne Namen zu nennen, möchte ich bei dieser Gelegenheit allen danken, die den Weltjugendtag ermöglicht haben; vor allem aber danken wir gemeinsam dem Herrn, denn nur er konnte uns jene Tage so schenken, wie wir sie erlebt haben.
Das Wort »Anbetung« leitet über zum zweiten großen Ereignis, über das ich sprechen möchte: die Bischofssynode und das Jahr der Eucharistie. Papst Johannes Paul II. hatte uns in der Enzyklika Ecclesia de Eucharistia und im Apostolischen Schreiben Mane nobiscum Domine bereits die grundlegenden Anleitungen dafür gegeben und hatte gleichzeitig mit seiner persönlichen Erfahrung des eucharistischen Glaubens die Lehre der Kirche konkret umgesetzt. Darüber hinaus hatte die Kongregation für den Gottesdienst die eng mit der Enzyklika verbundene Instruktion Redemptionis Sacramentum veröffentlicht, die als praktische Hilfe bei der richtigen Umsetzung der Konzilskonstitution über die Liturgie und der Liturgiereform dienen soll. War es darüber hinaus wirklich möglich, noch etwas Neues zu sagen, das Lehrgebäude noch weiterzuentwickeln? Gerade das war die große Erfahrung, die die Synode machte, als sie sah, daß sich in den Beiträgen der Synodenväter der Reichtum des eucharistischen Lebens der Kirche von heute abzeichnete und deutlich wurde, wie unerschöpflich ihr eucharistischer Glaube ist. Das, was die Synodenväter gedacht und zum Ausdruck gebracht haben, muß in enger Verbindung mit den »Propositiones« der Synode in einem nachsynodalen Schreiben veröffentlicht werden. Ich möchte hier nur noch einmal den Punkt unterstreichen, den wir eben bereits im Zusammenhang mit dem Weltjugendtag erwähnt haben: die Anbetung des auferstandenen Herrn, der in der Eucharistie in Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, als Gott und Mensch gegenwärtig ist. Es berührt mich tief, zu sehen, wie überall in der Kirche die Freude der eucharistischen Anbetung neu erwacht und ihre Früchte zeigt. Zur Zeit der Liturgiereform wurden oft die Messe und die Anbetung außerhalb der Messe als Gegensätze betrachtet: einer damals weit verbreiteten Auffassung zufolge sei uns das eucharistische Brot nicht gegeben worden, um betrachtet, sondern um verzehrt zu werden. In der Gebetserfahrung der Kirche hat sich inzwischen gezeigt, daß es nicht sinnvoll ist, eine solche Unterscheidung vorzunehmen. Schon Augustinus hat gesagt: »… nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; … peccemus non adorando – Niemand ißt dieses Fleisch, ohne es vorher anzubeten; … wir würden sündigen, wenn wir es nicht anbeteten« (vgl. Enarr. in Ps 98,9; CCL XXXIX, 1385). In der Tat empfangen wir in der Eucharistie nicht einfach irgend etwas. Die Eucharistie ist die Begegnung und Vereinigung von Personen; die Person jedoch, die uns entgegenkommt und mit uns eins zu werden wünscht, ist der Sohn Gottes. Eine solche Vereinigung kann nur in der Anbetung stattfinden. Die Eucharistie zu empfangen bedeutet, den anzubeten, den wir empfangen. Genau so und nur so werden wir eins mit ihm. Daher ist die Entwicklung der eucharistischen Anbetung in der Form, wie sie sich im Verlauf des Mittelalters herausgebildet hat, eine Konsequenz des eucharistischen Geheimnisses selbst und besitzt einen starken inneren Zusammenhang mit diesem: Nur in der Anbetung kann eine tiefe und echte Aufnahme der Eucharistie heranreifen. Und eben in dieser persönlichen Begegnung mit dem Herrn reift dann auch die Sendung im zwischenmenschlichen Bereich heran, die in der Eucharistie enthalten ist und die nicht nur die Barrieren zwischen dem Herrn und uns beseitigen will, sondern auch und vor allem die Barrieren, die uns Menschen voneinander trennen.
Das letzte Ereignis dieses Jahres, bei dem ich bei dieser Gelegenheit verweilen möchte, ist der Abschluß des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 40 Jahren. Dieser Anlaß läßt Fragen aufkommen: Welches Ergebnis hatte das Konzil? Ist es richtig rezipiert worden? Was war an der Rezeption des Konzils gut, was unzulänglich oder falsch? Was muß noch getan werden? Niemand kann leugnen, daß in weiten Teilen der Kirche die Konzilsrezeption eher schwierig gewesen ist, auch wenn man auf das, was in diesen Jahren geschehen ist, nicht die Schilderung der Situation der Kirche nach dem Konzil von Nizäa, die der große Kirchenlehrer Basilius uns gegeben hat, übertragen will: Er vergleicht die Situation mit einer Schiffsschlacht in stürmischer Nacht und sagt unter anderem: »Das heisere Geschrei derer, die sich im Streit gegeneinander erheben, das unverständliche Geschwätz, die verworrenen Geräusche des pausenlosen Lärms, all das hat fast schon die ganze Kirche erfüllt und so durch Hinzufügungen oder Auslassungen die rechte Lehre der Kirche verfälscht …« (vgl. De Spiritu Sancto, XXX, 77; PG 32, 213 A; SCh 17bis, S. 524). Wir wollen dieses dramatische Bild nicht direkt auf die nachkonziliare Situation übertragen, aber etwas von dem, was geschehen ist, kommt darin zum Ausdruck. Die Frage taucht auf, warum die Rezeption des Konzils in einem großen Teil der Kirche so schwierig gewesen ist. Nun ja, alles hängt ab von einer korrekten Auslegung des Konzils oder – wie wir heute sagen würden – von einer korrekten Hermeneutik, von seiner korrekten Deutung und Umsetzung. Die Probleme der Rezeption entsprangen der Tatsache, daß zwei gegensätzliche Hermeneutiken miteinander konfrontiert wurden und im Streit lagen. Die eine hat Verwirrung gestiftet, die andere hat Früchte getragen, was in der Stille geschah, aber immer deutlicher sichtbar wurde, und sie trägt auch weiterhin Früchte. Auf der einen Seite gibt es eine Auslegung, die ich »Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruches« nennen möchte; sie hat sich nicht selten das Wohlwollen der Massenmedien und auch eines Teiles der modernen Theologie zunutze machen können. Auf der anderen Seite gibt es die »Hermeneutik der Reform«, der Erneuerung des einen Subjekts Kirche, die der Herr uns geschenkt hat, unter Wahrung der Kontinuität; die Kirche ist ein Subjekt, das mit der Zeit wächst und sich weiterentwickelt, dabei aber immer sie selbst bleibt, das Gottesvolk als das eine Subjekt auf seinem Weg. Die Hermeneutik der Diskontinuität birgt das Risiko eines Bruches zwischen vorkonziliarer und nachkonziliarer Kirche in sich. Ihre Vertreter behaupten, daß die Konzilstexte als solche noch nicht wirklich den Konzilsgeist ausdrückten. Sie seien das Ergebnis von Kompromissen, die geschlossen wurden, um Einmütigkeit herzustellen, wobei viele alte und inzwischen nutzlos gewordene Dinge mitgeschleppt und wieder bestätigt werden mußten. Nicht in diesen Kompromissen komme jedoch der wahre Geist des Konzils zum Vorschein, sondern im Elan auf das Neue hin, das den Texten zugrunde liege: nur in diesem Elan liege der wahre Konzilsgeist, und hier müsse man ansetzen und dementsprechend fortfahren. Eben weil die Texte den wahren Konzilsgeist und seine Neuartigkeit nur unvollkommen zum Ausdruck brächten, sei es notwendig, mutig über die Texte hinauszugehen und dem Neuen Raum zu verschaffen, das die tiefere, wenn auch noch nicht scharf umrissene Absicht des Konzils zum Ausdruck bringe. Mit einem Wort, man solle nicht den Konzilstexten, sondern ihrem Geist folgen. Unter diesen Umständen entsteht natürlich ein großer Spielraum für die Frage, wie dieser Geist denn zu umschreiben sei, und folglich schafft man Raum für Spekulationen. Damit mißversteht man jedoch bereits im Ansatz die Natur eines Konzils als solchem. Es wird so als eine Art verfassunggebende Versammlung betrachtet, die eine alte Verfassung außer Kraft setzt und eine neue schafft. Eine verfassunggebende Versammlung braucht jedoch einen Auftraggeber und muß dann von diesem Auftraggeber, also vom Volk, dem die Verfassung dienen soll, ratifiziert werden. Die Konzilsväter besaßen keinen derartigen Auftrag, und niemand hatte ihnen jemals einen solchen Auftrag gegeben; es konnte ihn auch niemand geben, weil die eigentliche Kirchenverfassung vom Herrn kommt, und sie uns gegeben wurde, damit wir das ewige Leben erlangen und aus dieser Perspektive heraus auch das Leben in der Zeit und die Zeit selbst erleuchten können. Die Bischöfe sind durch das Sakrament, das sie erhalten haben, Treuhänder der Gabe des Herrn. Sie sind »Verwalter von Geheimnissen Gottes« (1 Kor 4,1); als solche müssen sie als »treu und klug« (vgl. Lk 12,41–48) befunden werden. Das heißt, daß sie die Gabe des Herrn in rechter Weise verwalten müssen, damit sie nicht in irgendeinem Versteck verborgen bleibt, sondern Früchte trägt, und der Herr am Ende zum Verwalter sagen kann: »Weil du im Kleinsten treu gewesen bist, will ich dir eine große Aufgabe übertragen« (vgl. Mt 25,14–30; Lk 19,11–27). In diesen biblischen Gleichnissen wird die Dynamik der Treue beschrieben, die im Dienst des Herrn wichtig ist, und in ihnen wird auch deutlich, wie in einem Konzil Dynamik und Treue eins werden müssen.
Der Hermeneutik der Diskontinuität steht die Hermeneutik der Reform gegenüber, von der zuerst Papst Johannes XXIII. in seiner Eröffnungsansprache zum Konzil am 11. Oktober 1962 gesprochen hat und dann Papst Paul VI. in der Abschlußansprache am 7. Dezember 1965. Ich möchte hier nur die wohlbekannten Worte Johannes’ XXIII. zitieren, die diese Hermeneutik unmißverständlich zum Ausdruck bringen, wenn er sagt, daß das Konzil »die Lehre rein und vollständig übermitteln will, ohne Abschwächungen oder Entstellungen« und dann fortfährt: »Unsere Pflicht ist es nicht nur, dieses kostbare Gut zu hüten, so als interessierte uns nur das Altehrwürdige an ihm, sondern auch, uns mit eifrigem Willen und ohne Furcht dem Werk zu widmen, das unsere Zeit von uns verlangt… Es ist notwendig, die unumstößliche und unveränderliche Lehre, die treu geachtet werden muß, zu vertiefen und sie so zu formulieren, daß sie den Erfordernissen unserer Zeit entspricht. Eine Sache sind nämlich die Glaubensinhalte, also die in unserer ehrwürdigen Lehre enthaltenen Wahrheiten, eine andere Sache ist die Art, wie sie formuliert werden, wobei ihr Sinn und ihre Tragweite erhalten bleiben müssen« (S. Oec. Conc. Vat. II Constitutiones Decreta Declarationes, 1974, S. 863–65). Es ist klar, daß der Versuch, eine bestimmte Wahrheit neu zu formulieren, es erfordert, neu über sie nachzudenken und in eine neue, lebendige Beziehung zu ihr zu treten; es ist ebenso klar, daß das neue Wort nur dann zur Reife gelangen kann, wenn es aus einem bewußten Verständnis der darin zum Ausdruck gebrachten Wahrheit entsteht, und daß die Reflexion über den Glauben andererseits auch erfordert, daß man diesen Glauben lebt. In diesem Sinne war das Programm, das Papst Johannes XXIII. vorgegeben hat, äußerst anspruchsvoll, wie auch die Verbindung von Treue und Dynamik anspruchsvoll ist. Aber überall dort, wo die Rezeption des Konzils sich an dieser Auslegung orientiert hat, ist neues Leben gewachsen und sind neue Früchte herangereift. 40 Jahre nach dem Konzil können wir die Tatsache betonen, daß seine positiven Folgen größer und lebenskräftiger sind, als es in der Unruhe der Jahre um 1968 den Anschein haben konnte. Heute sehen wir, daß der gute Same, auch wenn er sich langsam entwickelt, dennoch wächst, und so wächst auch unsere tiefe Dankbarkeit für das Werk, das das Konzil vollbracht hat.
Paul VI. hat dann in seiner Abschlußrede zum Konzil noch einen speziellen Grund aufgezeigt, warum eine Hermeneutik der Diskontinuität überzeugend erscheinen könnte. In der großen Kontroverse um den Menschen, die bezeichnend ist für die Moderne, mußte das Konzil sich besonders dem Thema der Anthropologie widmen. Es mußte über das Verhältnis zwischen der Kirche und ihrem Glauben auf der einen und dem Menschen und der heutigen Welt auf der anderen Seite nachdenken (ebd., S. 1066f.). Das Problem wird noch deutlicher, wenn wir anstatt des allgemeinen Terminus »heutige Welt« ein anderes, treffenderes Wort wählen: Das Konzil mußte das Verhältnis von Kirche und Moderne neu bestimmen. Dieses Verhältnis hatte mit dem Prozeß gegen Galilei einen sehr problematischen Anfang genommen. Es war im Folgenden vollkommen zerbrochen, als Kant die »Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« beschrieb und als in der radikalen Phase der Französischen Revolution ein Staats- und Menschenbild Verbreitung fand, das der Kirche und dem Glauben praktisch keinen Raum mehr zugestehen wollte. Der Zusammenstoß des Glaubens der Kirche mit einem radikalen Liberalismus und auch mit den Naturwissenschaften, die sich anmaßten, mit ihren Kenntnissen die ganze Wirklichkeit bis zu ihrem Ende zu erfassen, und sich fest vorgenommen hatten, die »Hypothese Gott« überflüssig zu machen, hatte im 19. Jahrhundert seitens der Kirche unter Pius IX. zu harten und radikalen Verurteilungen eines solchen Geistes der Moderne geführt. Es gab somit scheinbar keinen Bereich mehr, der offen gewesen wäre für eine positive und fruchtbare Verständigung, und diese wurde von denjenigen, die sich als Vertreter der Moderne fühlten, auch drastisch abgelehnt. In der Zwischenzeit hatte jedoch auch die Moderne Entwicklungen durchgemacht. Man merkte, daß die amerikanische Revolution ein modernes Staatsmodell bot, das anders war als das, welches die radikalen Tendenzen, die aus der zweiten Phase der französischen Revolution hervorgegangen waren, entworfen hatten. Die Naturwissenschaften begannen, immer klarer über die eigenen Grenzen nachzudenken, die ihnen von ihrer eigenen Methode auferlegt wurden, die, auch wenn sie große Dinge vollbrachte, dennoch nicht in der Lage war, die gesamte Wirklichkeit zu erfassen. So begannen beide Seiten, immer mehr Offenheit füreinander zu zeigen. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und verstärkt nach dem Zweiten Weltkrieg hatten katholische Staatsmänner bewiesen, daß es einen säkularen modernen Staat geben kann, der dennoch nicht wertneutral ist, sondern sein Leben aus den großen Quellen christlicher Ethik schöpft. Die katholische Soziallehre, die sich nach und nach entwickelt hatte, war zu einem wichtigen Modell neben dem radikalen Liberalismus und der marxistischen Staatstheorie geworden. Die Naturwissenschaften, die sich rückhaltlos zu einer eigenen Methode bekannten, in der Gott keinen Zugang hatte, merkten immer deutlicher, daß diese Methode nicht die volle Wirklichkeit umfaßte, und öffneten daher Gott wieder die Türen, da sie wußten, daß die Wirklichkeit größer ist als die naturwissenschaftliche Methode und das, was mit dieser erfaßt werden kann. Man könnte sagen, daß sich drei Fragenkreise gebildet hatten, die jetzt, zur Zeit des Zweiten Vaticanums, auf eine Antwort warteten. Vor allem war es notwendig, das Verhältnis von Glauben und modernen Wissenschaften neu zu bestimmen; das galt übrigens nicht nur für die Naturwissenschaften, sondern auch für die Geschichtswissenschaft, weil in einer gewissen Schule die Vertreter der historisch-kritischen Methode das letzte Wort in der Bibelauslegung für sich in Anspruch nahmen und sich – da sie behaupteten, das einzig mögliche Schriftverständnis zu besitzen – in wichtigen Punkten der Auslegung, die dem Glauben der Kirche erwachsen war, widersetzten. Zweitens mußte das Verhältnis von Kirche und modernem Staat neu bestimmt werden, einem Staat, der Bürgern verschiedener Religionen und Ideologien Platz bot, sich gegenüber diesen Religionen unparteiisch verhielt und einfach nur die Verantwortung übernahm für ein geordnetes und tolerantes Zusammenleben der Bürger und für ihre Freiheit, die eigene Religion auszuüben. Damit war drittens ganz allgemein das Problem der religiösen Toleranz verbunden – und das verlangte eine Neubestimmung des Verhältnisses von christlichem Glauben und Weltreligionen. Angesichts der jüngsten Verbrechen, die unter der nationalsozialistischen Herrschaft geschehen waren, und überhaupt im Rückblick auf eine lange und schwierige Geschichte mußte besonders das Verhältnis der Kirche zum Glauben Israels neu bewertet und bestimmt werden.
All diese Themen sind von großer Tragweite – es waren die großen Themen der zweiten Konzilshälfte –, und es ist in diesem Zusammenhang nicht möglich, sich eingehender mit ihnen zu befassen. Es ist klar, daß in all diesen Bereichen, die in ihrer Gesamtheit ein und dasselbe Problem darstellen, eine Art Diskontinuität entstehen konnte und daß in gewissem Sinne tatsächlich eine Diskontinuität aufgetreten war. Trotzdem stellte sich jedoch heraus, daß, nachdem man zwischen verschiedenen konkreten historischen Situationen und ihren Ansprüchen unterschieden hatte, in den Grundsätzen die Kontinuität nicht aufgegeben worden war – eine Tatsache, die auf den ersten Blick leicht übersehen wird. Genau in diesem Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität auf verschiedenen Ebenen liegt die Natur der wahren Reform. Innerhalb dieses Entwicklungsprozesses des Neuen unter Bewahrung der Kontinuität mußten wir lernen – besser, als es bis dahin der Fall gewesen war – zu verstehen, daß die Entscheidungen der Kirche in bezug auf vorübergehende, nicht zum Wesen gehörende Fragen – zum Beispiel in Bezug auf bestimmte konkrete Formen des Liberalismus oder der liberalen Schriftauslegung – notwendigerweise auch selbst vorübergehende Antworten sein mußten, eben weil sie Bezug nahmen auf eine bestimmte in sich selbst veränderliche Wirklichkeit. Man mußte lernen, zu akzeptieren, daß bei solchen Entscheidungen nur die Grundsätze den dauerhaften Aspekt darstellen, wobei sie selbst im Hintergrund bleiben und die Entscheidung von innen heraus begründen. Die konkreten Umstände, die von der historischen Situation abhängen und daher Veränderungen unterworfen sein können, sind dagegen nicht ebenso beständig. So können die grundsätzlichen Entscheidungen ihre Gültigkeit behalten, während die Art ihrer Anwendung auf neue Zusammenhänge sich ändern kann. So wird beispielsweise die Religionsfreiheit dann, wenn sie eine Unfähigkeit des Menschen, die Wahrheit zu finden, zum Ausdruck bringen soll und infolgedessen dem Relativismus den Rang eines Gesetzes verleiht, von der Ebene einer gesellschaftlichen und historischen Notwendigkeit auf die ihr nicht angemessene Ebene der Metaphysik erhoben und so ihres wahren Sinnes beraubt, was zur Folge hat, daß sie von demjenigen, der glaubt, daß der Mensch fähig sei, die Wahrheit Gottes zu erkennen und der aufgrund der der Wahrheit innewohnenden Würde an diese Erkenntnis gebunden ist, nicht akzeptiert werden kann. Etwas ganz anderes ist es dagegen, die Religionsfreiheit als Notwendigkeit für das menschliche Zusammenleben zu betrachten oder auch als eine Folge der Tatsache, daß die Wahrheit nicht von außen aufgezwungen werden kann, sondern daß der Mensch sie sich nur durch einen Prozeß innerer Überzeugung zu eigen machen kann. Das Zweite Vatikanische Konzil hat mit dem Dekret über die Religionsfreiheit einen wesentlichen Grundsatz des modernen Staates anerkannt und übernommen und gleichzeitig ein tief verankertes Erbe der Kirche wieder aufgegriffen. Diese darf wissen, daß sie sich damit in völligem Einvernehmen mit der Lehre Jesu befindet (vgl. Mt 22,21), ebenso wie mit der Kirche der Märtyrer, mit den Märtyrern aller Zeiten. Die frühe Kirche hat mit größter Selbstverständlichkeit für die Kaiser und die politisch Verantwortlichen gebetet, da sie dies als ihre Pflicht betrachtete (vgl. 1 Tim 2,2); während sie aber für den Kaiser betete, hat sie sich dennoch geweigert, ihn anzubeten und hat damit die Staatsreligion eindeutig abgelehnt. Die Märtyrer der frühen Kirche sind für ihren Glauben an den Gott gestorben, der sich in Jesus Christus offenbart hatte, und damit sind sie auch für die Gewissensfreiheit und für die Freiheit, den eigenen Glauben zu bekennen, gestorben – für ein Bekenntnis, das von keinem Staat aufgezwungen werden kann, sondern das man sich nur durch die Gnade Gottes in der Freiheit des eigenen Gewissens zu eigen machen kann. Eine missionarische Kirche, die sich verpflichtet weiß, ihre Botschaft allen Völkern zu verkündigen, muß sich unbedingt für die Glaubensfreiheit einsetzen. Sie will die Gabe der Wahrheit, die für alle Menschen da ist, weitergeben und sichert gleichzeitig den Völkern und ihren Regierungen zu, damit nicht ihre Identität und ihre Kulturen zerstören zu wollen; sie gibt ihnen im Gegenteil die Antwort, auf die sie im Innersten warten – eine Antwort, die die Vielfalt der Kulturen nicht zerstört, sondern die Einheit unter den Menschen und damit auch den Frieden unter den Völkern vermehrt.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat durch die Neubestimmung des Verhältnisses zwischen dem Glauben der Kirche und bestimmten Grundelementen des modernen Denkens einige in der Vergangenheit gefällte Entscheidungen neu überdacht oder auch korrigiert, aber trotz dieser scheinbaren Diskontinuität hat sie ihre wahre Natur und ihre Identität bewahrt und vertieft. Die Kirche war und ist vor und nach dem Konzil dieselbe eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, die sich auf dem Weg durch die Zeiten befindet; sie »schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin« und verkündet den Tod des Herrn, bis er wiederkommt (vgl. Lumen gentium, 8). Wenn jemand erwartet hatte, daß das grundsätzliche »Ja« zur Moderne alle Spannungen lösen und die so erlangte »Öffnung gegenüber der Welt« alles in reine Harmonie verwandeln würde, dann hatte er die inneren Spannungen und auch die Widersprüche innerhalb der Moderne unterschätzt; er hatte die gefährliche Schwäche der menschlichen Natur unterschätzt, die in allen Geschichtsperioden und in jedem historischen Kontext eine Bedrohung für den Weg des Menschen darstellt. Diese Gefahren sind durch das Vorhandensein neuer Möglichkeiten und durch die neue Macht des Menschen über die Materie und über sich selbst nicht verschwunden, sondern sie nehmen im Gegenteil neue Ausmaße an: Dies zeigt ein Blick auf die gegenwärtige Geschichte sehr deutlich. Auch in unserer Zeit bleibt die Kirche ein »Zeichen, dem widersprochen wird« (Lk 2,34) – diesen Titel hatte Papst Johannes Paul II. nicht ohne Grund noch als Kardinal den Exerzitien gegeben, die er 1976 für Papst Paul VI. und die Römische Kurie hielt. Es konnte nicht die Absicht des Konzils sein, diesen Widerspruch des Evangeliums gegen die Gefahren und Irrtümer des Menschen aufzuheben. Zweifellos wollte es dagegen Gegensätze beseitigen, die auf Irrtümern beruhten oder überflüssig waren, um unserer Welt den Anspruch des Evangeliums in seiner ganzen Größe und Klarheit zu zeigen. Der Schritt, den das Konzil getan hat, um auf die Moderne zuzugehen, und der sehr unzulänglich als »Öffnung gegenüber der Welt« bezeichnet wurde, gehört letztendlich zum nie endenden Problem des Verhältnisses von Glauben und Vernunft, das immer wieder neue Formen annimmt. Die Situation, der das Konzil gegenüberstand, kann man ohne Weiteres mit Vorkommnissen früherer Epochen vergleichen. Der hl. Petrus hatte in seinem ersten Brief die Christen ermahnt, bereit zu sein, jedem eine Antwort (»apo-logia«) zu geben, der sie nach ihrem »logos«, nach dem Grund für ihren Glauben, frage (vgl. 3,15). Das hieß, daß der biblische Glaube mit der griechischen Kultur ins Gespräch treten, eine Beziehung zu ihr aufbauen und durch deren Deutung lernen mußte, sowohl das Trennende als auch die Berührungspunkte und Affinitäten unter ihnen in der einen gottgegebenen Vernunft zu erkennen. Als im 13. Jahrhundert durch jüdische und arabische Philosophen das aristotelische Gedankengut mit dem mittelalterlichen Christentum, das in der platonischen Tradition stand, in Berührung kam, und Glaube und Vernunft Gefahr liefen, in unüberwindlichen Widerspruch zueinander zu treten, war es vor allem der hl. Thomas von Aquin, der im Aufeinandertreffen von Glauben und aristotelischer Philosophie eine Vermittlerrolle einnahm und so den Glauben in positive Beziehung stellte zu der Form der vernunftgemäßen Argumentation, die zu seiner Zeit herrschte. Das mühsame Streitgespräch zwischen moderner Vernunft und christlichem Glauben, das mit dem Prozeß gegen Galilei zuerst unter negativem Vorzeichen begonnen hatte, kannte natürlich viele Phasen, aber mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil kam die Stunde, in der ein Überdenken auf breiter Basis erforderlich geworden war. Sein Inhalt ist in den Konzilstexten natürlich nur in groben Zügen dargelegt, aber die Richtung ist damit im Wesentlichen festgelegt, so daß der Dialog zwischen Vernunft und Glauben, der heute besonders wichtig ist, aufgrund des Zweiten Vaticanums seine Orientierung gefunden hat. Jetzt muß dieser Dialog weitergeführt werden, und zwar mit großer Offenheit des Geistes, aber auch mit der klaren Unterscheidung der Geister, was die Welt aus gutem Grund gerade in diesem Augenblick von uns erwartet. So können wir heute mit Dankbarkeit auf das Zweite Vatikanische Konzil zurückblicken: Wenn wir es mit Hilfe der richtigen Hermeneutik lesen und rezipieren, dann kann es eine große Kraft für die stets notwendige Erneuerung der Kirche sein und immer mehr zu einer solchen Kraft werden.
Abschließend muß ich vielleicht noch jenen 19. April dieses Jahres erwähnen, an dem das Kardinalskollegium mich zu meinem nicht geringen Schrecken zum Nachfolger von Papst Johannes Paul II., zum Nachfolger des hl. Petrus auf dem Bischofsstuhl von Rom, gewählt hat. Eine solche Aufgabe lag jenseits all dessen, was ich mir jemals als meine Berufung hätte vorstellen können. So konnte ich nur mit einem tiefen Akt des Vertrauens auf Gott im Gehorsam mein »Ja« zu dieser Wahl sagen. Wie damals, so bitte ich auch heute euch alle um euer Gebet, auf dessen Kraft und Hilfe ich zähle. Gleichzeitig möchte ich in dieser Stunde all jenen von Herzen danken, die mich mit soviel Vertrauen, Güte und Verständnis aufgenommen haben und mich noch immer aufnehmen und mich tagtäglich mit ihrem Gebet begleiten.
Das Weihnachtsfest ist schon nahe. Gott, der Herr, ist den Gefahren, die in der Geschichte drohten, nicht mit äußerer Gewalt entgegengetreten, wie wir Menschen es aus unserer weltlichen Perspektive heraus erwartet hätten. Seine Waffe ist die Güte. Er hat sich als Kind offenbart, das in einem Stall geboren wurde. Genau so tritt er mit seiner ganz anders gearteten Macht der zerstörerischen Gewalt entgegen. Genau so rettet er uns. Genau so zeigt er uns das, was Rettung bringt. Wir wollen ihm in diesen Weihnachtstagen wie die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland vertrauensvoll entgegengehen. Bitten wir Maria, uns zum Herrn zu führen. Bitten wir ihn selbst, daß er sein Angesicht über uns leuchten lasse. Bitten wir ihn, daß er die Gewalt in der Welt überwinden und uns die Macht seiner Güte erfahren lassen möge. Mit diesen Empfindungen erteile ich euch allen von Herzen den Apostolischen Segen.<ref> Die deutsche Fassung auf der Vatikanseite aus dem Jahre 2005; auch in: VAS 172.</ref>
2006
am 22. Dezember
hochwürdige Mitbrüder im Bischofs- und Priesteramt,
Mit großer Freude begegne ich Ihnen heute und richte an jeden meinen herzlichen Gruß. Ich danke Ihnen, daß Sie zu diesem traditionellen vorweihnachtlichen Treffen gekommen sind. Im besonderen danke ich Kardinal Angelo Sodano für seine Worte, mit denen er, ausgehend von dem zentralen Thema der Enzyklika Deus caritas est, die Gesinnung aller Anwesenden zum Ausdruck gebracht hat. Bei dieser bedeutsamen Gelegenheit möchte ich ihm erneut meine Dankbarkeit ausdrücken für den Dienst, den er so viele Jahre lang - vor allem als Staatssekretär - dem Papst und dem Heiligen Stuhl geleistet hat. Ich bitte den Herrn, ihm das Gute zu lohnen, das er mit seiner Weisheit und seinem Eifer für die Sendung der Kirche vollbracht hat. Zugleich möchte ich einen erneuten besonderen Glückwunsch an Kardinal Tarcisio Bertone richten für die neue Aufgabe, die ich ihm übertragen habe. Gerne dehne ich diese meine guten Wünsche auf alle aus, die im Laufe dieses Jahres in den Dienst der Römische Kurie oder des Governatoratos eingetreten sind, während wir mit Liebe und Dankbarkeit derer gedenken, die der Herr aus diesem Leben zu sich gerufen hat.
Das Jahr, das sich dem Ende zuneigt – Sie haben es schon gesagt, Eminenz –, bleibt in unserem Erinnern tief geprägt durch die Schrecknisse des Krieges im Umkreis des Heiligen Landes wie ganz allgemein durch die Gefahr eines Zusammenstoßes von Kulturen und Religionen, die als Drohung über unserer geschichtlichen Stunde steht. Die Frage nach den Wegen zum Frieden ist so zu einer vordringlichen Herausforderung geworden für alle, die sich um den Menschen sorgen. Sie geht in besonderer Weise die Kirche an, für die die Verheißung, die über ihrem Beginn stand, Verantwortung und Aufgabe zugleich bedeutet: Herrlichkeit für Gott in der Höhe und Friede für die Menschen auf Erden, die in seinem Wohlgefallen stehen (Lk 2, 14).
Dieses Grußwort des Engels an die Hirten in der Nacht der Geburt Jesu zu Bethlehem weist auf einen unlöslichen Zusammenhang zwischen dem Verhältnis der Menschen zu Gott und ihrem Verhältnis untereinander hin. Der Friede auf Erden kann nicht gefunden werden ohne die Versöhnung mit Gott, ohne den Einklang zwischen Himmel und Erde. Diese Zusammengehörigkeit des Themas „Gott“ und des Themas „Friede“ war der bestimmende Gesichtspunkt bei den vier Apostolischen Reisen dieses Jahres, auf die ich in dieser Stunde noch einmal zurückblicken möchte. Da war zunächst der Pastoralbesuch in Polen, in dem Geburtsland unseres geliebten Papstes Johannes’ Pauls II. Die Reise in seine Heimat war für mich eine innere Pflicht des Dankes für alles, was er mir persönlich und vor allem für das, was er der Kirche und der Welt im Vierteljahrhundert seines Dienstes geschenkt hat. Sein größtes Geschenk an uns alle war sein unerschütterlicher Glaube und die Radikalität seiner Hingabe. „Totus tuus“ hieß sein Wahlspruch, in dem sich sein ganzes Wesen spiegelte. Ja, er war uneingeschränkt hingegeben an Gott, an Christus, an die Mutter Christi, an die Kirche, an den Dienst für den Erlöser und die Erlösung des Menschen. Er hat nichts ausgespart, sich von der Flamme des Glaubens bis auf den Grund verzehren lassen. Er hat uns gezeigt, wie man als Mensch dieses unseres Heute an Gott glauben kann, an den lebendigen, in Christus uns nahe gewordenen Gott. Er hat uns gezeigt, daß endgültige und radikale Hingabe des ganzen Lebens möglich ist und daß gerade im Sich-Geben das Leben groß und weit und fruchtbar wird. In Polen habe ich überall, wo ich hinging, die Freude des Glaubens vorgefunden. „Die Freude am Herrn ist eure Stärke“ – dieses Wort, das der Schriftgelehrte Esra dem gerade aus dem Exil heimgekehrten Israel mitten in der Armseligkeit seines Neubeginns zugerufen hat (Neh 8, 10), - es war hier als Wirklichkeit zu erleben. Zutiefst beeindruckt bin ich geblieben von der großen Herzlichkeit, mit der ich allerorten empfangen worden bin. Die Menschen sahen in mir den Nachfolger Petri, dem der Hirtendienst für die ganze Kirche aufgetragen ist. Sie sahen denjenigen, dem in aller menschlichen Schwachheit heute wie damals das Wort des auferstandenen Herrn gilt: „Weide meine Schafe“ (Joh 21, 15 – 19); den Nachfolger dessen, zu dem Jesus bei Caesarea Philippi sagte: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen“ (Mt 16, 18). Petrus war aus Eigenem kein Fels, sondern ein schwacher und schwankender Mensch. Aber der Herr wollte gerade ihn zum Felsen machen und zeigen, daß er selber durch einen schwachen Menschen hindurch seine Kirche unerschütterlich trägt und in der Einheit erhält. So ist der Besuch in Polen für mich im tiefsten ein Fest der Katholizität gewesen. Christus ist unser Friede, der die Getrennten zusammenfügt; er ist die Versöhnung über alle Verschiedenheit der geschichtlichen Zeiten und der Kulturen hin. Durch den Petrusdienst erleben wir diese vereinigende Kraft des Glaubens, der immer wieder in den vielen Völkern das eine Volk Gottes aufbaut. Wir haben es mit Freuden wirklich erfahren, daß wir aus vielen Völkern das eine Volk Gottes, seine heilige Kirche sind. Dafür darf der Petrusdienst als sichtbares Zeichen stehen, das diese Universalität verbürgt und konkrete Einheit gestaltet. Für diese bewegende Erfahrung der Katholizität möchte ich der Kirche in Polen noch einmal ausdrücklich und herzlich danken.
Bei meinen Wegen durch Polen konnte der Besuch in Auschwitz-Birkenau nicht fehlen, an der Stätte der grausamsten Unmenschlichkeit – des Versuchs, das Volk Israel auszulöschen und so auch die Erwählung Gottes zuschanden zu machen, Gott selbst aus der Geschichte zu verbannen. Es war für mich ein großer Trost, als am Himmel ein Regenbogen erschien, während ich in der Gebärde des Ijob zu Gott rief angesichts des Grauens dieser Stätte, im Schrecken über die scheinbare Abwesenheit Gottes und zugleich in der Gewißheit, daß er auch in seinem Schweigen nicht aufhört, bei uns zu sein und zu bleiben. Der Regenbogen war wie eine Antwort: Ja, ich bin da, und die Worte der Verheißung, des Bundes, die ich nach der Sündflut gesprochen habe, gelten auch heute (vgl. Gen 9, 12 – 17).
Die Reise nach Spanien – Valencia – stand ganz im Zeichen des Themas „Ehe und Familie“. Es war schön, vor der Versammlung von Menschen aus allen Kontinenten das Zeugnis von Ehepaaren zu vernehmen, die – mit einer großen Schar von Kindern gesegnet – vor uns hintraten und von ihrem Weg im Sakrament der Ehe und als kinderreiche Familien sprachen. Sie haben nicht verheimlicht, daß es auch schwere Tage gab, daß sie Zeiten der Krise durchschreiten mußten. Aber gerade in der Mühe des täglichen Einander-Ertragens, gerade im Erleiden der Mühsal, sich immer neu anzunehmen und das Ja des Anfangs durchzuleben und durchzuleiden – gerade in diesem Weg des „Sich-Verlierens“ im Sinne des Evangeliums waren sie gereift, hatten sie sich selbst gefunden und waren glücklich geworden. Das Ja zueinander, das sie sich gegeben hatten, war in der Geduld des Weges und in der Kraft des Sakramentes, durch das Christus sie aneinander band, zu einem großen Ja zu sich selbst, zu den Kindern, zum Schöpfergott und zum Erlöser Jesus Christus geworden. So kam vom Zeugnis dieser Familien her eine Welle der Freude zu uns – nicht einer oberflächlichen und billigen Fröhlichkeit, die schnell zerrinnt, sondern einer auch im Leiden gereiften Freude, die in die Tiefe geht und den Menschen wirklich erlöst. Angesichts dieser Familien mit den Kindern, in denen sich die Generationen die Hände geben und Zukunft Gegenwart ist, ist mir die Frage nach Europa in die Seele gedrungen, das anscheinend kaum noch Kinder will. Für den Außenstehenden scheint es müde zu sein, ja, sich selbst von der Geschichte verabschieden zu wollen. Warum ist das so? Das ist die große Frage. Die Antworten darauf müssen sicher sehr vielschichtig sein. Bevor solche Antworten versucht werden, ist zuallererst der Dank an die vielen Ehepaare nötig, die auch heute, in unserem Europa, Ja sagen zum Kind und die die Mühen auf sich nehmen, die damit verbunden sind: die sozialen und die finanziellen Probleme wie die Sorgen und Mühen Tag um Tag; die Hingabe, die nötig ist, um den Kindern den Weg in die Zukunft zu öffnen. Mit dem Andeuten dieser Mühsale zeigen sich wohl auch die Gründe, warum das Wagnis des Kindes so vielen zu groß erscheint. Das Kind braucht Zuwendung. Das bedeutet: Wir müssen ihm etwas von unserer Zeit geben, Zeit unseres Lebens. Aber gerade dieser wesentliche „Rohstoff“ des Lebens – die Zeit – scheint immer knapper zu werden. Die Zeit, die wir haben, reicht kaum aus für das eigene Leben; wie sollten wir sie abtreten, sie jemand anderem geben? Zeit haben und Zeit geben – das ist eine ganz praktische Weise, wie wir erlernen müssen, uns selber zu geben, uns zu verlieren, um uns zu finden. Dazu kommt das schwierige Kalkül: Welche Vorgaben des rechten Weges sind wir dem Kind schuldig, und wie müssen wir dabei seine Freiheit achten? Das Problem ist auch deshalb so schwierig geworden, weil wir der Vorgaben nicht mehr sicher sind; weil wir nicht mehr wissen, was der rechte Gebrauch der Freiheit, was die rechte Weise des Lebens, was das sittlich Gebotene und das Unzulässige ist. Der moderne Geist ist orientierungslos geworden, und diese eigene Orientierungslosigkeit hindert uns, anderen Wegweiser zu sein. Ja, die Problematik reicht noch tiefer. Der Mensch von heute ist der Zukunft unsicher. Kann man jemand in diese unbekannte Zukunft hineinschicken? Ist es überhaupt gut, ein Mensch zu sein? Diese tiefe Unsicherheit über den Menschen selbst ist – neben dem Willen, das Leben ganz für sich zu haben – wohl der tiefste Grund, warum das Wagnis des Kindes vielen kaum noch vertretbar scheint. In der Tat, das Leben können wir verantwortungsvoll nur weitergeben, wenn wir mehr zu geben vermögen als das bloß biologische Leben – einen Sinn, der auch in den Krisen der kommenden Geschichte trägt und eine Gewißheit der Hoffnung, die stärker ist als die Wolken, die über der Zukunft stehen. Wenn wir nicht neu die Gründe des Lebens erlernen – wenn wir nicht die Gewißheit des Glaubens neu finden – dann werden wir auch immer weniger den anderen die Gabe des Lebens und den Auftrag der unbekannten Zukunft anvertrauen können. Damit hängt schließlich noch das Problem endgültiger Entscheidungen zusammen: Kann der Mensch sich für immer binden? Kann er ein Ja auf Lebenszeit sagen? Ja, er kann es. Er ist dazu geschaffen. Gerade so verwirklicht sich des Menschen Freiheit, und so entsteht auch der heilige Raum der Ehe, die zur Familie wächst und Zukunft baut.
An dieser Stelle kann ich meine Beunruhigung über die Gesetze bezüglich der De-facto-Partnerschaften nicht verschweigen. Ein Großteil dieser Paare hat diesen Weg gewählt, weil sie sich – jedenfalls im Augenblick – nicht imstande fühlen, die rechtlich geordnete und bindende Gemeinschaft der Ehe anzunehmen. So ziehen sie es vor, im bloßen Faktum zu bleiben. Wenn nun eine neue Art von Rechtsform geschaffen und damit die Ehe relativiert wird, erhält der Verzicht auf die endgültige Bindung sozusagen ein rechtliches Siegel. Das Sich-Entscheiden wird dann für die, die darum ringen, noch schwieriger. Dazu kommt die Relativierung der Geschlechter-Differenz bei dieser anderen Form der Partnerschaft. Es ist nun gleich, ob es sich um das Miteinander von Mann und Frau oder um gleichgeschlechtliche Verbindungen handelt. Damit wird im stillen jenen verhängnisvollen Theorien recht gegeben, die das Mann-Sein und Frau-Sein des Menschen als bloße Biologie abqualifizieren; die uns sagen, der Mensch – das heißt sein Intellekt und sein Wille – entscheide selbst, was er sei oder nicht sei. Das ist eine Verhöhnung der Leiblichkeit, in der der Mensch sich von seinem Leib – von der „biologischen Sphäre“ – emanzipieren will und sich dabei nur selbst zerstören kann. Wenn man uns sagt, die Kirche dürfe sich da nicht einmischen, dann können wir nur antworten: Geht uns etwa der Mensch nichts an? Haben die Gläubigen von der großen Kultur ihres Glaubens her kein Recht, da mitzureden? Ist es nicht vielmehr ihre, unsere Pflicht, da die Stimme zu erheben und den Menschen, jenes Geschöpf zu verteidigen, das gerade in der Untrennbarkeit von Leib und Seele Gottes Ebenbild ist? Die Reise nach Valencia ist mir zu einer Reise nach der Frage des Menschseins geworden.
Fahren wir im Geiste weiter nach Bayern – München, Altötting, Regensburg, Freising. Dort habe ich unvergeßlich schöne Tage der Begegnung mit dem Glauben und den Gläubigen meiner Heimat erleben dürfen. Das große Thema meiner Deutschland-Reise war Gott. Die Kirche muß über vieles sprechen – über all die Fragen des Menschseins, über ihre eigene Gestalt und Ordnung usw. Aber ihr eigentliches und in gewisser Hinsicht einziges Thema ist „Gott“. Und das große Problem der westlichen Welt ist die sich ausbreitende Gott-Vergessenheit. Im letzten lassen sich – davon bin ich überzeugt – alle Einzelprobleme auf diese Frage zurückführen. Darum ging es mir in dieser Reise vor allem darum, das Thema „Gott“ groß herauszustellen, auch eingedenk der Tatsache, daß in manchen Teilen Deutschlands eine Mehrheit von Ungetauften lebt, für die das Christentum und der Gott des Glaubens der Vergangenheit anzugehören scheinen. Von Gott sprechend sind wir auch genau bei dem, worum es Jesus in seiner irdischen Verkündigung zentral gegangen ist. Das Grundthema seiner Verkündigung ist die Herrschaft Gottes, das „Reich Gottes“. Damit ist nicht etwas irgendwann in einer unbestimmten Zukunft Kommendes gemeint. Damit ist auch nicht die bessere Welt gemeint, die wir allmählich durch unsere eigene Kraft zu schaffen versuchen. In dem Wort „Reich Gottes“ ist das Wort „Gott“ ein sogenannter Genitiv des Subjekts. Das bedeutet: Gott ist nicht eine Zutat zum „Reich“, die man vielleicht auch weglassen könnte. Gott ist das Subjekt. „Reich Gottes“ heißt in Wirklichkeit: Gott herrscht. Er selbst ist da und ist bestimmend für die Menschen in der Welt. Er ist das Subjekt, und wo dieses Subjekt fehlt, bleibt nichts von der Botschaft Jesu übrig. Darum sagt uns Jesus: Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man sich sozusagen daneben stellen und bei seinem Kommen zuschauen kann. „Es ist mitten unter euch“ (vgl. Lk 17, 20f). Es wird da, wo Gottes Wille geschieht. Es ist da, wo Menschen sich seiner Ankunft öffnen und damit Gott in die Welt einlassen. Darum ist Jesus das Reich Gottes in Person: der Mensch, in dem Gott in unserer Mitte ist und durch den wir Gott anrühren, in die Nähe Gottes kommen können. Wo dies geschieht, wird die Welt heil.
Mit dem Thema „Gott“ waren und sind zwei Themen verknüpft, die die Tage des Besuchs in Bayern prägten: das Thema „Priestertum“ und das Thema „Dialog“. Paulus nennt den Timotheus und in ihm den Bischof und Priester überhaupt einen „Gottesmenschen“ (1 Tim 6, 11). Dies ist die zentrale Aufgabe des Priesters: Gott zu den Menschen zu bringen. Das kann er freilich nur, wenn er selbst von Gott her kommt, mit Gott und von Gott her lebt. Wunderbar ist das ausgedrückt in dem Vers eines Priester-Psalms, den wir – die alte Generation – bei der Aufnahme in den Klerikerstand gesprochen haben: „Du, Herr, bist mein Erbe und reichst mir den Becher; du hältst mein Los in deinen Händen“ (Ps 15 [16], 5). Der priesterliche Beter dieses Psalms deutet seine Existenz von der im Deuteronomium (10, 9) festgelegten Form der Landverteilung her. Jeder Stamm erhält nach der Landnahme durch das Los seinen Teil am heiligen Land und bekommt damit Anteil an der dem Stammvater Abraham verheißenen Gabe. Nur der Stamm Levi erhält kein Land: Sein Land ist Gott selbst. Diese Aussage hatte gewiß eine ganz praktische Bedeutung. Die Priester lebten nicht wie die anderen Stämme vom Bebauen des Landes, sondern von den Opfergaben. Aber die Aussage reicht doch viel tiefer. Der eigentliche Lebensgrund des Priesters, der Boden seiner Existenz, das Land seines Lebens, ist Gott selbst. Die Kirche hat in dieser alttestamentlichen Deutung priesterlicher Existenz, die auch im Psalm 118 (119) immer wieder aufscheint, mit Recht die Interpretation dafür gefunden, was priesterliche Sendung in der Nachfolge der Apostel, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus selbst bedeutet. Der Priester kann und muß auch heute mit dem Leviten sagen: Dominus pars heriditatis meae et calicis mei. Gott selbst ist mein Anteil am Land, der äußere und innere Grund meiner Existenz. Diese Theozentrik der priesterlichen Existenz ist gerade in unserer ganz funktionalistischen Welt nötig, in der alles auf errechenbaren und greifbaren Leistungen beruht. Der Priester muß wirklich Gott von innen her kennen und ihn so zu den Menschen bringen: Das ist der allererste Dienst, den die Menschheit heute braucht. Wenn in einem priesterlichen Leben diese Zentralität Gottes verlorengeht, dann wird auch der Eifer des Tuns allmählich leer. Im Übermaß des Äußeren fehlt die Mitte, die allem Sinn gibt und es zur Einheit fügt. Da fehlt der Lebensgrund, das „Land“, auf dem dies alles stehen und gedeihen kann.
Der Zölibat, die Ehelosigkeit der Priester, die in der ganzen Kirche aus Ost und West für die Bischöfe und gemäß einer bis nah an die Apostelzeit heranreichenden Tradition in der lateinischen Kirche für die Priester überhaupt gilt, kann letztlich nur von hier aus verstanden und gelebt werden. Die bloß pragmatischen Begründungen, der Hinweis auf die größere Verfügbarkeit reichen nicht aus: Solches Verfügen über die Zeit könnte leicht auch zum Egoismus werden, der sich die Opfer und Mühsale erspart, die das tägliche Einander-Annehmen und Ertragen in Ehe und Familie verlangt; es würde dann zu geistlicher Verarmung oder zu seelischer Härte führen. Der wirkliche Grund für den Zölibat kann nur in dem Satz liegen: Dominus pars – Du bist mein Land. Er kann nur theozentrisch sein. Er kann nicht bedeuten, der Liebe leer zu bleiben, sondern muß bedeuten, sich von der Leidenschaft für Gott ergreifen zu lassen und im innersten Sein mit ihm dann zugleich den Menschen dienen zu lernen. Zölibat muß ein Zeugnis des Glaubens sein: Glaube an Gott wird konkret in der Lebensform, die nur von Gott her Sinn hat. Das Leben auf ihn setzen, unter Verzicht auf Ehe und Familie, das sagt aus, daß ich Gott als Wirklichkeit annehme und erfahre und ihn deshalb zu den Menschen bringen kann. Unsere ganz positivisitisch gewordene Welt, in der Gott allenfalls als Hypothese, aber nicht als praktische Wirklichkeit ins Spiel kommt, braucht dieses Setzen auf Gott in der konkretesten und radikalsten Weise, die möglich ist. Sie braucht das Gotteszeugnis des Entscheids, Gott als Boden des eigenen Lebens anzunehmen. Darum ist der Zölibat gerade heute in unserer gegenwärtigen Welt wichtig, auch wenn seine Erfüllung in unserer Gegenwart immerfort bedroht und gefährdet ist. Es bedarf sorgfältiger Vorbereitung auf dem Weg dahin; immerwährender Wegbegleitung durch den Bischof, die priesterlichen Freunde und durch Laien, die dieses priesterliche Zeugnis mittragen. Es bedarf des Gebetes, das Gott immerfort als den lebendigen Gott ruft und sich an ihn in Stunden der Verwirrung wie in Stunden der Freude hält. So kann gegen den kulturellen Trend, der uns unsere Fähigkeit zu solchen Entscheidungen ausreden will, dieses Zeugnis gelebt und damit Gott als Realität in unserer Welt ins Spiel gebracht werden.
Das andere große Thema, das mit dem Thema „Gott“ verbunden ist, lautet „Dialog“. Der innere Ring des heute nötigen vielschichtigen Dialogs, das gemeinsame Mühen aller Christen um Einheit, wurde in der ökumenischen Vesper im Regensburger Dom sichtbar, bei der ich neben den Brüdern und Schwestern der katholischen Kirche vielen Freunden aus der Orthodoxie und aus der evangelischen Christenheit begegnen durfte. Im Psalmengebet und im Hören auf Gottes Wort waren wir dort alle vereinigt, und es ist nichts Geringes, daß uns diese Einheit geschenkt ist. Die Begegnung mit der Universität war – wie es sich an diesem Ort ziemt – dem Dialog zwischen Glaube und Vernunft gewidmet. Bei meiner Begegnung mit dem Philosophen Jürgen Habermas vor einigen Jahren in München hatte dieser geäußert, es seien Denker notwendig, die die im christlichen Glauben verschlüsselten Einsichten in die Sprache der säkularen Welt zu übersetzen vermöchten, um sie so auf neue Weise zur Wirkung zu bringen. In der Tat wird immer offenkundiger, wie dringend die Welt des Dialogs zwischen Glaube und Vernunft bedarf. Immanuel Kant hatte seinerzeit das Wesen der Aufklärung in dem Spruch „sapere aude“ ausgesprochen gesehen: als den Mut des Denkens, das sich durch keine Vorurteile beirren läßt. Nun, das Erkennen des Menschen, seine Beherrschung der Materie durch die Kraft des Erkennens hat inzwischen Fortschritte gemacht, die man sich ehedem nicht hätte vorstellen können. Aber die Macht des Menschen, die ihm von der Wissenschaft her zugewachsen ist, wird immer mehr zu einer Gefahr, die ihn selbst und die Welt bedroht. Die ganz auf das Beherrschen der Welt gerichtete Vernunft akzeptiert keine Grenzen mehr. Sie ist dabei, den Menschen selbst nur noch als Materie ihres Produzierens und Könnens zu behandeln. Unser Erkennen wächst, aber zugleich gibt es eine Erblindung der Vernunft für ihre eigenen Gründe; für die Maßstäbe, die ihr Richtung und Sinn geben. Der Glaube an den Gott, der selbst die schöpferische Vernunft des Ganzen ist, muß von der Wissenschaft neu als Herausforderung und als Chance angenommen werden. Umgekehrt muß dieser Glaube seine innere Weite und seine eigene Vernunft neu erkennen. Die Vernunft braucht den Logos, der am Anfang steht und unser Licht ist; der Glaube seinerseits braucht das Gespräch mit der modernen Vernunft, damit er seine Größe wahrnimmt und seiner Verantwortung gerecht wird. Das habe ich in der Regensburger Vorlesung zu zeigen versucht. Es ist eine Frage, die beileibe nicht nur akademischer Natur ist; in ihr geht es um unser aller Zukunft.
Der Dialog der Religionen war dabei nur am Rand zur Sprache gekommen und in einem zweifachen Sinn anvisiert. Die bloß säkulare Vernunft ist nicht imstande, in einen wirklichen Dialog mit den Religionen zu treten. Bleibt sie der Gottesfrage gegenüber verschlossen, so führt dies zum Zusammenstoß der Kulturen. Der andere Aspekt bestand in der Aussage, daß die Religionen einander begegnen müssen in der gemeinsamen Aufgabe, im Dienst der Wahrheit und so des Menschen zu stehen. Der Besuch in der Türkei gab mir die Gelegenheit, die Ehrfurcht vor der islamischen Religion auch öffentlich darzustellen, die uns im übrigen vom II. Vatikanischen Konzil als verpflichtende Einsicht auf den Weg gegeben worden ist (vgl. Erkl. Nostra Aetate, 3). Ich möchte in diesem Augenblick noch einmal meine Dankbarkeit den Autoritäten der Türkei und dem türkischen Volk gegenüber ausdrücken, das mich mit so großer Gastfreundschaft aufgenommen und mir unvergeßliche Tage der Begegnung geschenkt hat. Bei einem verstärkt zu führenden Dialog mit dem Islam werden wir vor Augen halten müssen, daß die islamische Welt heute mit großer Dringlichkeit sich vor einer ganz ähnlichen Aufgabe findet, wie sie den Christen seit der Aufklärung auferlegt ist und vom II. Vatikanischen Konzil als Frucht eines langen Ringens für die katholische Kirche zu konkreten Lösungen geführt wurde. Es geht um die Stellung der Gemeinschaft der Glaubenden angesichts der Einsichten und Forderungen, die in der Aufklärung gewachsen sind. Einerseits gilt es, einer Diktatur der positivistischen Vernunft zu widersprechen, die Gott aus dem Leben der Gemeinschaft und aus den öffentlichen Ordnungen ausschließt und dabei den Menschen seiner Maßstäbe beraubt. Andererseits müssen die wahren Errungenschaften der Aufklärung, die Menschenrechte und dabei besonders die Freiheit des Glaubens und seiner Ausübung als wesentliche Elemente gerade auch für die Authentizität der Religion aufgenommen werden. Wie es in der christlichen Gemeinschaft ein langes Ringen um den rechten Standort des Glaubens diesen Einsichten gegenüber gab, das freilich nie ganz zu Ende ist, so steht auch die islamische Welt mit ihrer eigenen Überlieferung vor der großen Aufgabe, hier die angemessenen Lösungen zu finden. Inhalt des Dialogs von Christen und Muslimen wird es in diesem Augenblick vor allem sein müssen, sich in diesem Mühen zu begegnen und die rechten Lösungen zu finden. Die Gottvergessenheit des Westens dient heute gewissen Kräften in der islamischen Welt als Vorwand, Gewalt als Teil der Religion zu propagieren. Wir Christen wissen uns solidarisch mit all denen, die gerade von ihrer religiösen Überzeugung als Muslime her gegen die Gewalt und für das Miteinander von Glaube und Vernunft, von Religion und Freiheit eintreten. In diesem Sinn greifen die beiden Dialoge, von denen ich sprach, eng ineinander.
In Istanbul konnte ich schließlich in der Begegnung mit dem ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. noch einmal beglückende Stunden ökumenischer Nähe erleben. Patriarch Bartholomaios hat in diesen Tagen einen Brief an mich geschrieben, in dessen zutiefst von Herzen kommenden Worten der Dankbarkeit mir das Miteinander jener Tage noch einmal ganz gegenwärtig geworden ist. Wir haben es erlebt, daß wir nicht nur den Worten und der Geschichte nach, sondern von innen her Brüder sind; daß uns der gemeinsame Glaube der Apostel bis in unser persönliches Denken und Fühlen verbindet. Wir haben eine tiefe Einheit im Glauben erfahren und werden den Herrn noch inständiger bitten, daß er uns bald auch die volle Einheit im gemeinsamen Brotbrechen schenkt. Mein tiefer Dank und mein brüderliches Beten geht in dieser Stunde zu Patriarch Bartholomaios und zu seinen Gläubigen wie zu den verschiedenen christlichen Gemeinden, die ich in Istanbul treffen durfte. Wir hoffen und beten, daß die religiöse Freiheit, die dem inneren Wesen des Glaubens entspricht und in den Prinzipien der türkischen Verfassung anerkannt wird, immer mehr in den geeigneten rechtlichen Formen wie im Leben des Alltags für das Patriarchat und die übrigen christlichen Gemeinschaften praktische Verwirklichung findet.
Et erit iste pax – dieser wird der Friede sein, sagt der Prophet Micha (5, 4) über den künftigen Herrscher Israels, dessen Geburt in Bethlehem er ankündigt. Den Hirten, die auf den Feldern um Bethlehem ihre Schafe weideten, haben die Engel gesagt: Der Verheißene ist da. „Friede den Menschen auf Erden“ (Lk 2, 14). Er selbst – Christus, der Herr – hat seinen Jüngern gesagt: „Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch“ (Joh 14, 27). Aus diesen Worten ist der liturgische Gruß geworden: „Der Friede sei mit euch“. Dieser Friede, der in der Liturgie mitgeteilt wird, ist Christus selbst. Er schenkt sich uns als der Friede, als die Versöhnung über alle Grenzen hin. Wo er aufgenommen wird, wachsen Inseln des Friedens. Wir Menschen hätten uns gewünscht, daß Christus alle Kriege ein für alle Mal verbannen, die Waffen zerbrechen und den Weltfrieden wiederherstellen würde. Aber wir müssen lernen, daß der Friede durch Strukturen von außen her allein nicht erreicht werden kann und daß der Versuch, ihn mit Gewalt herzustellen, nur zu immer neuer Gewalt führt. Wir müssen lernen, daß der Friede – wie es der Engel von Bethlehem sagte – mit der Eudokia zusammenhängt, mit dem Offenwerden unserer Herzen für Gott. Wir müssen lernen, daß Friede nur sein kann, wenn der Haß und die Eigensucht von innen her überwunden werden. Der Mensch muß von seinem Innern her erneuert, neu und anders werden. So bleibt der Friede in dieser Welt immer schwach und zerbrechlich. Wir leiden darunter. Uns ist um so mehr aufgetragen, uns innerlich vom Frieden Gottes durchdringen zu lassen, seine Kraft in die Welt hineinzutragen. In unserem Leben muß Wirklichkeit werden, was in der Taufe sakramental an uns geschehen ist: das Sterben des alten Menschen und so das Auferstehen des neuen. Und immer wieder werden wir den Herrn mit aller Dringlichkeit bitten: Rüttle du die Herzen auf! Mache uns zu neuen Menschen! Hilf, daß die Vernunft des Friedens die Unvernunft der Gewalt überwindet! Mache uns zu Trägern deines Friedens!
Diese Gnade erwirke uns die Jungfrau Maria, der ich Sie und Ihre Arbeit anempfehle. Jedem von Ihnen, die Sie hier zugegen sind, sowie allen, die Ihnen nahestehen, spreche ich erneut meine tief empfundenen Glückwünsche aus. Von Herzen erteile ich Ihnen den Apostolischen Segen, den ich auf die Mitarbeiter der verschiedenen Dikasterien und Büros der Römischen Kurie sowie des Governatoratos des Vatikanstaates ausdehne. Frohe Weihnachten und beste Wünsche auch für das Neue Jahr!<ref> Die deutsche Fassung auf der Vatikanseite aus dem Jahre 2006</ref>
2007
am 21. Dezember im Clementina-Saal
hochwürdige Mitbrüder im Bischofs- und Priesteramt,
In dieser Begegnung empfinden wir bereits die Freude des schon nahen Weihnachtsfestes. Ich bin Ihnen zutiefst dankbar für Ihre Teilnahme an diesem traditionellen Treffen, dessen besondere geistliche Atmosphäre der Kardinaldekan Angelo Sodano sehr schön wachgerufen hat, indem er das Zentralthema der jüngst erschienenen Enzyklika über die christliche Hoffnung ansprach. Ich danke ihm herzlich für die warmen Worte, mit denen er die Glückwünsche des Kardinalskollegiums, der Mitglieder der Römischen Kurie und des Governatorats sowie der Päpstlichen Vertreter in aller Welt zum Ausdruck gebracht hat. Unsere Gemeinschaft ist wirklich – wie Sie, Herr Kardinal, hervorgehoben haben – eine »Arbeitsgemeinschaft«, die zusammengehalten wird mit Banden der Geschwisterlichkeit, welche durch die weihnachtlichen Festlichkeiten erneut gestärkt werden. In diesem Geist haben Sie es sinnvollerweise nicht versäumt, die ehemaligen Mitglieder unserer Kurienfamilie zu erwähnen, die in den vergangenen Monaten die Schwelle der Zeit überschritten haben und in den Frieden Gottes eingegangen sind: Bei einem Anlaß wie diesem tut es dem Herzen wohl, die Nähe derjenigen zu spüren, die gemeinsam mit uns der Kirche gedient haben und nun am Thron Gottes für uns eintreten. Danke also, Herr Kardinaldekan, für Ihre Worte und danke an alle Anwesenden für den Beitrag, den jeder einzelne zur Erfüllung des Dienstes leistet, den der Herr mir aufgetragen hat.
Ein weiteres Jahr geht zu Ende. Als erstes herausragendes Ereignis dieses so schnell verflossenen Zeitabschnitts möchte ich die Reise nach Brasilien erwähnen. Ihr Ziel war die Begegnung mit der V. Generalkonferenz des Episkopats von Lateinamerika und den Karaiben und so überhaupt eine Begegnung mit der Kirche im weit erstreckten lateinamerikanischen Kontinent. Einige Höhepunkte dieser Reise möchte ich erwähnen, bevor ich zur Konferenz von Aparecida selbst komme. Zunächst bleibt mir der festliche Abend mit der Jugend im Stadion von São Paulo im Gedächtnis, an dem uns alle, trotz der kalten Temperaturen, eine große innere Freude, eine lebendige Erfahrung der Gemeinsamkeit und ein klarer Wille verband, aus dem Geist Jesu Christi heraus Diener der Versöhnung, Freunde der Armen und Leidenden, Boten des Guten zu sein, das uns im Evangelium aufgeleuchtet ist. Es gibt Massenkundgebungen, die nur wie eine Selbstbestätigung wirken; in denen man sich nur in den Taumel des Rhythmus und der Klänge einsinken läßt und dabei sich selbst genießt. Aber hier öffnete sich gerade das Selbst; das Miteinander, das sich an diesem Abend unter uns ganz spontan bildete, trug ein Füreinander in sich. Es war nicht Flucht vor dem Alltag, sondern wurde Kraft, ihn neu anzunehmen. Ich möchte jedenfalls den jungen Menschen herzlich danken, die diesen Abend gestaltet haben, für ihr Mitsein, für ihr Singen, Sprechen, Beten, das uns von innen her gereinigt, besser gemacht hat – besser auch für die anderen.
Unvergessen bleibt auch der Tag, an dem ich zusammen mit einer großen Zahl von Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und Gläubigen feierlich Frei Galvão, einen Sohn Brasiliens, kanonisieren, zum Heiligen der ganzen Kirche erklären durfte. Überall grüßten uns seine Bilder, aus denen die Güte des Herzens herausleuchtete, die er in der Begegnung mit Christus und in seiner Ordensgemeinschaft gefunden hatte. Über die endgültige Wiederkunft Christi in der Parusie ist uns gesagt, daß er nicht allein, sondern mit allen seinen Heiligen kommen wird. So ist jeder Heilige, der in die Geschichte hereintritt, schon ein Stück der Wiederkunft Christi, ein neues Ankommen des Herrn, das uns sein Bild auf neue Weise zeigt, uns seiner Gegenwart gewiß werden läßt. Jesus Christus gehört nicht der Vergangenheit an und ist nicht in eine weit entfernte Zukunft entrückt, um die wir gar nicht bitten mögen. Er kommt in einer großen Prozession von Heiligen. Er ist immer schon mit seinen Heiligen unterwegs zu uns, in unser Heute.
Besonders lebendig steht in meinem Gedächtnis der Tag in der Fazenda da Esperança, in der Menschen, die in die Knechtschaft der Droge geraten waren, wieder Freiheit und Hoffnung finden. Beim Ankommen dort ist mir als erstes die heilende Kraft der Schöpfung Gottes neu aufgegangen. Grüne Berge umstehen das weite Tal; sie weisen in die Höhe und geben zugleich ein Gefühl der Geborgenheit. Aus dem Tabernakel der kleinen Kirche der Karmelitinnen fließt eine Quelle reinen Wassers, die an die Ezechiel-Prophetie vom Wasser aus dem Tempel erinnert, das das salzige Land entgiftet und Bäume wachsen läßt, die Leben geben. Die Schöpfung müssen wir nicht nur unserer Zweckmäßigkeiten wegen schützen, sondern ihrer selbst wegen – als Botschaft des Schöpfers, als Geschenk der Schönheit, die Verheißung und Hoffnung ist. Ja, der Mensch braucht die Transzendenz. Gott allein genügt, hat Teresa von Avila gesagt. Wenn er ausfällt, dann muß der Mensch selber die Welt zu entgrenzen versuchen, sich den unendlichen Raum öffnen, für den er geschaffen ist. Die Droge wird ihm geradezu zur Notwendigkeit. Aber alsbald entdeckt er, daß dies nur eine Schein-Unendlichkeit ist – ein Spott des Teufels auf den Menschen, möchte man sagen. Dort, in der Fazenda der Hoffnung, wird die Welt wieder wirklich entgrenzt, der Blick auf Gott hin, auf die Weite unseres Lebens öffnet sich, und so geschieht Heilung. All denen, die dort wirken, gilt mein aufrichtiger Dank, und all denen, die dort Heilung suchen, mein herzlicher Segenswunsch.
Schließlich möchte ich an die Begegnung mit den brasilianischen Bischöfen in der Kathedrale von São Paulo erinnern. Die festliche Musik, die uns begleitet hat, bleibt unvergeßlich. Es hat sie besonders schön gemacht, daß sie von armen Jugendlichen jener Stadt dargeboten wurde, die sich zu Chor und Orchester zusammengefunden hatten. Sie haben uns so die Erfahrung der Schönheit geschenkt, die mit zu den Gaben gehört, durch die der Alltag der Welt entgrenzt wird und wir Größeres vernehmen, das uns der Schönheit Gottes gewiß werden läßt. Das Erlebnis der »effektiven und affektiven Kollegialität«, der brüderlichen Gemeinschaft im gemeinsamen Dienst hat uns die Freude der Katholizität spüren lassen: Über alle geographischen und kulturellen Grenzen hin sind wir Brüder mit dem auferstandenen Christus, der uns in seinen Dienst gerufen hat.
Schließlich Aparecida. Ganz besonders hat mich die kleine Figur der Madonna berührt. Arme Fischer, die immer wieder vergeblich ihre Netze auswarfen, haben sie aus dem Fluß gezogen; darauf folgte endlich dann auch der reiche Fischfang. Es ist die Madonna der Armen, die selbst arm und klein geworden ist. So ist gerade durch den Glauben und die Liebe der Armen um diese Figur herum die große Wallfahrtskirche geworden, die doch immer auf die Armut Gottes, auf die Demut der Mutter verweist und darum Tag um Tag Heimstatt und Zufluchtsort der Betenden und Hoffenden ist. Es war gut, daß wir uns dort versammelt haben und dort das Dokument dieser Generalversammlung erarbeitet haben, das unter dem Thema steht: »Discipulos e misioneros de Jesucristo, para que en Él tengan la vida.« Man könnte natürlich sofort fragen: War dies das rechte Thema in dieser unserer historischen Stunde? War es nicht zu sehr eine Wendung nach innen in einem Augenblick, in dem die großen Herausforderungen der Geschichte, die drängenden Fragen der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freiheit den vollen Einsatz aller Menschen guten Willens, gerade auch der Christenheit und der Kirche verlangen? Hätte man sich nicht diesen Fragen stellen müssen, anstatt in die Innenwelt des Glaubens zurückzukehren?
Stellen wir diesen Einwand einstweilen zurück. Bevor wir darauf antworten, ist es notwendig, das Thema selbst in seiner wahren Bedeutung richtig zu verstehen; wenn dies geschieht, ergibt sich die Antwort auf den Einwand von selbst. Das Zielwort des Themas lautet: das Leben finden – das eigentliche Leben. Das Thema setzt dabei voraus, daß dieses Ziel, worin wohl alle übereinstimmen können, in der Jüngerschaft Jesu Christi sowie im Einsatz für sein Wort und seine Gegenwart erreicht wird. Die Christen in Lateinamerika und mit ihnen in der ganzen Welt werden also zuallererst eingeladen, wieder mehr »Jünger Jesu Christi« zu werden, was wir ja eigentlich durch die Taufe schon sind und doch immer wieder neu werden müssen in der lebendigen Aneignung des Geschenks dieses Sakramentes. Jünger Christi sein – was heißt das? Nun, das bedeutet zuerst: ihn kennenlernen. Wie geschieht das? Es ist eine Einladung, ihm zuzuhören, wie er im Wort der Heiligen Schrift zu uns spricht, wie er im gemeinsamen Beten der Kirche und in den Sakramenten, wie im Zeugnis der Heiligen uns anredet und auf uns zugeht. Christus kennenlernen kann man nie nur theoretisch. Man kann in großer Gelehrsamkeit alles wissen über die Heiligen Schriften, ohne ihm begegnet zu sein. Zum Kennenlernen gehört das Mitgehen mit ihm, das Eintreten in seine Gesinnungen, wie der Philipper-Brief sagt (2,5). Diese Gesinnungen beschreibt der heilige Paulus kurz so: Die Liebe haben, miteinander eine Seele sein (sympsychoi), einträchtig sein, nichts aus Ehrgeiz und Prahlerei tun, nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auf das des anderen bedacht sein (2,2–4). Katechese kann nie nur intellektuelle Belehrung sein, sie muß auch Einübung in die Lebensgemeinschaft mit Christus, Einübung in die Demut, in die Gerechtigkeit und in die Liebe werden. Nur so gehen wir mit Jesus Christus auf seinem Weg, nur so öffnet sich das Auge unseres Herzens; nur so lernen wir die Schrift zu verstehen und begegnen wir Ihm. Begegnung mit Jesus Christus verlangt das Zuhören, verlangt das Antworten im Gebet und im Tun dessen, was er uns sagt. Indem wir Christus kennenlernen, lernen wir Gott kennen, und nur von Gott her verstehen wir den Menschen und die Welt, die sonst ein sinnloses Fragen bleibt.
Jünger Jesu Christi werden ist also ein Weg der Erziehung zu unserem wahren Sein, zum rechten Menschsein. Im Alten Testament wurde die Grundhaltung des Menschen, der Gottes Wort lebt, in dem Begriff Zadik – der Gerechte – zusammengefaßt: Wer nach dem Wort Gottes lebt, wird ein Gerechter; er tut und lebt die Gerechtigkeit. Im Christentum ist die Haltung der Jünger Jesu Christi dann in einem anderen Wort formuliert worden: der Gläubige. Der Glaube umfaßt alles; das Mitsein mit Christus und mit seiner Gerechtigkeit wird in diesem Wort nun zusammen ausgesagt. Wir empfangen im Glauben Christi Gerechtigkeit und leben sie selbst, geben sie weiter. Das Dokument von Aparecida konkretisiert dies alles, indem es von der guten Botschaft über die Menschenwürde, über das Leben, über die Familie, über Wissenschaft und Technologie, über die menschliche Arbeit, über die universale Bestimmung der Güter der Erde und die Ökologie redet: Dimensionen, in denen sich unsere Gerechtigkeit entfaltet, Glaube gelebt und auf die Herausforderungen der Zeit geantwortet wird.
Der Jünger Jesu Christi muß auch »Missionar«, Bote des Evangeliums sein, so sagt uns dieses Dokument. Auch hier erhebt sich ein Einwand: Soll man heute noch »missionieren«? Sollen nicht lieber alle Religionen und Weltanschauungen friedlich zusammenleben und miteinander das Beste für die Menschheit zu tun versuchen, jeder auf seine eigene Art? Nun, daß wir alle in Toleranz und Respekt zusammenleben und zusammenwirken sollen, ist unbestritten. Die katholische Kirche setzt sich mit großem Nachdruck dafür ein und hat mit den beiden Begegnungen von Assisi auch deutliche Zeichen in diese Richtung gesetzt, die wir in diesem Jahr in der Begegnung in Neapel neu aufgegriffen haben. In diesem Zusammenhang möchte ich hier gerne das Schreiben erwähnen, das mir am vergangenen 13. Oktober 138 muslimische Religionsführer freundlicherweise zugesandt haben, um mir ihren gemeinsamen Einsatz für die Förderung des Friedens in der Welt zu bezeugen. Mit Freude habe ich in meiner Antwort meine volle Zustimmung zu diesen edlen Absichten bekundet und zugleich die Dringlichkeit einträchtiger Bemühungen zur Wahrung der Werte der gegenseitigen Achtung, des Dialogs und der Zusammenarbeit betont. Die einmütige Anerkennung der Existenz eines einzigen Gottes, der weiser Schöpfer und allgemeiner Richter über das Verhalten eines jeden ist, bildet die Voraussetzung für ein gemeinsames Handeln zum Schutz der effektiven Achtung der Würde jedes Menschen zum Aufbau einer gerechteren und solidarischeren Gesellschaft.
Aber bedeutet dieser Wille zu Dialog und Zusammenarbeit zugleich, daß wir die Botschaft von Jesus Christus nicht mehr weitergeben, nicht mehr den Menschen und der Welt diesen Anruf und seine Hoffnung vorlegen dürfen? Wer eine große Erkenntnis, wer große Freude gefunden hat, muß sie weitergeben, kann dies gar nicht für sich selbst behalten. Solche großen Gaben sind niemals für einen allein bestimmt. Uns ist in Jesus Christus ein großes Licht, das große Licht aufgegangen: Wir dürfen es nicht unter den Scheffel stellen, sondern müssen es auf den Leuchter heben, damit es allen im Haus leuchtet (Mt 5,15). Der heilige Paulus ist rastlos mit dem Evangelium unterwegs gewesen. Er wußte sich förmlich unter einem »Zwang«, das Evangelium zu verkünden (1 Kor 9,16) – nicht so sehr aus Heilsangst für die einzelnen Ungetauften, vom Evangelium noch nicht Erreichten, sondern weil er wußte, daß die Geschichte als ganze nicht zur Vollendung kommen konnte, solange nicht die Fülle (pléroma) der Völker eingetreten sein würde in das Evangelium (Röm 11,25). Die Geschichte braucht zu ihrer Vollendung die Verkündigung der Botschaft an alle Völker, an alle Menschen (vgl. Mk 13,10). Und in der Tat: Wie wichtig ist es, daß in die Menschheit Kräfte der Versöhnung, Kräfte des Friedens, Kräfte der Liebe und Gerechtigkeit einströmen – daß im Haushalt der Menschheit gegenüber all den Gesinnungen und Wirklichkeiten der Gewalt und des Unrechts, von denen sie bedroht wird, die Gegenkräfte geweckt und gestärkt werden! Genau dies geschieht in der christlichen Mission: Dem Haushalt der Menschheit werden durch die Begegnung mit Jesus Christus und seinen Heiligen, durch die Begegnung mit Gott jene Kräfte des Guten zugeführt, ohne die all unsere Sozialordnungen nicht Wirklichkeit werden, sondern bloß abstrakte Theorie bleiben, angesichts des übermächtigen Drucks anderer Interessen, die dem Frieden und der Gerechtigkeit entgegenstehen.
So sind wir zu den zuerst gestellten Fragen zurückgekehrt: Hat Aparecida gut daran getan, der Jüngerschaft Jesu Christi und der Evangelisierung die Priorität zu geben auf der Suche nach Leben für die Welt? War es eine falsche Wendung nach innen? Nein! Aparecida hat richtig entschieden, weil gerade durch die neue Begegnung mit Jesus Christus und seinem Evangelium, nur so, die Kräfte geweckt werden, die uns instand setzen, auf die Herausforderungen der Zeit die rechte Antwort zu geben.
Ende Juni habe ich einen Brief an die Bischöfe, die Priester, die Personen gottgeweihten Lebens und an die gläubigen Laien der katholischen Kirche in der Volksrepublik China gesandt. Mit diesem Brief wollte ich sowohl meine tiefe geistliche Zuneigung zu allen Katholiken in China als auch herzliche Wertschätzung für das chinesische Volk zum Ausdruck bringen. Ich habe darin die bleibenden Grundsätze der katholischen Tradition und des Zweiten Vatikanischen Konzils auf dem Feld der Ekklesiologie in Erinnerung gerufen. Im Licht des »ursprünglichen Planes«, den Christus von seiner Kirche hatte, habe ich einige Orientierungen gegeben, um die heiklen und komplexen Problemkreise des Lebens der Kirche in China im Geist der Gemeinschaft und der Wahrheit anzugehen und zu lösen. Ich habe auch auf die Bereitschaft des Heiligen Stuhls zu einem sachlichen und konstruktiven Dialog mit den zivilen Autoritäten hingewiesen, damit eine Lösung für die verschiedenen Probleme gefunden werden kann, die die katholische Gemeinschaft betreffen. Der Brief wurde von den Katholiken in China mit Freude und Dankbarkeit aufgenommen. So wünsche ich mir, daß er mit Gottes Hilfe die erhofften Früchte bringen möge.
Auf die anderen Höhepunkte des Jahres kann ich leider nur noch kurz zu sprechen kommen. Tatsächlich waren es Ereignisse, die in dieselbe Richtung zielten, die gleiche Orientierung deutlich machen wollten. So der wundervolle Besuch in Österreich. Der Osservatore Romano hat mit einem schönen Wort den Regen, der uns begleitete, als »pioggia della fede« – Glaubensregen bezeichnet: Der Regen hat uns die Freude des Glaubens an Christus durch das Hinschauen auf seine Mutter nicht nur nicht gemindert, sondern sogar gestärkt. Diese Freude durchbrach den Schleier der Wolken, die uns umgaben. Mit Maria blickend auf Christus haben wir das Licht gefunden, das uns in allen Finsternissen der Welt den Weg weist. Den österreichischen Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und all den vielen Gläubigen, die in diesen Tagen mit mir auf dem Weg zu Christus waren, möchte ich herzlich danken für dieses ermutigende Zeichen des Glaubens, das sie uns geschenkt haben.
Auch die Begegnung mit der Jugend in der Agora von Loreto war ein großes Zeichen der Freude und der Hoffnung: Wenn so viele junge Menschen Maria und mit Maria Christus begegnen wollen und sich von der Freude des Glaubens anstecken lassen, dann können wir getrost der Zukunft entgegengehen. In diesem Sinn habe ich mich bei verschiedenen Gelegenheiten an die Jugendlichen gewandt: bei meinem Besuch im Institut für Minderjährige, Casal del Marmo, in den Ansprachen bei Audienzen und beim sonntäglichen Angelus-Gebet. Ich habe ihre Erwartungen und ihre großherzigen Vorsätze zur Kenntnis genommen, die Erziehungsfrage erneut aufgeworfen und die Ortskirchen zu einem verstärkten Engagement in der Berufungspastoral aufgefordert. Natürlich habe ich nicht versäumt, die Manipulationen anzuprangern, denen die jungen Menschen heute ausgesetzt sind, und die Gefahren aufzuzeigen, die sich daraus für die Gesellschaft der Zukunft ergeben.
Ganz kurz habe ich schon von dem Treffen in Neapel gesprochen. Auch da waren wir – ganz ungewohnt für die Stadt der Sonne und des Lichts – vom Regen umgeben, aber auch da hat die warme Menschlichkeit, der lebendige Glaube die Wolken durchbrochen und uns die Freude erleben lassen, die aus dem Evangelium kommt.
Natürlich dürfen wir uns keine Illusionen machen: Die Probleme, die der Säkularismus unserer Zeit stellt, und der Druck der ideologischen Anmaßungen, zu denen das säkularistische Bewußtsein mit seinem Alleinanspruch auf die endgültige Rationalität neigt, sind nicht gering. Wir wissen es und wissen um die Mühsale des Ringens, das uns in dieser Zeit auferlegt ist. Aber wir wissen auch, daß der Herr seine Verheißung einhält: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt (Mt 28,20). In dieser frohen Gewißheit nehmen wir den Gedankenanstoß von Aparecida auf, unser Mitsein mit Christus auch unsererseits zu erneuern, und gehen so zuversichtlich auf das neue Jahr zu. Gehen wir unter dem mütterlichen Blick der Aparecida, unter den Augen derer, die sich selbst als »die Magd des Herrn« bezeichnet hat. Ihr Schutz schenkt uns Sicherheit und erfüllt uns mit Hoffnung. In diesem Sinne erteile ich Ihnen allen, die Sie hier zugegen sind, sowie allen, die zur großen Familie der Römischen Kurie gehören, von Herzen den Apostolischen Segen.<ref> Die deutsche Fassung auf der Vatikanseite aus dem Jahre 2007</ref>
2008
am 22. Dezember
hochwürdige Mitbrüder im Bischofs- und Priesteramt,
Das Fest der Geburt des Herrn steht vor der Tür. Jede Familie empfindet das Verlangen, sich zu versammeln, um die einzigartige und unwiederholbare Atmosphäre zu genießen, die dieses Fest herbeiführen kann. Auch die Familie der Römischen Kurie findet sich heute Morgen zusammen, entsprechend einem schönen Brauch, der uns die Freude schenkt, in diesem besonderen geistigen Klima einander zu begegnen und die Glückwünsche auszutauschen. An jeden einzelnen richte ich meinen herzlichen Gruß, voller Dankbarkeit für die geschätzte Mitarbeit am Dienst des Nachfolgers Petri. Herzlich danke ich dem Kardinaldekan Angelo Sodano, der mit der Stimme eines Engels im Namen aller Anwesenden wie auch all derer gesprochen hat, die in den verschiedenen Büros, einschließlich der Päpstlichen Vertretungen, tätig sind. Ich erwähnte zu Beginn die weihnachtliche Atmosphäre. Diese stelle ich mir gerne als eine Art Verlängerung jener geheimnisvollen Freude, jenes inneren Jubels vor, der die heilige Familie, die Engel und die Hirten von Bethlehem in der Nacht erfaßte, da Jesus geboren wurde. Ich würde sie als „Atmosphäre der Gnade“ bezeichnen und denke dabei an die Worte des heiligen Paulus im Brief an Titus: „Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus“ (vgl. 2, 11). Der Apostel betont, daß die Gnade Gottes für „alle Menschen“ erschienen ist: Ich würde sagen, daß darin auch die Sendung der Kirche und speziell die des Nachfolgers Petri sowie seiner Mitarbeiter aufscheint, dazu beizutragen, daß die Gnade Gottes, des Erlösers, immer mehr allen sichtbar werde und allen das Heil bringe.
Das zu Ende gehende Jahr war reich an Rückblicken auf prägende Daten der jüngeren Geschichte der Kirche, aber auch reich an Ereignissen, die Markierungen für unseren weiteren Weg in die Zukunft bedeuten. Vor 50 Jahren ist Papst Pius XII. gestorben, vor 50 Jahren wurde Johannes XXIII. zum Papst gewählt. 40 Jahre sind seit der Veröffentlichung der Enzyklika „Humanae vitae“ vergangen und 30 Jahre seit dem Tod ihres Verfassers, Papst Paul VI. Die Botschaft dieser Ereignisse wurde im vergangenen Jahr auf vielfache Weise bedacht, so daß ich sie in dieser Stunde nicht neu kommentieren möchte. Der Blick des Erinnerns reichte aber über die Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts noch weiter zurück und wies uns gerade so vorwärts: Am Abend des 28. Juni konnten wir in St. Paul vor den Mauern in Anwesenheit des ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I. von Konstantinopel und Vertretern vieler anderer Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften das Jahr des heiligen Paulus eröffnen im Gedenken an die Geburt des Völkerapostels vor 2.000 Jahren. Paulus ist für uns keine Gestalt der Vergangenheit. Durch seine Briefe spricht er zu uns. Und wer ins Gespräch mit ihm kommt, wird von ihm weitergeführt zum gekreuzigten und auferstandenen Christus hin. Das Paulus-Jahr ist ein Pilgerjahr nicht nur im äußeren Unterwegssein zu Erinnerungsorten des Apostels, sondern auch und vor allem als Pilgerschaft des Herzens mit Paulus zu Jesus Christus. Schließlich lehrt uns Paulus aber auch, daß die Kirche Christi Leib ist, daß Haupt und Leib untrennbar sind und daß es keine Liebe zu Christus ohne Liebe zu seiner Kirche und ihrer lebendigen Gemeinschaft geben kann.
Drei einzelne Ereignisse des vergangenen Jahres fallen bei der Rückschau besonders ins Auge. Da war zunächst der Weltjugendtag in Australien, ein großes Fest des Glaubens, das mehr als 200.000 Jugendliche aus allen Teilen der Welt nicht nur äußerlich – geographisch -, sondern inwendig in der Gemeinsamkeit der Freude des Christseins zueinandergeführt hat. Daneben stehen die beiden Reisen in die Vereinigten Staaten und nach Frankreich, in denen Kirche vor der Welt und für die Welt sichtbar wurde als geistige Kraft, die Wege des Lebens zeigt und durch das Zeugnis des Glaubens Licht in die Welt trägt. Denn dies waren Tage gewesen, aus denen Helligkeit kam; Zuversicht, daß es gut ist zu leben, recht das Gute zu tun. Und da ist schließlich der Bischofssynode zu gedenken: Bischöfe aus aller Welt waren versammelt um das Wort Gottes herum, das in ihrer Mitte aufgerichtet war; um das Wort Gottes, dessen große Bezeugung in der Heiligen Schrift zu finden ist. Was uns im Alltag zu selbstverständlich geworden ist, haben wir neu in seiner Größe erfaßt: daß Gott redet. Daß er antwortet auf unser Fragen. Daß er in Menschenworten doch als er selber spricht und wir ihm zuhören, durch das Zuhören ihn kennen und verstehen lernen können; daß er in unser Leben hereintritt und es formt; daß wir aus unserem eigenen Leben heraustreten können in die Weite seines Erbarmens hinein. So wurde uns von neuem klar, daß Gott in diesem seinem Wort zu jedem einzelnen von uns redet, jedem in sein Herz hinein: Wenn unser Herz wach wird und sich das innere Gehör öffnet, dann kann jeder das gerade ihm eigens zugedachte Wort hören lernen. Aber gerade wenn wir Gott so persönlich, mit jedem einzelnen von uns reden hören, erkennen wir auch, daß sein Wort da ist, damit wir zueinander kommen. Damit wir aus dem bloß Eigenen herausfinden. Dieses Wort hat gemeinsame Geschichte geformt und will es weiter tun. So ist uns von neuem klar geworden, daß wir das Wort – gerade weil es so persönlich ist – nur im Wir der von Gott gestifteten Gemeinschaft recht und ganz verstehen können: immer wissend, daß wir es niemals vollends ausschöpfen, daß es jeder Generation Neues zu sagen hat. Wir haben verstanden, daß die biblischen Schriften gewiß zu ganz bestimmten Zeiten entstanden und so in diesem Sinn zunächst ein Buch aus vergangener Zeit sind. Aber wir haben gesehen, daß ihr Wort nicht in der Vergangenheit bleibt und darin eingeschlossen werden kann; daß Gott letztlich immer im Präsens spricht und daß wir der Bibel erst dann ganz zugehört haben, wenn wir das Präsens Gottes entdecken, das uns jetzt ruft.
Schließlich war es bedeutend zu erleben, daß in der Kirche auch heute Pfingsten ist – das heißt, daß sie in vielen Sprachen redet und dies nicht nur in dem äußeren Sinne, daß alle großen Sprachen der Welt in ihr vertreten sind, sondern mehr noch in dem tieferen Sinn, daß die vielfältigen Weisen des Erfahrens von Gott und Welt, der Reichtum der Kulturen in ihr gegenwärtig ist und so erst die Weite des Menschseins und von ihr her die Weite von Gottes Wort erscheint. Freilich haben wir auch gelernt, daß Pfingsten noch immer unterwegs, noch immer unerfüllt ist: Noch immer gibt es eine Vielzahl von Sprachen, die noch auf das Wort Gottes in der Bibel warten. Bewegend waren auch die vielfältigen Zeugnisse von Laien aus aller Welt, die das Wort Gottes nicht nur leben, sondern auch dafür leiden. Kostbar war es, daß ein Rabbi über die Heiligen Schriften Israels sprach, die ja auch unsere Heiligen Schriften sind. Ein großer Augenblick war es für die Synode, ja, für den Weg der Kirche insgesamt, daß Patriarch Bartholomäus uns von der orthodoxen Überlieferung her auf eindringliche Weise zum Wort Gottes hinführte. Nun hoffen wir, daß die Erfahrungen und die Erkenntnisse der Synode ins Leben der Kirche hineinwirken: in den persönlichen Umgang mit den Heiligen Schriften, in ihre Auslegung in der Liturgie und Katechese wie auch in wissenschaftlicher Forschung: daß die Bibel nicht Wort der Vergangenheit bleibe, sondern ihre Lebendigkeit und Gegenwart in der Weite der Dimensionen ihrer Bedeutungen gelesen und erschlossen werden.
Um die Gegenwart von Gottes Wort, von Gott selbst in unserer geschichtlichen Stunde ging es auch bei den Pastoralreisen dieses Jahres: ihr eigentlicher Sinn kann nur sein, dieser Gegenwart zu dienen. Kirche wird da öffentlich wahrnehmbar, mit ihr der Glaube und insofern mindestens die Frage nach Gott. Diese Öffentlichkeit des Glaubens beschäftigt inzwischen all diejenigen, die die Gegenwart und ihre wirkenden Kräfte zu verstehen suchen. Besonders das Phänomen der Weltjugendtage wird zusehends Gegenstand von Analysen, die sozusagen diese Art von Jugendkultur zu verstehen versuchen. Australien hat noch nie so viele Menschen aus allen Kontinenten gesehen wie beim Weltjugendtag, selbst nicht bei der Olympiade. Und wenn vorher die Furcht bestanden hatte, das massenhafte Auftreten junger Menschen könne zu Störungen der öffentlichen Ordnung führen, den Verkehr paralysieren, das tägliche Leben behindern, Gewalt produzieren und der Droge Raum geben, so erwies sich all dies als unbegründet. Es war ein Fest der Freude, die schließlich auch die Widerstrebenden einbezog: Am Ende fühlte sich niemand belästigt. Die Tage waren zu einem Fest für alle geworden, ja, man hatte das erst so richtig erfahren, was das ist: ein Fest – ein Vorgang, bei dem alle sozusagen außer sich, über sich hinaus und gerade so bei sich und beieinander sind. Was also geschieht da eigentlich bei einem Weltjugendtag? Welche Kräfte sind da wirksam? Gängige Analysen tendieren dazu, diese Tage als eine Variante der modernen Jugendkultur, als eine Art von kirchlich abgewandeltem Rockfestival mit dem Papst als Star anzusehen. Ob mit oder ohne Glauben wären diese Festivals im Grunde doch dasselbe, und so glaubt man, die Frage nach Gott beiseitelegen zu können. Es gibt auch katholische Stimmen, die in diese Richtung gehen und das Ganze als ein großes und auch schönes Spektakel ansehen, das aber für die Frage nach dem Glauben und der Gegenwart des Evangeliums in unserer Zeit wenig bedeute. Es seien Augenblicke festlicher Ekstase, die aber dann doch letztlich alles beim Alten beließen, das Leben nicht tiefer gestalten könnten.
Das Besondere dieser Tage und das Besondere ihrer Freude, ihrer gemeinschaftsstiftenden Kraft ist damit aber nicht erklärt. Zunächst ist wichtig zu beachten, daß die Weltjugendtage nicht nur aus der einen Woche bestehen, in der sie für die Welt öffentlich sichtbar werden. Ein langer äußerer und innerer Weg führt auf sie zu. Das Kreuz wandert durch die Länder, begleitet vom Bild der Mutter des Herrn. Der Glaube braucht auf seine Weise das Sehen und Berühren. Die Begegnung mit dem Kreuz, das angefaßt und getragen wird, wird zu innerer Begegnung mit dem, der am Kreuz für uns gestorben ist. Die Begegnung mit dem Kreuz erinnert die jungen Menschen inwendig an den Gott, der Mensch werden und mit uns leiden wollte. Und wir sehen die Frau, die er uns als Mutter gegeben hat. Die festlichen Tage sind nur der Höhepunkt eines langen Weges, in dem man aufeinander und auf Christus zugeht. In Australien ist nicht zufällig der lange Kreuzweg durch die Stadt zum Höhepunkt der Tage geworden. Er faßte noch einmal zusammen, was in den Jahren zuvor geschehen war und wies auf den hin, der uns alle zusammenführt: den Gott, der uns bis ans Kreuz liebt. So ist auch der Papst nicht der Star, um den alles kreist. Er ist ganz und nur Stellvertreter. Er verweist auf den anderen, der in unserer Mitte ist. Endlich ist die festliche Liturgie deshalb der Mittelpunkt des Ganzen, weil in ihr geschieht, was wir nicht machen können und doch immer erwarten. ER ist gegenwärtig. ER tritt zu uns herein. Der Himmel ist aufgerissen, und das macht die Erde hell. Das macht das Leben froh und weit und verbindet miteinander in einer Freude, die mit der Ekstase eines Rockfestivals nicht vergleichbar ist. Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt: „Nicht das ist das Kunststück, ein Fest zu veranstalten, sondern solche zu finden, welche sich an ihm freuen.“ Die Freude ist nach der Schrift Frucht des Heiligen Geistes (Gal 5, 22): Diese Frucht war in den Tagen in Sydney reichlich zu spüren. Wie den Weltjugendtagen eine Wanderung des Kreuzes vorausgeht, so folgt daraus auch das Weitergehen. Es bilden sich Freundschaften, die zu einem alternativen Lebensstil ermutigen und ihn von innen her tragen. Die großen Tage sind nicht zuletzt dazu da, daß solche Freundschaften erwachen und dadurch Lebensorte des Glaubens in der Welt entstehen, die zugleich Orte der Hoffnung und der gelebten Liebe sind.
Freude als Frucht des Heiligen Geistes – damit sind wir beim zentralen Thema von Sydney angelangt, das eben der Heilige Geist gewesen ist. Die Wegweisung, die darin liegt, möchte ich in diesem Rückblick noch einmal zusammenfassend andeuten. Wenn man sich das Zeugnis von Schrift und Überlieferung vor Augen hält, kann man unschwer vier Dimensionen des Themas Heiliger Geist erkennen.
1. Da ist zuerst die Aussage, die uns vom Anfang des Schöpfungsberichts her entgegenkommt: Er erzählt uns von dem Schöpfergeist, der über den Wassern schwebt, die Welt erschafft und immer wieder erneuert. Glaube an den Schöpfergeist ist ein wesentlicher Inhalt des christlichen Credo. Daß die Materie mathematische Struktur in sich trägt, geisterfüllt ist, ist die Grundlage, auf der die moderne Naturwissenschaft beruht. Nur weil Materie geistig strukturiert ist, kann unser Geist sie nachdenken und selbst gestalten. Daß diese geistige Struktur von dem gleichen Schöpfergeist kommt, der auch uns Geist geschenkt hat, bedeutet Auftrag und Verantwortung zugleich. Im Schöpfungsglauben liegt der letzte Grund unserer Verantwortung für die Erde. Sie ist nicht einfach unser Eigentum, das wir ausnützen können nach unseren Interessen und Wünschen. Sie ist Gabe des Schöpfers, der ihre inneren Ordnungen vorgezeichnet und uns damit Wegweisungen als Treuhänder seiner Schöpfung gegeben hat. Daß die Erde, der Kosmos, den Schöpfergeist spiegeln, bedeutet auch, daß ihre geistigen Strukturen, die über die mathematische Ordnung hinaus im Experiment gleichsam greifbar werden, auch sittliche Weisung in sich tragen. Der Geist, der sie geformt hat, ist mehr als Mathematik – er ist das Gute in Person, das uns durch die Sprache der Schöpfung den Weg des rechten Lebens zeigt.
Weil der Glaube an den Schöpfer ein wesentlicher Teil des christlichen Credo ist, kann und darf sich die Kirche nicht damit begnügen, ihren Gläubigen die Botschaft des Heils auszurichten. Sie trägt Verantwortung für die Schöpfung und muß diese Verantwortung auch öffentlich zur Geltung bringen. Und sie muß dabei nicht nur die Erde, das Wasser und die Luft als Schöpfungsgaben verteidigen, die allen gehören. Sie muß auch den Menschen gegen die Zerstörung seiner selbst schützen. Es muß so etwas wie eine Ökologie des Menschen im recht verstandenen Sinn geben. Es ist nicht überholte Metaphysik, wenn die Kirche von der Natur des Menschen als Mann und Frau redet und das Achten dieser Schöpfungsordnung einfordert. Da geht es in der Tat um den Glauben an den Schöpfer und das Hören auf die Sprache der Schöpfung, die zu mißachten Selbstzerstörung des Menschen und so Zerstörung von Gottes eigenem Werk sein würde. Was in dem Begriff „Gender“ vielfach gesagt und gemeint wird, läuft letztlich auf die Selbstemanzipation des Menschen von der Schöpfung und vom Schöpfer hinaus. Der Mensch will sich nur selber machen und sein Eigenes immer nur selbst bestimmen. Aber so lebt er gegen die Wahrheit, lebt gegen den Schöpfergeist. Die Regenwälder verdienen unseren Schutz, ja, aber nicht weniger der Mensch als Geschöpf, dem eine Botschaft eingeschrieben ist, die nicht Gegensatz zu unserer Freiheit, sondern ihre Bedingung bedeutet. Große Theologen der Scholastik haben die Ehe, die lebenslange Verbindung von Mann und Frau als Schöpfungssakrament bezeichnet, das der Schöpfer selbst eingesetzt und das Christus dann – ohne die Schöpfungsbotschaft zu verändern – in die Heilsgeschichte als Sakrament des Neuen Bundes aufgenommen hat. Zur Verkündigungsaufgabe der Kirche gehört das Zeugnis für den Schöpfergeist in der Natur als Ganzer und gerade auch in der Natur des gottebenbildlichen Menschen. Von da aus sollte man die Enzyklika „Humanae vitae“ neu lesen: Papst Paul VI. ging es darin darum, die Liebe gegen Sexualität als Konsum, die Zukunft gegen den Alleinanspruch der Gegenwart und die Natur des Menschen gegen ihre Manipulation zu verteidigen.
2. Nur noch ein paar kurze Andeutungen zu den anderen Dimensionen der Pneumatologie. Wenn der Schöpfergeist sich zunächst in der schweigenden Größe des Alls, in seiner geistigen Struktur zeigt, so sagt uns der Glaube darüber hinaus das Überraschende, daß dieser Geist sozusagen auch in Menschenwort redet, in die Geschichte eingetreten und als geschichtsgestaltende Kraft auch sprechender Geist ist, ja, Wort, das uns in den Schriften des Alten und des Neuen Testaments begegnet. Was das für uns bedeutet, hat der heilige Ambrosius in einem Brief wunderbar ausgedrückt: „Auch jetzt ergeht sich Gott im Paradies, während ich die göttlichen Schriften lese“ (Ep 49, 3). Die Schrift lesend können wir gleichsam auch heute im Paradiesesgarten Gottes herumgehen und dem dort wandernden Gott begegnen: Zwischen dem Thema des Weltjugendtags in Australien und dem Thema der Bischofssynode besteht ein tiefer innerer Zusammenhang. Die beiden Themen Heiliger Geist und Wort Gottes gehören zusammen. Die Schrift lesend lernen wir aber auch, daß Christus und der Heilige Geist untrennbar voneinander sind. Wenn Paulus dramatisch zugespitzt sagt: „Der Herr ist der Geist“ (2 Kor 3, 17), so erscheint nicht nur hintergründig die trinitarische Einheit von Sohn und Heiligem Geist, sondern vor allem ihre heilsgeschichtliche Einheit: In der Passion und Auferstehung Christi werden die Schleier der bloßen Buchstäblichkeit zerrissen und die Gegenwart des jetzt sprechenden Gottes sichtbar. Die Schrift mit Christus lesend lernen wir, die Stimme des Heiligen Geistes in den Menschenworten zu hören, und entdecken die Einheit der Bibel.
3. Damit sind wir schon bei der dritten Dimension der Pneumatologie angelangt, die eben in der Untrennbarkeit von Christus und Heiligem Geist besteht. Vielleicht am schönsten erscheint sie im Bericht des heiligen Johannes über die erste Erscheinung des Auferstandenen vor der Jüngergemeinschaft: Der Herr haucht die Jünger an und schenkt ihnen so den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Atem Christi. Und wie Gottes Atem am Schöpfungsmorgen den Lehm zum lebendigen Menschen gemacht hatte, so nimmt uns Christi Atem in die Seinsgemeinschaft mit dem Sohn auf, macht uns zu neuer Schöpfung. Deshalb ist es der Heilige Geist, der uns mit dem Sohn sagen läßt: „Abba, Vater!“ (Joh 20, 22; Röm 8, 15).
4. So ergibt sich als vierte Dimension der Zusammenhang von Geist und Kirche ganz von selbst. Paulus hat in 1 Kor 12 und Röm 12 die Kirche als Leib Christi und gerade so als Organismus des Heiligen Geistes geschildert, in dem die Gaben des Heiligen Geistes die einzelnen zu einem lebendigen Ganzen zusammenformen. Der Heilige Geist ist der Geist des Leibes Christi. Im Ganzen dieses Leibes finden wir unsere Aufgabe, leben wir füreinander und voneinander, zutiefst von dem lebend, der für uns alle gelebt und gelitten hat und uns durch seinen Geist an sich zieht zur Einheit aller Kinder Gottes. „Willst auch du vom Geist Christi leben? So sei im Leib Christi“, sagt Augustinus dazu (Joh 26, 13).
So wird mit dem Thema Heiliger Geist, das die Tage in Australien und hintergründig die Wochen der Synode prägte, die ganze Weite des christlichen Glaubens sichtbar, die von der Verantwortung für die Schöpfung und das schöpfungsgemäße Sein des Menschen über die Themen Schrift und Heilsgeschichte zu Christus führt und von da aus in die lebendige Gemeinschaft der Kirche hinein, in ihre Ordnungen und Verantwortungen wie in ihre Weite und Freiheit, die sich in der Vielzahl der Charismen ebenso wie im pfingstlichen Bild von der Vielzahl der Sprachen und Kulturen ausdrückt.
Zum Fest gehört die Freude, hatten wir gesagt. Das Fest kann man organisieren, die Freude nicht. Sie kann nur geschenkt werden, und sie ist uns geschenkt worden in reichem Maß: Dafür sind wir dankbar. Wie Paulus die Freude als Frucht des Heiligen Geistes kennzeichnet, so hat auch Johannes in seinem Evangelium Geist und Freude ganz eng miteinander verknüpft. Der Heilige Geist schenkt uns die Freude. Und er ist die Freude. Die Freude ist die Gabe, in der alle anderen Gaben zusammengefaßt sind. Sie ist Ausdruck für das Glück, für das Einssein mit sich selbst, das nur aus dem Einssein mit Gott und mit seiner Schöpfung kommen kann. Zum Wesen der Freude gehört es, daß sie ausstrahlt, daß sie sich mitteilen muß. Der missionarische Geist der Kirche ist nichts anderes als der Drang, die Freude mitzuteilen, die uns geschenkt wurde. Daß sie in uns allezeit lebendig sei und so auf die Welt in ihren Drangsalen ausstrahle, das ist meine Bitte am Ende dieses Jahres. Verbunden mit dem herzlichen Dank für all Ihr Mühen und Wirken wünsche ich Ihnen allen, daß diese von Gott kommende Freude uns auch im neuen Jahr reichlich geschenkt werde.
Dieses Anliegen vertraue ich der Fürsprache der Jungfrau Maria, der Mater divinae gratiae, an und erbitte von Ihr fröhliche Weihnachtstage im Frieden des Herrn. In diesem Sinne erteile ich Ihnen allen und der großen Familie der Römischen Kurie von Herzen den Apostolischen Segen.<ref> Die deutsche Fassung auf der Vatikanseite aus dem Jahre 2008</ref>
2009
am 21. Dezember im "Sala Clementina", Apostolischer Palast
hochwürdige Mitbrüder im Bischofs- und Priesteramt,
Das Hochfest von Weihnachten ist – wie der Kardinal Dekan Angelo Sodano eben hervorgehoben hat – für die Christen eine ganz besondere Gelegenheit der Begegnung und des Miteinanders. Jenes Kind, das wir in Betlehem anbeten, lädt uns ein, die grenzenlose Liebe Gottes zu spüren, des Gottes, der vom Himmel herabgestiegen und einem jeden von uns nahe geworden ist, um uns zu seinen Kindern zu machen, zugehörig zu seiner Familie. Auch dieses traditionelle weihnachtliche Zusammenkommen des Nachfolgers Petri mit seinen engsten Mitarbeitern ist ein Familientreffen, das die Bande der Zuneigung und des Miteinanders festigt, um immer mehr den eben erwähnten »ständigen Abendmahlssaal« zu bilden, der der Verbreitung des Gottesreiches geweiht ist. Ich danke dem Kardinal Dekan für seine herzlichen Worte, mit denen er die Glückwünsche des Kardinalskollegiums, der Mitglieder der Römischen Kurie und des Governatorats wie auch aller Päpstlichen Vertreter zum Ausdruck gebracht hat, die uns zutiefst verbunden sind, indem sie den Menschen unserer Zeit jenes Licht zutragen, das in der Krippe von Betlehem geboren ist. Ich empfange Sie mit großer Freude und möchte dabei auch allen meinen Dank sagen für den großherzigen und kompetenten Dienst, den Sie für den »Vicarius Christi« und die ganze Kirche leisten.
Wiederum geht ein Jahr zu Ende, das reich war an wichtigen Ereignissen für die Kirche und für die Welt. Nur auf ein paar Schwerpunkte für das kirchliche Leben möchte ich in dieser Stunde dankbar rückblickend die Aufmerksamkeit lenken. Das Paulusjahr ist in das Priesterjahr übergegangen. Von der wuchtigen Gestalt des Völkerapostels Paulus, der vom Licht des auferstandenen Christus und von seinem Ruf getroffen das Evangelium zu den Völkern der Welt trug, sind wir übergegangen zu der demütigen Gestalt des Pfarrers von Ars, der sein Leben lang in dem kleinen Dorf blieb, das man ihm anvertraut hatte und doch gerade in der Demut seines Dienstes die versöhnende Güte Gottes weithin in der Welt sichtbar machte. Von beiden Gestalten her wird die Spannweite des priesterlichen Dienstes offenbar und wird sichtbar, wie gerade das Kleine groß ist und wie Gott durch den scheinbar kleinen Dienst eines Menschen Großes wirken, die Welt von innen her reinigen und erneuern kann.
Für die Kirche und für mich persönlich stand das verflossene Jahr weitgehend im Zeichen Afrikas. Da war zunächst die Reise nach Kamerun und nach Angola. Es war für mich bewegend, die große Herzlichkeit zu erleben, mit der der Nachfolger Petri, der »Vicarius Christi«, aufgenommen wurde. Die festliche Freude und die herzliche Zuneigung, die mir auf allen Straßen begegnete, galt ja nicht einfach irgendeinem zufälligen Gast. In der Begegnung mit dem Papst wurde die universale Kirche erfahrbar, die weltweite Gemeinschaft, die Gott durch Christus sammelt – die Gemeinschaft, die nicht durch menschliche Interessen begründet ist, sondern aus der Zuwendung Gottes zu uns kommt. Daß wir alle miteinander Familie Gottes sind, Brüder und Schwestern vom einen Vater her, das wurde erlebt. Und es wurde erlebt, daß Gottes Zuwendung zu uns in Christus nicht eine Sache der Vergangenheit ist und nicht eine Sache gelehrter Theorien, sondern eine ganz konkrete Wirklichkeit, hier und jetzt. ER ist unter uns: Das spürten wir durch den Dienst des Petrusnachfolgers hindurch. So waren wir über die bloße Alltäglichkeit hinausgehoben. Der Himmel stand offen, und das macht einen Tag zum Fest. Und dies ist zugleich etwas Bleibendes. Es gilt auch weiter, auch im Alltag, daß der Himmel nicht mehr verschlossen ist. Daß Gott nahe ist. Daß wir in Christus alle einander zugehören.
Besonders tief hat sich mir die Erinnerung an die liturgischen Feiern eingeprägt. Die Feiern der heiligen Eucharistie waren wirkliche Feste des Glaubens. Ich möchte zwei Elemente benennen, die mir besonders wichtig erscheinen. Da war zunächst eine große gemeinsame Freude, die sich auch körperlich ausdrückte, aber zuchtvoll und von der Anwesenheit des lebendigen Gottes geformt. Damit ist schon das zweite Element benannt: der Sinn für das Sakrale, für das gegenwärtige Mysterium des lebendigen Gottes prägte sozusagen jede einzelne Gebärde. Der Herr ist da – der Schöpfer, der, dem alles gehört, von dem wir kommen und zu dem wir unterwegs sind. Mir kamen spontan die Worte des hl. Cyprian aus seiner Vater-unser-Auslegung in den Sinn: »Denken wir daran, daß wir im Angeblickt-Werden von Gott stehen. Wir müssen den Augen Gottes gefallen, sowohl mit der Haltung unseres Körpers wie mit dem Gebrauch unserer Stimme« (De dom. or. 4 CSEL III 1 p 269). Ja, dieses Bewußtsein war da: Wir stehen vor Gott. Daraus kommt nicht Angst oder Verklemmung, auch kein äußerer Rubrikengehorsam, noch weniger gegenseitige Selbstdarstellung oder zuchtloses Geschrei. Da war vielmehr das, was die Väter »sobria ebrietas« nannten: das Erfülltsein von einer Freude, die doch nüchtern und geordnet bleibt, die Menschen von innen her eint in den gemeinsamen Lobpreis Gottes hinein, der zugleich die Liebe zum Nächsten, die Verantwortung füreinander weckt.
Zu der Afrika-Reise gehörte natürlich vor allem auch die Begegnung mit den Brüdern im Bischofsamt und die Eröffnung der Afrika-Synode durch die Übergabe des »Instrumentum laboris«. Sie geschah im Rahmen eines abendlichen Gesprächs am Festtag des hl. Josef, bei dem die Vertreter der einzelnen Episkopate auf beeindruckende Weise ihre Hoffnungen und Sorgen dargestellt haben. Ich denke, daß der gute Hausvater Sankt Josef, der das sorgende und hoffende Abwägen der weiteren Wege der Familie selbst gut kennt, uns liebevoll zugehört und uns auch sein Geleit in die Synode selbst hineingegeben hat. Werfen wir nur einen kurzen Blick auf die Synode. Bei meinem Besuch in Afrika war vor allem die theologische und pastorale Kraft des päpstlichen Primats als Sammelpunkt für die Einheit der Familie Gottes sichtbar geworden. Hier, in der Synode, erschien um so stärker die Bedeutung der Kollegialität – die Einheit der Bischöfe, die ihr Amt ja gerade dadurch empfangen, daß sie in die Gemeinschaft der Apostelnachfolger eintreten: Jeder ist nur Bischof, Apostelnachfolger im Mitsein der Gemeinschaft derer, in denen das »Collegium Apostolorum« in der Einheit mit Petrus und seinem Nachfolger weitergeht. Wie in den Liturgien in Afrika und dann wieder in Sankt Peter in Rom die liturgische Erneuerung des II. Vaticanums vorbildlich Gestalt annahm, so wurde im Miteinander der Synode die Ekklesiologie des Konzils ganz praktisch gelebt. Bewegend waren auch die Zeugnisse, die wir von den Gläubigen aus Afrika hören durften – Zeugnisse konkreten Leidens und Versöhnens in den Dramen der jüngsten Geschichte des Kontinents.
Die Synode hatte sich das Thema gestellt: Die Kirche in Afrika im Dienst von Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden. Dies ist ein theologisches und vor allem ein pastorales Thema von brennender Aktualität, aber es konnte auch als ein politisches Thema mißverstanden werden. Die Aufgabe der Bischöfe war es, die Theologie zur Pastoral zu machen, das heißt zu ganz konkretem Hirtendienst, in dem die großen Visionen der Heiligen Schrift und der Überlieferung praktisch angewandt werden auf das Wirken der Bischöfe und Priester in einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort. Dabei durfte man aber nicht der Versuchung verfallen, selbst die Politik in die Hand zu nehmen und sich aus Hirten zu politischen Führen zu machen. In der Tat ist es ja immer wieder die ganz praktische Frage, vor der die Hirten der Kirche stehen: Wie können wir realistisch und praktisch sein, ohne uns eine politische Kompetenz anzumaßen, die uns nicht zusteht? Wir könnten auch sagen: Es ging um das Problem einer praktizierten und recht ausgelegten positiven »laïcité«. Dies ist auch ein Grundthema der am Peter- und Pauls-Tag veröffentlichten Enzyklika »Caritas in veritate«, die damit die Frage nach dem theologischen und praktischen Ort der katholischen Soziallehre aufgenommen und weitergeführt hat.
Ist es den Synodenvätern gelungen, den eher schmalen Weg zwischen bloßer theologischer Theorie und direkter politischer Aktion zu finden, den Weg des »Hirten«? In meiner kleinen Rede zum Abschluß der Synode habe ich dies bewußt und ausdrücklich bejaht. Natürlich werden wir bei der Ausarbeitung des postsynodalen Dokuments darauf achten müssen, diese Balance einzuhalten und damit den Beitrag für Kirche und Gesellschaft in Afrika zu leisten, der der Kirche von ihrer Sendung her aufgetragen ist. Ich möchte dies an einem einzelnen Punkt ganz kurz zu erläutern versuchen. Wie schon gesagt, nennt das Thema der Synode drei große Grundworte theologischer und sozialer Verantwortung: Versöhnung – Gerechtigkeit – Friede. Man könnte sagen, daß Versöhnung und Gerechtigkeit die beiden wesentlichen Voraussetzungen von Friede sind und so bis zu einem gewissen Grad auch dessen Wesen definieren. Beschränken wir uns auf das Wort Versöhnung. Ein Blick auf die Leiden und Nöte der jüngeren Geschichte Afrikas, aber auch in vielen anderen Teilen der Erde zeigt, daß ungelöste und tief verwurzelte Gegensätze in bestimmten Situationen zu Explosionen der Gewalt führen können, in denen alle Menschlichkeit verloren scheint. Friede kann nur werden, wenn es zu innerer Versöhnung kommt. Als positives Beispiel für einen gelingenden Versöhnungsprozeß können wir die Geschichte Europas seit dem Zweiten Weltkrieg ansehen. Daß es in West- und Mitteleuropa seit 1945 keine Kriege mehr gegeben hat, beruht sicher wesentlich auf intelligenten und moralisch geformten politischen und ökonomischen Strukturen, aber die konnten sich doch nur bilden, weil es innere Prozesse des Versöhnens gab, die ein neues Miteinander ermöglicht haben. Jede Gesellschaft braucht Versöhnungen, damit Friede sein kann. Versöhnungen sind für gute Politik notwendig, aber von der Politik allein nicht zu leisten. Sie sind vorpolitische Prozesse, die aus anderen Quellen kommen müssen.
Die Synode hat versucht, den Begriff Versöhnung als Auftrag an die Kirche von heute auszuleuchten und dabei auf seine verschiedenen Dimensionen aufmerksam gemacht. Der Ruf, den der hl. Paulus an die Korinther gerichtet hat, ist gerade heute von neuer Aktualität. »Wir sind Gesandte an Christi Statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Statt: Laßt euch mit Gott versöhnen!« (2 Kor 5,20). Wenn der Mensch mit Gott nicht versöhnt ist, ist er auch mit der Schöpfung im Unfrieden. Er ist unversöhnt mit sich selbst, möchte sich selbst als einen anderen haben und ist daher auch unversöhnt mit dem Nächsten. Zur Versöhnung gehört des weiteren die Fähigkeit, Schuld zu erkennen und um Vergebung zu bitten – Gott und den anderen Menschen. Zum Vorgang der Versöhnung gehört schließlich die Bereitschaft zur Buße, die Bereitschaft, Schuld auszuleiden und sich selbst ändern zu lassen. Und es gehört dazu die »gratuitas«, von der die Enzyklika »Caritas in veritate« mehrfach spricht: die Bereitschaft, über das Notwendige hinauszugehen, nicht aufzurechnen, sondern weiterzugehen als die bloßen Rechtsverhältnisse es verlangen. Es gehört dazu jene Großzügigkeit, die Gott selbst uns vorgemacht hat. Denken wir an das Wort Jesu: Wenn du deine Gabe zum Altar bringst und du erinnerst dich, daß dein Bruder etwas gegen dich hat, laß die Gabe liegen, brich auf, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, und dann komm und bring deine Gabe (Mt 5,23f.). Gott, der uns unversöhnt wußte, der sah, daß wir etwas gegen ihn haben, ist aufgestanden und uns entgegengegangen, obwohl er allein im Recht war. Er ist uns entgegengegangen bis zum Kreuz hin, um uns zu versöhnen. Das ist »gratuitas«: die Bereitschaft, zuerst aufzubrechen. Zuerst dem anderen entgegenzugehen, ihm die Versöhnung anzubieten, den Schmerz auf sich zu nehmen, der im Verzicht auf das eigene Rechthaben liegt. Nicht nachzulassen im Willen des Versöhnens: Das hat Gott uns vorgemacht, und dies ist die Weise, gottähnlich zu werden, die wir in der Welt immer von neuem brauchen. Wir müssen heute die Fähigkeit neu erlernen, Schuld anzuerkennen, den Unschuldswahn abzuschütteln. Wir müssen die Fähigkeit erlernen, Buße zu tun, uns ändern zu lassen; dem anderen entgegenzugehen und von Gott her uns den Mut und die Kraft zu solcher Erneuerung schenken zu lassen. In dieser unserer Welt von heute müssen wir das Sakrament der Buße und der Versöhnung neu entdecken. Daß es aus den Lebensvollzügen der Christen weitgehend verschwunden ist, ist ein Symptom für einen Verlust an Wahrhaftigkeit uns selbst und Gott gegenüber; ein Verlust, der unsere Menschlichkeit gefährdet und der unsere Friedensfähigkeit vermindert. Der hl. Bonaventura war der Meinung, daß das Sakrament der Buße ein Menschheitssakrament ist, das Gott in seinem wesentlichen Grund schon unmittelbar nach dem Sündenfall mit der Buße für Adam eingesetzt habe, auch wenn es seine ganze Gestalt erst in Christus erhalten konnte, der selbst die versöhnende Kraft Gottes ist und unsere Buße auf sich genommen hat. In der Tat, die Einheit von Schuld, Buße und Vergebung ist eine der Grundbedingungen der Menschlichkeit, die im Sakrament ihre volle Gestalt erhalten, aber von den Wurzeln her zum Menschsein als solchem gehören. Die Bischofssynode für Afrika hat deshalb mit Recht Versöhnungsrituale der afrikanischen Tradition mit in ihre Betrachtungen einbezogen als Lernorte und Vorbereitungen für die große Versöhnung, die Gott uns im Bußsakrament schenkt. Diese Versöhnung braucht aber den weiten Vorhof der Anerkenntnis von Schuld und der Demut des Büßens. Versöhnung ist ein vorpolitischer Begriff und eine vorpolitische Realität, die gerade so von höchster Bedeutung für die Aufgabe der Politik selbst ist. Wenn nicht in den Herzen die Kraft des Versöhnens geschaffen wird, fehlt dem politischen Ringen um den Frieden die innere Voraussetzung. In der Synode haben sich die Hirten der Kirche um jene innere Reinigung des Menschen gemüht, die die wesentliche Voraussetzung für den Aufbau der Gerechtigkeit und des Friedens darstellt. Diese innere Reinigung und Reifung zu wahrer Menschlichkeit gibt es aber nicht ohne Gott.
Versöhnung – bei diesem Stichwort kommt mir die zweite große Reise des vergangenen Jahres in den Sinn: die Pilgerfahrt nach Jordanien und ins Heilige Land. Dabei möchte ich zuallererst dem König von Jordanien herzlich danken für die große Gastfreundschaft, mit der er mich empfangen und auf dem ganzen Weg meiner Pilgerschaft begleitet hat. Mein Dank gilt besonders auch für die vorbildliche Weise, in der er sich um das friedliche Miteinander von Christen und Moslems müht, um die Ehrfurcht vor der Religion des anderen und um das Miteinander in der gemeinsamen Verantwortung vor Gott. Ebenso danke ich der Regierung von Israel herzlich für alles, was sie getan hat, damit der Besuch friedlich und in Sicherheit verlaufen konnte. Besonders dankbar bin ich für die Möglichkeit, zwei große öffentliche Gottesdienste – in Jerusalem und in Nazaret – zu feiern, in denen die Christen sich öffentlich als Gemeinschaft des Glaubens im Heiligen Land darstellen konnten. Schließlich gilt mein Dank der palästinensischen Autorität, die mich gleichfalls mit großer Herzlichkeit aufgenommen, mir ebenfalls einen öffentlichen Gottesdienst in Betlehem möglich gemacht hat und mich die Leiden wie die Hoffnungen ihres Landes erfahren ließ. Alles, was in diesen Ländern zu sehen ist, ruft nach Versöhnung, nach Gerechtigkeit, nach Frieden. Der Besuch in Yad Vashem bedeutete eine erschütternde Begegnung mit der Grausamkeit menschlicher Schuld, mit dem Haß einer verblendeten Ideologie, die Millionen von Menschen grundlos dem Tod preisgab und damit letztlich auch Gott, den Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs und den Gott Jesu Christi aus der Welt verdrängen wollte. So ist dies zuallererst ein Mahnmal gegen den Haß, ein Ruf nach Reinigung und Vergebung, nach Liebe. Gerade dieses Denkmal menschlicher Schuld machte dann den Besuch bei den Erinnerungsorten des Glaubens um so wichtiger und ließ deren unverbrauchte Aktualität spüren. In Jordanien haben wir den tiefsten Punkt der Erde am Jordan gesehen. Wie sollte man sich da nicht erinnert fühlen an das Wort aus dem Epheserbrief, daß Christus hinabgestiegen ist »in die untersten Teile der Erde« (Eph 4,9). In Christus ist Gott hinabgestiegen bis in die letzte Tiefe des Menschseins, bis in die Nacht des Hasses und der Verblendung, bis in die Dunkelheit der Gottesferne des Menschen, um dort das Licht seiner Liebe zu entzünden. Auch in der tiefsten Nacht ist er: Auch in der Unterwelt bist du zugegen – dieses Wort aus Ps 139 [138], 8 ist im Abstieg Jesu Wahrheit geworden. So war dann das Begegnen mit den Orten des Heils in der Verkündigungskirche in Nazaret, der Geburtsgrotte zu Betlehem, der Kreuzigungsstätte auf Golgota, dem leeren Grab als Zeugnis der Auferstehung gleichsam ein Berühren der Geschichte Gottes mit uns. Der Glaube ist kein Mythos. Er ist wahre Geschichte, deren Spuren wir anrühren können. Dieser Realismus des Glaubens tut uns in den Bedrängnissen der Gegenwart besonders gut. Gott hat sich wirklich gezeigt. In Jesus Christus hat er wirklich Fleisch angenommen. Er bleibt als Auferstandener wahrer Mensch, öffnet immerfort unser Menschsein auf Gott hin und ist uns immerfort Gewähr dafür, daß Gott ein naher Gott ist. Ja, Gott lebt, und er geht uns an. In all seiner Größe ist er doch der nahe Gott, der Gott mit uns, der uns immerfort zuruft: Laßt euch mit mir und miteinander versöhnen. Immer stellt er den Auftrag des Versöhnens in unser persönliches und gemeinschaftliches Leben hinein.
Schließlich möchte ich auch noch ein Wort des Dankes und der Freude zu meiner Reise in die Tschechische Republik sagen. Immer wurde ich vorher darauf hingewiesen, daß dies ein Land mit einer Mehrheit von Agnostikern und Atheisten sei, in dem die Christen nur noch eine Minderheit bilden. Um so freudiger war die Überraschung darüber, daß ich allenthalben von einer großen Herzlichkeit und Freundschaft umgeben war. Daß große Gottesdienste in einer freudigen Atmosphäre des Glaubens gefeiert wurden. Daß im Bereich der Universitäten und der Kultur mein Wort wache Aufmerksamkeit fand. Daß die Autoritäten des Staates mir mit großer Freundlichkeit begegneten und alles getan haben, um dem Besuch zum Erfolg zu verhelfen. Ich wäre jetzt versucht, etwas über die Schönheit des Landes und die großartigen Zeugnisse christlicher Kultur zu sagen, die diese Schönheit erst vollkommen machen. Vor allem aber ist mir wichtig, daß auch die Menschen, die sich als Agnostiker oder als Atheisten ansehen, uns als Gläubige angehen. Wenn wir von neuer Evangelisierung sprechen, erschrecken diese Menschen vielleicht. Sie wollen sich nicht als Objekt von Mission sehen und ihre Freiheit des Denkens und des Wollens nicht preisgeben. Aber die Frage nach Gott bleibt doch auch für sie gegenwärtig, auch wenn sie an die konkrete Weise seiner Zuwendung zu uns nicht glauben können. In Paris habe ich vom Gottsuchen als grundlegendem Antrieb gesprochen, aus dem das abendländische Mönchtum und mit ihm die abendländische Kultur geboren wurde. Als ersten Schritt von Evangelisierung müssen wir versuchen, diese Suche wachzuhalten; uns darum mühen, daß der Mensch die Gottesfrage als wesentliche Frage seiner Existenz nicht beiseite schiebt. Daß er die Frage und die Sehnsucht annimmt, die darin sich verbirgt. Hier fällt mir das Wort ein, das Jesus aus dem Propheten Jesaja zitiert hat: daß der Tempel von Jerusalem ein Gebetshaus für alle Völker sein solle (Jes 56,7; Mk 11,17). Er dachte dabei an den sogenannten Vorhof der Heiden, den er von äußeren Geschäftigkeiten räumte, damit der Freiraum da sei für die Völker, die hier zu dem einen Gott beten wollen, auch wenn sie dem Geheimnis nicht zugehören konnten, dem das Innere des Tempels diente. Gebetsraum für alle Völker – dabei war an Menschen gedacht, die Gott sozusagen nur von ferne kennen; die mit ihren Göttern, Riten und Mythen unzufrieden sind; die das Reine und Große ersehnen, auch wenn Gott für sie der »unbekannte Gott« bleibt (Apg 17,23). Sie sollten zum unbekannten Gott beten können und damit doch mit dem wirklichen Gott in Verbindung sein, wenn auch in vielerlei Dunkelheit. Ich denke, so eine Art »Vorhof der Heiden« müsse die Kirche auch heute auftun, wo Menschen irgendwie sich an Gott anhängen können, ohne ihn zu kennen und ehe sie den Zugang zum Geheimnis gefunden haben, dem das innere Leben der Kirche dient. Zum Dialog der Religionen muß heute vor allem auch das Gespräch mit denen hinzutreten, denen die Religionen fremd sind, denen Gott unbekannt ist und die doch nicht einfach ohne Gott bleiben, ihn wenigstens als Unbekannten dennoch anrühren möchten.
Zuletzt noch einmal ein Wort zum Jahr der Priester. Als Priester sind wir für alle da: für die, die Gott aus der Nähe kennen und für die, denen er der Unbekannte ist. Wir alle müssen ihn immer wieder neu kennenlernen und müssen ihn immer neu suchen, damit wir wirkliche Freunde Gottes werden. Wie anders als durch Menschen, die Freunde Gottes sind, könnten wir zuletzt Gott kennenlernen? Der tiefste Kern unseres priesterlichen Dienstes ist es, Freunde Christi (Joh 15,15), Freunde Gottes zu sein, durch die auch andere Menschen Gott nahe werden können. So ist mit meinem herzlichen Dank für alle Hilfe das ganze Jahr hindurch dies mein Wunsch zu Weihnachten: Daß wir immer mehr Freunde Jesu Christi und so Freunde Gottes werden und dadurch Salz der Erde und Licht der Welt sein dürfen. Gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr!<ref> Die deutsche Fassung auf der Vatikanseite aus dem Jahre 2009</ref>
2010
am 20. Dezember in der "Sala Regia", Apostolischer Palast
hochwürdige Mitbrüder im Bischofs- und Priesteramt,
Mit großer Freude komme ich zu dieser traditionellen Begegnung mit Ihnen, liebe Mitglieder des Kardinalskollegiums und Vertreter der Römischen Kurie und des Governatorats. Von Herzen begrüße ich jeden einzelnen, angefangen bei Kardinal Angelo Sodano, dem ich für die Worte der Ergebenheit und der Verbundenheit sowie für die freundlichen Glückwünsche danke, die er im Namen aller an mich gerichtet hat. Prope est jam Dominus, venite, adoremus! Wie eine einzige Familie betrachten wir das Geheimnis des Immanuel, des Gott-mit-uns, wie der Kardinal Dekan gesagt hat. Gerne erwidere ich die Glückwünsche und möchte allen, einschließlich der Vertreter des Heiligen Stuhls in aller Welt, aufrichtig danken für den kompetenten und großherzigen Beitrag, den ein jeder für den Vicarius Christi und für die Kirche leistet.
“Excita, Domine, potentiam tuam, et veni” – so und mit ähnlichen Worten betet die Liturgie der Kirche wiederholt in den Tagen des Advents. Es sind Gebete, die wohl in der Zeit des untergehenden Römischen Reiches formuliert worden sind. Die Auflösung der tragenden Ordnungen des Rechts und der moralischen Grundhaltungen, die ihnen Kraft gaben, ließ die Dämme zerbrechen, die bisher das friedliche Miteinander der Menschen geschützt hatten. Eine Welt war im Untergang begriffen. Häufige Naturkatastrophen verstärkten noch diese Erfahrung der Ungeborgenheit. Es war keine Macht in Sicht, die dem hätte Einhalt gebieten können. Um so dringender war der Ruf nach Gottes eigener Macht: daß er komme und die Menschen gegen all diese Drohungen schütze.
“Excita, Domine, potentiam tuam, et veni.” Auch heute haben wir vielfältigen Anlaß, in dieses adventliche Beten der Kirche einzustimmen. Die Welt ist mit all ihren neuen Hoffnungen und Möglichkeiten doch zugleich bedrängt von dem Gefühl, daß der moralische Konsens zerfällt, ohne den die rechtlichen und politischen Strukturen nicht funktionieren, so daß die Kräfte, die zu ihrer Verteidigung aufgeboten werden, zum Mißerfolg verurteilt scheinen.
Excita – das Gebet erinnert an den Ruf zum Herrn, der im sturmgeschüttelten und dem Untergang nahen Boot der Jünger schlief. Als sein Machtwort den Sturm gestillt hatte, tadelte er die Jünger, daß sie so wenig Glauben hatten (Mt 8, 26 par.). Er wollte sagen: In euch selbst hat der Glaube geschlafen. Dasselbe wird er auch zu uns sagen. Auch in uns schläft der Glaube so oft. So bitten wir ihn, daß er uns aus dem Schlaf eines müde gewordenen Glaubens aufwecke und dem Glauben wieder Macht gebe, Berge zu versetzen – das heißt den Dingen der Welt ihre rechte Ordnung zu geben.
“Excita, Domine, potentiam tuam, et veni”: Dieses Adventsgebet ist mir in den großen Bedrängnissen, denen wir im vergangenen Jahr ausgesetzt waren, immer wieder in die Gedanken und auf die Lippen gekommen. Wir hatten mit großer Freude das Jahr des Priestertums begonnen, und wir durften es auch gottlob mit großer Dankbarkeit beenden, obwohl es so ganz anders verlaufen ist, als wir erwartet hatten. Es ist uns Priestern und den Laien, gerade auch jungen Menschen, wieder bewußt geworden, welches Geschenk das Priestertum der katholischen Kirche darstellt, das uns vom Herrn anvertraut worden ist. So ist uns wieder bewußt geworden, wie schön es ist, daß Menschen im Namen Gottes und mit Vollmacht das Wort der Vergebung aussprechen dürfen und so die Welt, das Leben ändern können. Wie schön es ist, daß Menschen das Wort der Verwandlung sprechen dürfen, mit dem der Herr ein Stück Welt in sich hineinzieht und sie so an einer Stelle in ihrer Substanz umwandelt. Wie schön es ist, Menschen vom Herrn her in ihren Freuden und Leiden, in den großen wie in den dunklen Stunden des Lebens beistehen zu dürfen. Wie schön es ist, im Leben nicht dies oder jenes zum Auftrag zu haben, sondern einfach das Menschsein selbst – das Helfen dazu, daß es auf Gott hin offen werde und von Gott her gelebt. Um so mehr waren wir erschüttert, gerade in diesem Jahr in einem Umfang, den wir uns nicht hatten vorstellen können, Fälle von Mißbrauch Minderjähriger durch Priester kennenzulernen, die das Sakrament in sein Gegenteil verkehren, den Menschen in seiner Kindheit – unter dem Deckmantel des Heiligen – zuinnerst verletzen und Schaden für das ganze Leben zufügen.
Mir ist dabei eine Vision der heiligen Hildegard von Bingen in den Sinn gekommen, die in erschütternder Weise das beschreibt, was wir in diesem Jahr erfahren haben. „Im Jahre 1170 nach Christi Geburt lag ich lange krank danieder. Da schaute ich, wach an Körper und Geist, eine Frau von solcher Schönheit, daß Menschengeist es nicht zu fassen vermochte. Ihre Gestalt ragte von der Erde bis zum Himmel. Ihr Antlitz leuchtete von höchstem Glanz. Ihr Auge blickte zum Himmel. Bekleidet war sie mit einem strahlendhellen Gewand aus weißer Seide und einem Mantel, besetzt mit kostbaren Steinen. An den Füßen trug sie Schuhe aus Onyx. Aber ihr Antlitz war mit Staub bestreut, ihr Gewand war an der rechten Seite zerrissen. Auch hatte der Mantel seine erlesene Schönheit verloren, und ihre Schuhe waren von oben her beschmutzt. Mit lauter, klagender Stimme schrie sie zum hohen Himmel hinauf: Horch auf, Himmel; mein Antlitz ist besudelt! Trauere, Erde: mein Kleid ist zerrissen! Erzittere, Abgrund: meine Schuhe sind beschmutzt!
Und weiter sprach sie: Im Herzen des Vaters war ich verborgen, bis der Menschensohn, in Jungfräulichkeit empfangen und geboren, sein Blut vergoß. Mit diesem Blut, als seiner Mitgift, hat er mich sich vermählt.
Die Wundmale meines Bräutigams bleiben frisch und offen, solange die Sündenwunden der Menschen offen sind. Eben dieses Offenbleiben der Wunden Christi ist die Schuld der Priester. Mein Gewand zerreißen sie dadurch, daß sie Übertreter des Gesetzes, des Evangeliums und ihrer Priesterpflicht sind. Meinem Mantel nehmen sie den Glanz, da sie die ihnen auferlegten Vorschriften in allem vernachlässigen. Sie beschmutzen meine Schuhe, da sie die geraden, das heißt die harten und rauhen Wege der Gerechtigkeit nicht einhalten und auch ihren Untergebenen kein gutes Beispiel geben. Dennoch finde ich bei einigen das Leuchten der Wahrheit.
Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, die sprach: Dieses Bild stellt die Kirche dar. Deshalb, o Mensch, der du das schaust und die Klageworte hörst, künde es den Priestern, die zur Leitung und Belehrung des Gottesvolkes bestellt sind und denen gleich den Aposteln gesagt wurde: ‚Geht hinaus in die Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!’ (Mk 16, 15)“ (Brief an Werner von Kirchheim und an seine Priestergemeinschaft: PL 197, 269ff).
Das Gesicht der Kirche ist in der Vision der heiligen Hildegard mit Staub bedeckt, und so haben wir es gesehen. Ihr Gewand ist zerrissen - durch die Schuld der Priester. So, wie sie es gesehen und gesagt hat, haben wir es in diesem Jahr erlebt. Wir müssen diese Demütigung als einen Anruf zur Wahrheit und als einen Ruf zur Erneuerung annehmen. Nur die Wahrheit rettet. Wir müssen fragen, was wir tun können, um geschehenes Unrecht so weit wie möglich gutzumachen. Wir müssen fragen, was in unserer Verkündigung, in unserer ganzen Weise, das Christsein zu gestalten, falsch war, daß solches geschehen konnte. Wir müssen zu einer neuen Entschiedenheit des Glaubens und des Guten finden. Wir müssen zur Buße fähig sein. Wir müssen uns mühen, in der Vorbereitung zum Priestertum alles zu versuchen, damit solches nicht wieder geschehen kann. Es ist dies auch der Ort, all denen von Herzen zu danken, die sich einsetzen, den Opfern zu helfen und ihnen das Vertrauen zur Kirche, die Fähigkeit, ihrer Botschaft zu glauben, wiederzuschenken. Bei meinen Begegnungen mit Opfern dieser Sünde habe ich immer auch Menschen getroffen, die mit großer Hingabe den Leidenden und Geschädigten zur Seite stehen. Es ist Anlaß, dabei auch den vielen guten Priestern zu danken, die die Güte des Herrn in Demut und Treue weitertragen und mitten in den Zerstörungen Zeugen sind für die unverlorene Schönheit des Priestertums.
Der besonderen Schwere dieser Sünde von Priestern und unserer entsprechenden Verantwortung sind wir uns bewußt. Aber wir können auch nicht schweigen über den Kontext unserer Zeit, in dem diese Vorgänge zu sehen sind. Es gibt einen Markt der Kinderpornographie, der irgendwie von der Gesellschaft immer mehr als etwas Selbstverständliches angesehen zu werden scheint. Die seelische Zerstörung der Kinder, in der Menschen zum Marktartikel gemacht werden, ist ein erschreckendes Zeichen der Zeit. Von Bischöfen aus den Ländern der Dritten Welt höre ich immer wieder, wie der Sextourismus eine ganze Generation bedroht und sie in ihrer Freiheit und Menschenwürde beschädigt. Die Apokalypse des heiligen Johannes rechnet es unter die großen Sünden Babylons, das heißt der gottlosen Riesenstädte der Welt, daß sie mit Leibern und mit Seelen Handel treiben und sie zur Ware machen (Apk 18, 13). In diesem Zusammenhang steht auch das Problem der Droge, die mit wachsender Gewalt ihre Polypenarme um den Erdball streckt – sichtbarer Ausdruck der Diktatur des Mammons, der den Menschen pervertiert. Alle Lust wird zu wenig, und die Übersteigerung in der Lüge des Rausches wird zur Gewalt, die ganze Regionen zerfleischt und dies im Namen eines fatalen Mißverständnisses von Freiheit, bei dem gerade die Freiheit des Menschen untergraben und schließlich vollends aufgelöst wird.
Um diesen Mächten entgegenzutreten, müssen wir einen Blick auf ihre ideologischen Grundlagen werfen. In den 70er Jahren wurde Pädophilie als etwas durchaus dem Menschen und auch dem Kind Gemäßes theoretisiert. Dies aber war Teil einer grundlegenden Perversion des Konzepts von Ethos. Es wurde – auch bis in die katholische Theologie hinein – behauptet, das in sich Böse gebe es so wenig, wie es das an sich Gute gebe. Es gebe nur „besser als“ und „schlechter als“. Nichts sei in sich gut oder schlecht. Alles hänge von den Umständen und von der Zwecksetzung ab. Je nach den Zwecken und Umständen könne alles gut oder auch schlecht sein. Moral wird durch ein Kalkül der Folgen ersetzt und hört damit auf, als solche zu bestehen. Die Folgen dieser Theorien sind heute offenkundig. Ihnen gegenüber hat Papst Johannes Paul II. 1993 in seiner Enzyklika Veritatis Splendor mit prophetischer Kraft in der großen rationalen Tradition des christlichen Ethos die wesentlichen und bleibenden Grundlagen moralischen Handelns herausgestellt. Dieser Text muß heute als Weg der Gewissensbildung neu ins Zentrum gerückt werden. Es ist unsere Verantwortung, in der Menschheit diese Maßstäbe als Wege der wahren Humanität neu hörbar und verstehbar zu machen in der Sorge um den Menschen, in die wir hineingeworfen sind.
An zweiter Stelle möchte ich ein Wort über die Synode der Kirchen des Nahen Ostens sagen. Sie begann mit meiner Reise nach Zypern, wo ich den dort hingekommenen Bischöfen dieser Länder das Arbeitsinstrument für die Synode übergeben konnte. Unvergessen bleibt die Gastfreundschaft der orthodoxen Kirche, die wir mit großem Dank erfahren durften. Auch wenn uns die volle Kommuniongemeinschaft noch nicht geschenkt ist, haben wir doch freudig erlebt, daß uns die Grundform der alten Kirche – das sakramentale Bischofsamt als Träger der apostolischen Überlieferung, die Lektüre der Schrift unter der Hermeneutik der Glaubensregel, das Verstehen der Schrift in der durch Gottes Inspiration gewachsenen vielfältigen Einheit mit Christus und schließlich der Glaube an die Zentralität der Eucharistie im Leben der Kirche - tief miteinander verbindet. So ist uns der Reichtum der altkirchlichen Riten auch innerhalb der katholischen Kirche lebendig begegnet. Wir haben an Gottesdiensten mit Maroniten und Melkiten teilgenommen, im lateinischen Ritus gefeiert und uns zum ökumenischen Gebet mit den Orthodoxen zusammengefunden, und wir haben die reiche christliche Kultur des christlichen Orients in beeindruckenden Veranstaltungen erleben dürfen. Aber wir haben auch das Problem des geteilten Landes erlebt. Schuld der Vergangenheit und tiefgehende Verletzungen wurden sichtbar, aber auch die Sehnsucht nach Frieden und Gemeinschaft, wie sie früher bestanden hatten. Allen ist bewußt, daß Gewalt nicht weiterführt – sie hat ja den jetzigen Zustand geschaffen. Nur im Kompromiß und im gegenseitigen Verstehen kann Einheit wiederhergestellt werden. Die Menschen für diese Haltung des Friedens zu bereiten, ist eine wesentliche Aufgabe der Seelsorge.
Bei der Synode hat sich dann der Blick auf den ganzen Vorderen Orient geweitet, wo Gläubige zusammenleben, die verschiedenen Religionen wie auch vielfältigen Traditionen und unterschiedlichen Riten angehören. Was die Christen betrifft, so gibt es die vorchalkedonischen und die chalkedonischen Kirchen; Kirchen in Gemeinschaft mit Rom und solche, die außerhalb dieser Gemeinschaft stehen, und in beiden stehen vielfältige Riten nebeneinander. In den Umwälzungen der letzten Jahre ist die Geschichte des Miteinander erschüttert worden, die Spannungen und die Spaltungen sind gewachsen, so daß wir immer wieder erschrocken Zeugen von Gewalttätigkeiten werden, in denen nicht mehr geachtet wird, was dem anderen heilig ist, ja, in denen die elementarsten Regeln der Menschlichkeit zusammenbrechen. In der gegenwärtigen Situation sind die Christen die am meisten bedrängte und gequälte Minderheit. Sie haben über Jahrhunderte hin mit ihren jüdischen und muslimischen Nachbarn friedlich zusammengelebt. In der Synode haben wir weise Worte des Beraters des Mufti der Republik Libanon gegen die Gewalttaten den Christen gegenüber gehört. Er sagte: Mit der Verletzung der Christen werden wir selbst verletzt. Aber leider sind diese und ähnliche Stimmen der Vernunft, für die wir zutiefst dankbar sind, zu schwach. Auch hier ist das Hindernis die Verbindung von Gewinnsucht und ideologischer Verblendung. Die Synode hat aus dem Geist des Glaubens und seiner Vernunft heraus ein großes Konzept des Dialogs, des Vergebens und des Sich-Annehmens entwickelt, das wir nun in die Welt hineinrufen wollen. Der Mensch ist nur einer, und die Menschheit ist eine. Was irgendwo Menschen angetan wird, verletzt letztlich alle. So sollen die Worte und Gedanken der Synode ein lauter Ruf an alle Menschen mit politischer oder religiöser Verantwortung sein, der Christianophobie Einhalt zu gebieten; aufzustehen, um die Vertriebenen und die Leidenden zu verteidigen und den Geist der Versöhnung neu zu beleben. Letztlich kann die Heilung nur aus einem tiefen Glauben an die versöhnende Liebe Gottes kommen. Diesem Glauben Kraft zu geben, ihn zu nähren und ihn leuchten zu lassen, ist die Hauptaufgabe der Kirche in dieser Stunde.
Gern würde ich ausführlich über die unvergeßliche Reise ins Vereinigte Königreich sprechen, möchte mich aber auf zwei Punkte beschränken, die dem Thema der Verantwortung der Christen in dieser Zeit und dem Auftrag der Kirche zur Verkündigung des Evangeliums zugeordnet sind. Da ist zuerst die Begegnung mit der Welt der Kultur in der Westminster Hall, in der das Bewußtsein für die gemeinsame Verantwortung dieser historischen Stunde eine große Aufmerksamkeit schuf, die letztlich der Frage nach der Wahrheit und dem Glauben selber galt. Daß in diesem Ringen die Kirche mitsprechen muß, war allen offenkundig. Alexis de Tocqueville hatte seinerzeit festgestellt, daß die Demokratie in Amerika möglich wurde und funktionierte, weil es einen über die einzelnen Denominationen hinüberreichenden moralischen Grundkonsens gab, der alle verband. Nur wenn es einen solchen Konsens im Wesentlichen gibt, können Verfassungen und Recht funktionieren. Dieser aus dem christlichen Erbe gekommene Grundkonsens ist da gefährdet, wo an seine Stelle, an die Stelle der moralischen Vernunft die bloße Zweckrationalität tritt, von der ich vorhin gesprochen hatte. Dies ist in Wirklichkeit eine Erblindung der Vernunft für das Eigentliche. Gegen diese Erblindung der Vernunft anzukämpfen und ihr die Sehfähigkeit für das Wesentliche, für Gott und den Menschen, für das Gute und das Wahre zu erhalten, ist das gemeinsame Anliegen, das alle Menschen guten Willens verbinden muß. Es geht um die Zukunft der Welt.
Schließlich möchte ich noch an die Seligsprechung von John Henry Kardinal Newman erinnern. Warum wurde er seliggesprochen? Was hat er uns zu sagen? Auf diese Fragen gibt es viele Antworten, die im Umkreis der Seligsprechung entfaltet worden sind. Ich möchte daraus nur zwei Aspekte hervorheben, die eng zusammengehören und im letzten dasselbe ausdrücken. Das erste ist, daß wir von den drei Bekehrungen Newmans zu lernen haben, weil sie Schritte eines geistigen Weges sind, der uns alle angeht. Herausheben möchte ich hier nur die erste Bekehrung: die zum Glauben an den lebendigen Gott. Bis dahin dachte Newman wie der Durchschnitt der Menschen seiner Zeit und wie auch der Durchschnitt der Menschen von heute, die Gottes Existenz nicht einfach ausschließen, aber sie doch als etwas Unsicheres ansehen, das im eigenen Leben keine wesentliche Rolle spielt. Als das eigentlich Reale erschien ihm wie den Menschen seiner und unserer Zeit das Empirische, das materiell Faßbare. Dies ist die „Realität“, an der man sich orientiert. Das „Reale“ ist das Greifbare, sind die Dinge, die man berechnen und in die Hand nehmen kann. In seiner Bekehrung erkennt Newman, daß es genau umgekehrt ist: daß Gott und die Seele, das geistige Selbstsein des Menschen, das eigentlich Wirkliche sind, worauf es ankommt. Daß sie viel wirklicher sind als die faßbaren Gegenstände. Diese Bekehrung bedeutet eine kopernikanische Wende. Was bisher unwirklich und unwesentlich erschien, erweist sich als das eigentlich Entscheidende. Wo eine solche Bekehrung geschieht, ändert sich nicht eine Theorie, sondern die Grundgestalt des Lebens wird anders. Dieser Bekehrung bedürfen wir alle immer wieder: Dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Die treibende Kraft hinter dem Weg der Bekehrung war bei Newman das Gewissen. Was aber ist damit gemeint? Im modernen Denken bedeutet das Wort Gewissen, daß in Sachen Moral und Religion das Subjektive, das Individuum die letzte Entscheidungsinstanz darstellt. Die Welt wird in die Bereiche des Objektiven und des Subjektiven geschieden. Das Objektive sind die Dinge, die man berechnen und im Experiment überprüfen kann. Religion und Moral entziehen sich diesen Methoden und gelten daher als der Bereich des Subjektiven. Da gebe es letztlich keine objektiven Maßstäbe. Die letzte Instanz, die hier entscheiden kann, sei daher nur das Subjekt, und mit dem Wort „Gewissen“ wird dann eben dies ausgesagt: In diesem Bereich kann nur der einzelne, das Individuum mit seinen Einsichten und Erfahrungen entscheiden. Newmans Auffassung von Gewissen ist dem diametral entgegengesetzt. „Gewissen“ bedeutet für ihn die Wahrheitsfähigkeit des Menschen: die Fähigkeit, gerade in den entscheidenden Bereichen seiner Existenz – Religion und Moral – Wahrheit, die Wahrheit zu erkennen. Das Gewissen, die Fähigkeit des Menschen zum Erkennen der Wahrheit legt ihm damit zugleich die Verpflichtung auf, sich auf den Weg zur Wahrheit zu begeben, nach ihr zu suchen und sich ihr zu unterwerfen, wo er ihr begegnet. Gewissen ist Fähigkeit zur Wahrheit und Gehorsam gegenüber der Wahrheit, die sich dem offenen Herzens suchenden Menschen zeigt. Der Weg der Bekehrungen Newmans ist ein Weg des Gewissens – nicht der sich behauptenden Subjektivität, sondern gerade umgekehrt des Gehorsams gegenüber der Wahrheit, die sich ihm Schritt um Schritt öffnete. Seine dritte Bekehrung, die Konversion zum Katholizismus, verlangte von ihm, fast alles aufzugeben, was ihm lieb und teuer war: Besitz und Beruf, seinen akademischen Rang, Familienbande und viele Freunde. Der Verzicht, den ihm der Gehorsam gegenüber der Wahrheit, sein Gewissen, abverlangte, ging noch weiter. Newman hatte immer gewußt, daß er eine Sendung für England habe. Aber in der katholischen Theologie seiner Zeit konnte seine Stimme kaum gehört werden. Sie war zu fremd gegenüber der herrschenden Form des theologischen Denkens und auch der Frömmigkeit. Im Januar 1863 schrieb er in sein Tagebuch die erschütternden Sätze: „Als Protestant empfand ich meine Religion kümmerlich, aber nicht mein Leben. Und nun, als Katholik, ist mein Leben kümmerlich, aber nicht meine Religion.“ Die Stunde seiner Wirksamkeit war noch nicht da. Er mußte in der Demut und im Dunkel des Gehorsams warten, bis seine Botschaft gebraucht und verstanden wurde. Um Newmans Gewissensbegriff mit dem modernen subjektiven Verständnis des Gewissens identifizieren zu können, verweist man gern auf sein Wort, daß er - falls es angebracht wäre, einen Trinkspruch auszubringen - zuerst auf das Gewissen und dann auf den Papst anstoßen werde. Aber in dieser Aussage bedeutet das Gewissen nicht die letzte Verbindlichkeit des subjektiven Empfindens. Es ist Ausdruck für die Zugänglichkeit und für die verpflichtende Kraft der Wahrheit: Darin ist sein Primat begründet. Dem Papst kann der zweite Trinkspruch gelten, weil es sein Auftrag ist, den Gehorsam gegenüber der Wahrheit einzufordern.
Ich muß es mir versagen, über die eindrucksvollen Reisen nach Malta, nach Portugal und nach Spanien zu sprechen. In ihnen ist wieder neu sichtbar geworden, daß Glaube nicht eine Sache der Vergangenheit, sondern Begegnung mit dem jetzt lebenden und handelnden Gott ist. Daß er uns fordert und unserer Bequemlichkeit entgegensteht, aber uns gerade so den Weg zur wirklichen Freude öffnet.
“Excita, Domine, potentiam tuam, et veni!“ Von der Bitte um die Gegenwart von Gottes Macht in unserer Zeit und von der Erfahrung seiner scheinbaren Abwesenheit sind wir ausgegangen. Wenn wir unsere Augen auftun, kann uns gerade im Rückblick auf das vergangene Jahr sichtbar werden, daß Gottes Macht und Güte auch heute auf vielfältige Weise gegenwärtig sind. So haben wir alle Grund, Ihm zu danken. Mit dem Dank an den Herrn bekräftige ich meinen Dank an alle Mitarbeiter. Möge Gott uns allen gesegnete Weihnachten und sein gutes Geleit im kommenden Jahr schenken.
Diese Wünsche vertraue ich der Fürbitte der Heiligen Jungfrau, der Mutter des Erlösers an und erteile Ihnen allen sowie der großen Familie der Römischen Kurie den Apostolischen Segen. Frohe Weihnachten!<ref> Die deutsche Fassung auf der Vatikanseite aus dem Jahre 2010</ref>
2011
am 22. Dezember in der Sala Clementina
hochwürdige Mitbrüder im Bischofs- und Priesteramt,
Dieser heutige Anlaß ist immer ein besonders gewichtiger Moment. Weihnachten steht vor der Tür und drängt auch die große Familie der Römischen Kurie, sich zu der schönen Geste des Austauschs der Glückwünsche zusammenzufinden: einander zu wünschen, das Fest Gottes, der Mensch geworden ist und unter uns gewohnt hat (vgl. 1 Joh 1,14), freudig und geistlich fruchtbringend zu feiern. Für mich ist dies die Gelegenheit, Ihnen nicht nur meinen persönlichen Glückwunsch zu überbringen, sondern jedem von Ihnen für Ihren großherzigen Dienst meinen und der Kirche Dank auszudrücken; bitte geben Sie ihn auch an alle Mitarbeiter unserer großen Familie weiter. Einen besonderen Dank richte ich an den Kardinaldekan Angelo Sodano, der im Namen der Anwesenden und all derer gesprochen hat, die in den verschiedenen Einrichtungen der Kurie und des Governatorats arbeiten, einschließlich derer, die ihren Dienst in den Päpstlichen Vertretungen in aller Welt vollziehen. Wir alle setzen uns dafür ein, daß die Verkündigung der Engel in der Nacht von Bethlehem: „Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“ (Lk 2,14), in der ganzen Welt erklinge, um Freude und Hoffnung zu bringen.
Am Ende dieses Jahres steht Europa in einer wirtschaftlichen und finanziellen Krise, die letzten Endes auf der ethischen Krise beruht, die den Alten Kontinent bedroht. Selbst wenn Werte wie Solidarität, Einstehen für die anderen, Verantwortlichkeit für die Armen und Leidenden weitgehend unbestritten sind, so fehlt häufig die motivierende Kraft, die konkret den einzelnen und die großen gesellschaftlichen Gruppen zu Verzichten und Opfern bewegen kann. Erkenntnis und Wille gehen nicht notwendig miteinander. Der Wille, der das eigene Interesse verteidigt, verdunkelt die Erkenntnis, und die geschwächte Erkenntnis kann den Willen nicht aufrichten. Insofern steigen aus dieser Krise sehr grundlegende Fragen auf: Wo ist das Licht, durch das unserer Erkenntnis nicht nur allgemeine Ideen, sondern konkrete Imperative aufleuchten können? Wo ist die Kraft, die den Willen nach oben zieht? Es sind Fragen, auf die unsere Verkündigung des Evangeliums, die neue Evangelisierung antworten muß, damit aus Botschaft Ereignis, aus Verkündigung Leben wird.
Die große Thematik dieses Jahres wie der kommenden Jahre heißt in der Tat: Wie verkündigen wir heute das Evangelium? Wie kann Glaube als lebendige Kraft heute Wirklichkeit werden? Die kirchlichen Ereignisse des vergangenen Jahres sind letztlich alle auf dieses Thema bezogen. Da waren die Reisen nach Kroatien, zum Weltjugendtag nach Spanien, in meine Heimat nach Deutschland und schließlich nach Afrika – Benin – zur Übergabe des postsynodalen Dokuments über Gerechtigkeit, Friede, Versöhnung, aus dem konkrete Wirklichkeit in den verschiedenen Ortskirchen wachsen soll. Unvergeßlich sind auch die Reisen nach Venedig, nach San Marino, zum Eucharistischen Kongreß in Ancona, nach Kalabrien. Und da ist schließlich der wichtige Tag der Begegnung der Religionen und der überhaupt nach Wahrheit und Friede suchenden Menschen in Assisi als neuer Aufbruch in der Pilgerschaft nach Wahrheit und Frieden. Die Errichtung des Päpstlichen Rates für die Neuevangelisierung ist zugleich Vorverweis auf die Synode des kommenden Jahres zum gleichen Thema. Dazu gehört dann auch das Jahr des Glaubens zum Gedächtnis des Konzilsbeginns vor 50 Jahren. Jedes dieser Ereignisse hatte seine eigenen Akzente. In Deutschland, dem Ursprungsland der Reformation, hatte natürlich die ökumenische Frage mit all ihren Mühsalen und Hoffnungen ein besonderes Gewicht. Untrennbar davon steht immer wieder im Brennpunkt der Dispute die Frage: Was ist Reform der Kirche? Wie geschieht sie? Was sind ihre Wege und ihre Ziele? Mit Besorgnis sehen nicht nur treue Glaubende, sondern auch Außenstehende, wie die regulären Kirchgänger immer älter werden und ihre Zahl beständig abnimmt; wie der Priesternachwuchs stagniert; wie Skepsis und Unglaube wachsen. Was also sollen wir tun? Es gibt nicht endende Dispute darüber, was man machen muß, damit die Trendwende gelingt. Und sicher muß man vielerlei machen. Aber das Machen allein löst die Aufgabe nicht. Der Kern der Krise der Kirche in Europa ist die Krise des Glaubens. Wenn wir auf sie keine Antwort finden, wenn Glaube nicht neu lebendig wird, tiefe Überzeugung und reale Kraft von der Begegnung mit Jesus Christus her, dann bleiben alle anderen Reformen wirkungslos.
In diesem Punkt war die Begegnung mit der freudigen Leidenschaft des Glaubens in Afrika eine große Ermutigung. Nichts von der bei uns so verbreiteten Müdigkeit des Glaubens, nichts von dem immer wieder wahrnehmbaren Überdruß am Christsein war da spürbar. In allen Problemen, Leiden und Mühsalen, die es natürlich gerade in Afrika gibt, war doch immer eine Freudigkeit des Christseins zu erleben, das Getragensein von dem inneren Glück, Christus zu kennen und seiner Kirche zuzugehören. Aus dieser Freude kommen auch die Kräfte, Christus in den bedrängenden Situationen menschlichen Leidens zu dienen, sich ihm zur Verfügung zu stellen, ohne nach dem eigenen Wohlbefinden umzuschauen. Diesem opferbereiten und gerade so fröhlichen Glauben zu begegnen, ist eine große Medizin gegen die Müdigkeit des Christseins, wie wir es in Europa erleben.
Eine Medizin gegen die Müdigkeit des Glaubens war auch die großartige Erfahrung des Weltjugendtages zu Madrid. Dies war gelebte Neuevangelisierung. Immer mehr zeichnet sich in den Weltjugendtagen eine neue, verjüngte Weise des Christseins ab, die ich in fünf Punkten zu charakterisieren versuchen möchte.
1. Da ist als erstes eine neue Erfahrung der Katholizität, der Universalität der Kirche. Das ist es, was junge Menschen und alle Anwesenden ganz unmittelbar berührt hat: Wir kommen von allen Kontinenten, und obwohl wir uns nie gesehen haben, kennen wir uns. Wir haben verschiedene Sprachen und verschiedene Lebensgewohnheiten, verschiedene kulturelle Formen, und doch sind wir sofort eins miteinander als eine große Familie. Die äußere Trennung und Verschiedenheit ist relativiert. Wir alle sind berührt von dem einen Herrn Jesus Christus, in dem uns das wahre Menschsein und zugleich das Gesicht Gottes selbst erschienen ist. Wir beten das Gleiche. Von der gleichen inneren Begegnung mit Jesus Christus her haben wir inwendig die gleiche Formung des Verstandes, des Willens und des Herzens empfangen. Und endlich ist die gemeinsame Liturgie Heimat des Herzens und verbindet uns zu einer großen Familie. Daß alle Menschen Brüder und Schwestern sind, ist hier nicht bloß Idee, sondern wird reale gemeinsame Erfahrung, die Freude schafft. Und so wußten wir auch ganz praktisch: Trotz aller Mühsale und Dunkelheiten ist es schön, der weltweiten Kirche, der Katholischen Kirche zuzugehören, die der Herr uns geschenkt hat.
2. Von da aus kommt dann eine neue Art, das Menschsein, das Christsein zu leben. Eine der wichtigsten Erfahrungen dieser Tage war für mich die Begegnung mit den Volontären des Weltjugendtages: etwa 20.000 junge Menschen, die durchweg Wochen oder Monate ihres Lebens zur Verfügung gestellt hatten, um an den technischen, organisatorischen und inhaltlichen Vorbereitungen für den Weltjugendtag zu arbeiten und die so überhaupt den geregelten Ablauf des Ganzen möglich gemacht hatten. Mit seiner Zeit gibt ein Mensch immer ein Stück seines Lebens. Am Ende waren diese jungen Menschen sichtbar und greifbar von einem großen Gefühl des Glücks erfüllt: Ihre verschenkte Zeit hatte Sinn; im Weggeben ihrer Zeit und ihrer Arbeitskraft hatten sie gerade die Zeit, das Leben gefunden. Und da wurde mir etwas Grundsätzliches deutlich: Diese jungen Menschen hatten im Glauben ein Stück Leben gegeben, nicht weil es geboten und nicht weil man sich damit den Himmel verdient; auch nicht weil man dadurch der Gefahr der Hölle entgeht. Sie taten es nicht, weil sie vollkommen sein wollten. Sie schauten nicht nach sich selber um. Das Bild der Frau des Lot, die durch das Umschauen zu einer Salzsäule erstarrt ist, kam mir in den Sinn. Wie oft ist das Leben von Christen dadurch bestimmt, daß sie vor allem nach sich selbst umsehen, das Gute sozusagen für sich selbst tun. Und wie groß ist die Versuchung aller Menschen, vor allem um sich selbst besorgt zu sein; umzuschauen auf sich selber hin und dabei innerlich leer zu werden, zur „Salzsäule“. Aber hier ging es nicht darum, sich selbst zu vervollkommnen oder sein Leben für sich haben zu wollen. Diese jungen Menschen haben Gutes getan, auch wenn es schwer war, auch wenn es Verzichte forderte, weil es schön ist, das Gute zu tun, für die anderen da zu sein. Man muß nur den Sprung wagen. All dem geht voraus die Begegnung mit Jesus Christus, die in uns die Liebe zu Gott und zu den anderen entzündet und uns frei macht von der Suche nach dem eigenen Ich. Ein dem heiligen Franz Xaver zugeschriebenes Gebet sagt: Ich tue das Gute nicht, weil ich dafür in den Himmel komme und nicht weil du mich sonst in die Hölle werfen könntest. Ich tue es, weil du Du bist, mein König und mein Herr. Derselben Haltung bin ich auch in Afrika zum Beispiel bei den Schwestern von Mutter Teresa begegnet, die sich um die verstoßenen, kranken, armen und leidenden Kinder mühen, ohne nach sich selbst zu fragen und gerade so innerlich reich und frei werden. Dies ist die eigentlich christliche Haltung. Unvergeßlich bleibt mir auch die Begegnung mit den behinderten Jugendlichen in der Stiftung S. José in Madrid, wo mir wieder die gleiche Bereitschaft begegnet ist, sich selbst für die anderen zur Verfügung zu stellen – eine Bereitschaft zur Hingabe, die letztlich aus der Begegnung mit Christus stammt, der sich für uns hingegeben hat.
3. Ein drittes Element, das immer selbstverständlicher und zentraler zu den Weltjugendtagen und der von ihnen ausgehenden Spiritualität gehört, ist die Anbetung. Unvergeßlich ist mir der Augenblick meiner Reise ins Vereinigte Königreich, wo im Hydepark die Zehntausenden von überwiegend jungen Menschen in einem gefüllten Schweigen auf die Anwesenheit des Herrn im Sakrament antworteten, anbeteten. Dasselbe hat sich in kleinerem Maßstab wieder in Zagreb ereignet und wiederum in Madrid nach dem Gewitter, das das Ganze der nächtlichen Begegnung durch den Ausfall der Mikrophone zu zerstören drohte. Gott ist allgegenwärtig, ja. Aber die leibliche Gegenwart des auferstandenen Christus ist noch einmal etwas anderes, etwas Neues. Der Auferstandene tritt mitten unter uns herein. Und da können wir gar nicht anders als mit dem Apostel Thomas sagen: Mein Herr und mein Gott! Anbetung ist zuerst ein Akt des Glaubens – der Akt des Glaubens als solcher. Gott ist nicht irgendeine mögliche oder unmögliche Hypothese über den Ursprung des Alls. Er ist da. Und wenn er da ist, dann beuge ich mich vor ihm. Dann öffnen sich Verstand und Wille und Herz auf ihn hin und von ihm her. Im auferstandenen Christus ist der menschgewordene Gott da, der für uns gelitten hat, weil er uns liebt. In diese Gewißheit der leibhaftigen Liebe Gottes zu uns treten wir als Mitliebende hinein. Das ist Anbetung, und das bestimmt dann mein Leben. Nur so kann ich auch Eucharistie richtig feiern und den Leib des Herrn recht empfangen.
4. Ein weiteres wichtiges Element der Weltjugendtage ist die immer selbstverständlicher zum Ganzen gehörende Anwesenheit des Bußsakraments. Damit anerkennen wir, daß wir immer wieder Vergebung brauchen und daß Vergebung Verantwortung ist. Im Menschen ist vom Schöpfer her die Bereitschaft zu lieben da und die Fähigkeit, im Glauben Gott zu antworten. Aber es gibt von der sündigen Geschichte des Menschen her (die kirchliche Lehre spricht von der Erbsünde) auch die umgekehrte Tendenz zur Liebe – die Tendenz zum Egoismus, zur Selbstverschließung, ja, zum Bösen. Immer wieder wird meine Seele verschmutzt durch diese nach unten ziehende Schwerkraft, die in mir da ist. Deshalb brauchen wir die Demut, die immer neu Gott um Vergebung bittet; die sich reinigen läßt und die die Gegenkraft, die positive Kraft des Schöpfers in uns aufweckt, die uns nach oben zieht.
5. Schließlich möchte ich als letztes, nicht zu übersehendes Kennzeichen der Spiritualität der Weltjugendtage die Freude nennen. Woher kommt sie? Wie erklärt sie sich? Sicher wirken viele Faktoren zusammen. Aber der entscheidende ist nach meinem Dafürhalten die aus dem Glauben kommende Gewißheit: Ich bin gewollt. Ich habe einen Auftrag in der Geschichte. Ich bin angenommen, bin geliebt. Josef Pieper hat in seinem Buch über die Liebe gezeigt, daß der Mensch sich selbst nur annehmen kann, wenn er von einem anderen angenommen ist. Er braucht das Dasein des anderen, der ihm nicht nur mit Worten sagt: Es ist gut, daß du bist. Nur vom Du her kann das Ich zu sich selbst kommen. Nur wenn es angenommen ist, kann es sich annehmen. Wer nicht geliebt wird, kann sich auch nicht selber lieben. Dieses Angenommenwerden kommt zunächst vom anderen Menschen her. Aber alles menschliche Annehmen ist zerbrechlich. Letztlich brauchen wir ein unbedingtes Angenommensein. Nur wenn Gott mich annimmt und ich dessen gewiß werde, weiß ich endgültig: Es ist gut, daß ich bin. Es ist gut, ein Mensch zu sein. Wo die Wahrnehmung für das Angenommensein des Menschen von Gott, für unser Geliebtsein durch ihn verschwindet, da findet die Frage, ob es überhaupt gut ist, ein Mensch zu sein, keine Antwort mehr. Der Zweifel am Menschsein wird immer unüberschreitbarer. Wo der Zweifel an Gott dominierend wird, da folgt der Zweifel am Menschsein selbst unausweichlich. Wir sehen heute, wie sich dieser Zweifel ausbreitet. Wir sehen es an der Freudlosigkeit, an der inneren Traurigkeit, die man in so vielen menschlichen Gesichtern lesen kann. Nur der Glaube macht mich gewiß: Es ist gut, daß ich bin. Es ist gut, ein Mensch zu sein, auch in schwieriger Zeit. Der Glaube macht von innen her froh. Das ist eine der wunderbaren Erfahrungen der Weltjugendtage.
Es würde zu weit führen, jetzt noch ausführlich über die Begegnung in Assisi zu sprechen, wie es der Bedeutung des Ereignisses entspräche. Danken wir einfach Gott, daß wir – die Vertreter der Weltreligionen und auch die Vertreter des nach der Wahrheit suchenden Denkens – uns an diesem Tag in einem Klima der Freundschaft und des gegenseitigen Respekts in der Liebe zur Wahrheit und in der gemeinsamen Verantwortung für den Frieden begegnen durften. So dürfen wir hoffen, daß aus dieser Begegnung eine neue Bereitschaft gewachsen ist, dem Frieden, der Versöhnung und der Gerechtigkeit zu dienen.
Am Ende möchte ich Ihnen allen von Herzen danken für das Mittragen der Sendung, die uns der Herr als Zeugen seiner Wahrheit übergeben hat, und Ihnen allen die Freude wünschen, die Gott uns in der Menschwerdung seines Sohnes schenken wollte. Ihnen allen gesegnete Weihnachten! Danke.<ref> Die deutsche Fassung auf der Vatikanseite aus dem Jahre 2011</ref>
2012
am 21. Dezember in der Sala Clementina
Mit großer Freude begegne ich Ihnen heute, liebe Mitglieder des Kardinalskollegiums sowie Vertreter der Römischen Kurie und des Governatoratos zu diesem traditionellen Moment vor dem Weihnachtsfest. Herzlich begrüße ich jeden einzelnen, angefangen bei Kardinal Angelo Sodano, dem ich für seine schönen Worte und die herzlichen Glückwünsche danke, die er auch in Ihrem Namen an mich gerichtet hat. Der Kardinaldekan hat uns an einen Satz erinnert, der in der lateinischen Liturgie in diesen Tagen häufig wiederkehrt: Prope est iam Dominus, venite, adoremus! Der Herr ist nahe, kommt, wir beten ihn an! Auch wir machen uns bereit, in der Grotte von Bethlehem das Kind anzubeten, das Gott selber ist – der Gott, der uns so nahe gekommen ist, daß er ein Mensch wurde wie wir. Gerne erwidere ich die Glückwünsche und danke allen von Herzen, einschließlich der Päpstlichen Vertreter in aller Welt, für ihre großherzige und qualifizierte Mitarbeit, mit der jeder von Ihnen zu meinem Dienst beisteuert.
Wir stehen am Ende eines Jahres, das wieder in Kirche und Welt von vielerlei Bedrängnissen, von großen Fragen und Herausforderungen, aber auch von Zeichen der Hoffnung geprägt war. Ich nenne nur einige Einschnitte im Bereich des Lebens der Kirche und meines Petrusdienstes. Da waren – wie der Kardinaldekan bereits erwähnte – zunächst die Reisen nach Mexiko und Kuba – unvergeßliche Begegnungen mit der tief im Herzen der Menschen verwurzelten Kraft des Glaubens und mit der Freude am Leben, die aus dem Glauben kommt. Ich denke daran, wie nach der Ankunft in Mexiko auf dem langen Weg, der zu durchfahren war, endlose Scharen von Menschen grüßten und winkten. Ich denke daran, wie auf der Fahrt nach Guanajuato, der malerischen Hauptstadt des gleichnamigen Staates, junge Menschen ehrfürchtig an der Seite der Straße knieten, um den Segen des Petrusnachfolgers zu empfangen; wie der große Gottesdienst in der Nähe der Christkönigs-Statue zu einer Vergegenwärtigung von Christi Königtum wurde – seines Friedens, seiner Gerechtigkeit, seiner Wahrheit. Dies alles geschah auf dem Hintergrund der Probleme eines Landes, das unter vielfältigen Formen der Gewalt und unter den Nöten wirtschaftlicher Abhängigkeit leidet. Es sind Probleme, die gewiß nicht einfach durch Frömmigkeit gelöst werden können, aber erst recht nicht ohne jene innere Reinigung der Herzen, die aus der Kraft des Glaubens, aus der Begegnung mit Jesus Christus kommt. Und da war das Erlebnis Kuba – auch hier die großen Gottesdienste, in deren Singen, Beten und Schweigen die Gegenwart dessen spürbar wurde, dem man den Platz im Land lange hatte verweigern wollen. Die Suche nach einem rechten Ansatz für das Verhältnis von Bindung und Freiheit in diesem Land kann gewiß nicht gelingen ohne einen Anhalt an jene Maßstäbe, die der Menschheit in der Begegnung mit dem Gott Jesu Christi aufgegangen sind.
Als weitere Haltepunkte des vergangenen Jahres möchte ich nennen: das große Fest der Familie in Mailand sowie den Besuch im Libanon mit der Übergabe des Nachsynodalen Apostolischen Schreibens, das nun im Leben der Kirchen und der Gesellschaft des Nahen Ostens Wegweisung werden soll auf den schwierigen Wegen der Einheit und des Friedens. Das letzte wichtige Ereignis dieses abgelaufenen Jahres war dann die Synode über die Neuevangelisierung, die zugleich ein gemeinsamer Beginn für das Glaubensjahr gewesen ist, mit dem wir der Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren gedenken, um es in der veränderten Situation neu zu verstehen und neu anzueignen.
Mit all diesen Anlässen sind grundlegende Themen unseres geschichtlichen Augenblicks angesprochen: Familie (Mailand) – Dienst am Frieden in der Welt und Dialog der Religionen (Libanon) sowie die Verkündigung der Botschaft Jesu Christi in unserer Zeit an jene, die ihm noch nicht begegnet sind und an die vielen, die ihn nur von außen kennen und so gerade nicht er-kennen. Von diesen großen Themenkreisen möchte ich vor allem das Thema Familie und das Wesen des Dialogs etwas näher beleuchten, um dann noch eine kurze Anmerkung über das Thema der neuen Evangelisierung anzufügen.
Die große Freude, mit der in Mailand Familien aus aller Welt einander begegnet sind, zeigt, daß die Familie trotz aller gegenteiligen Eindrücke auch heute stark und lebendig ist. Aber unbestreitbar ist doch auch die Krise, die sie - besonders in der westlichen Welt – bis auf den Grund bedroht. Es war beeindruckend, daß in der Synode immer wieder die Bedeutung der Familie für die Glaubensvermittlung herausgestellt wurde – als der genuine Ort, in dem die Grundformen des Menschseins weitergegeben werden. Sie werden erlernt, indem sie miteinander gelebt und auch erlitten werden. So wurde deutlich, daß es bei der Frage nach der Familie nicht nur um eine bestimmte Sozialform geht, sondern um die Frage nach dem Menschen selbst – um die Frage, was der Mensch ist und wie man es macht, auf rechte Weise ein Mensch zu sein. Die Herausforderungen, um die es dabei geht, sind vielschichtig. Da ist zunächst die Frage nach der Bindungsfähigkeit oder nach der Bindungslosigkeit des Menschen. Kann er lebenslang sich binden? Ist das seinem Wesen gemäß? Widerspricht es nicht seiner Freiheit und der Weite seiner Selbstverwirklichung? Wird der Mensch er selber, indem er für sich bleibt und zum anderen nur Beziehungen eingeht, die er jederzeit wieder abbrechen kann? Ist Bindung für ein Leben lang Gegensatz zur Freiheit? Ist die Bindung auch des Leidens wert? Die Absage an die menschliche Bindung, die sich von einem falschen Verständnis der Freiheit und der Selbstverwirklichung her wie in der Flucht vor der Geduld des Leidens immer mehr ausbreitet, bedeutet, daß der Mensch in sich bleibt und sein Ich letztlich für sich selbst behält, es nicht wirklich überschreitet. Aber nur im Geben seiner Selbst kommt der Mensch zu sich selbst, und nur indem er sich dem anderen, den anderen, den Kindern, der Familie öffnet, nur indem er im Leiden sich selbst verändern läßt, entdeckt er die Weite des Menschseins. Mit der Absage an diese Bindung verschwinden auch die Grundfiguren menschlicher Existenz: Vater, Mutter, Kind; es fallen wesentliche Weisen der Erfahrung des Menschseins weg.
Der Großrabbiner von Frankreich, Gilles Bernheim, hat in einem sorgfältig dokumentierten und tief bewegenden Traktat gezeigt, daß der Angriff auf die wahre Gestalt der Familie aus Vater, Mutter, Kind, dem wir uns heute ausgesetzt sehen, noch eine Dimension tiefer reicht. Hatten wir bisher ein Mißverständnis des Wesens menschlicher Freiheit als einen Grund für die Krise der Familie gesehen, so zeigt sich nun, daß dabei die Vision des Seins selbst, dessen, was Menschsein in Wirklichkeit bedeutet, im Spiele ist. Er zitiert das berühmt gewordene Wort von Simone de Beauvoir: „Man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird dazu“. („On ne naît pas femme, on le devient“). In diesen Worten ist die Grundlegung dessen gegeben, was man heute unter dem Stichwort „gender“ als neue Philosophie der Geschlechtlichkeit darstellt. Das Geschlecht ist nach dieser Philosophie nicht mehr eine Vorgabe der Natur, die der Mensch annehmen und persönlich mit Sinn erfüllen muß, sondern es ist eine soziale Rolle, über die man selbst entscheidet, während bisher die Gesellschaft darüber entschieden habe. Die tiefe Unwahrheit dieser Theorie und der in ihr liegenden anthropologischen Revolution ist offenkundig. Der Mensch bestreitet, daß er eine von seiner Leibhaftigkeit vorgegebene Natur hat, die für das Wesen Mensch kennzeichnend ist. Er leugnet seine Natur und entscheidet, daß sie ihm nicht vorgegeben ist, sondern daß er selber sie macht. Nach dem biblischen Schöpfungsbericht gehört es zum Wesen des Geschöpfes Mensch, daß er von Gott als Mann und als Frau geschaffen ist. Diese Dualität ist wesentlich für das Menschsein, wie Gott es ihm gegeben hat. Gerade diese Dualität als Vorgegebenheit wird bestritten. Es gilt nicht mehr, was im Schöpfungsbericht steht: „Als Mann und Frau schuf ER sie“ (Gen 1, 27). Nein, nun gilt, nicht ER schuf sie als Mann und Frau; die Gesellschaft hat es bisher getan, und nun entscheiden wir selbst darüber. Mann und Frau als Schöpfungswirklichkeiten, als Natur des Menschen gibt es nicht mehr. Der Mensch bestreitet seine Natur. Er ist nur noch Geist und Wille. Die Manipulation der Natur, die wir heute für unsere Umwelt beklagen, wird hier zum Grundentscheid des Menschen im Umgang mit sich selber. Es gibt nur noch den abstrakten Menschen, der sich dann so etwas wie seine Natur selber wählt. Mann und Frau sind in ihrem Schöpfungsanspruch als einander ergänzende Gestalten des Menschseins bestritten. Wenn es aber die von der Schöpfung kommende Dualität von Mann und Frau nicht gibt, dann gibt es auch Familie als von der Schöpfung vorgegebene Wirklichkeit nicht mehr. Dann hat aber auch das Kind seinen bisherigen Ort und seine ihm eigene Würde verloren. Bernheim zeigt, daß es nun notwendig aus einem eigenen Rechtssubjekt zu einem Objekt wird, auf das man ein Recht hat und das man sich als sein Recht beschaffen kann. Wo die Freiheit des Machens zur Freiheit des Sich-selbst-Machens wird, wird notwendigerweise der Schöpfer selbst geleugnet und damit am Ende auch der Mensch als göttliche Schöpfung, als Ebenbild Gottes im Eigentlichen seines Seins entwürdigt. Im Kampf um die Familie geht es um den Menschen selbst. Und es wird sichtbar, daß dort, wo Gott geleugnet wird, auch die Würde des Menschen sich auflöst. Wer Gott verteidigt, verteidigt den Menschen.
Damit möchte ich zum zweiten großen Thema kommen, das sich von Assisi bis zur Synode über die Neuevangelisierung durch das vergangene Jahr hindurchzieht – zur Frage über Dialog und Verkündigung. Sprechen wir zunächst vom Dialog. Ich sehe für die Kirche in unserer Zeit vor allem drei Dialogfelder, in denen sie im Ringen um den Menschen und sein Menschsein präsent sein muß: den Dialog mit den Staaten; den Dialog mit der Gesellschaft, und darin enthalten der Dialog mit den Kulturen und mit der Wissenschaft sowie schließlich den Dialog mit den Religionen. In allen diesen Dialogen spricht die Kirche von dem Licht her, das ihr der Glaube schenkt. Sie verkörpert aber zugleich das Gedächtnis der Menschheit, das von den Anfängen her über die Zeiten hin Gedächtnis der Erfahrungen und der Erleidnisse der Menschheit ist, in denen sie das Menschsein gelernt, seine Grenzen und seine Größe, seine Möglichkeiten und seine Begrenzungen erfahren hat. Die Kultur des Humanen, für die sie einsteht, ist aus der Begegnung zwischen Gottes Offenbarung und menschlicher Existenz gewachsen. Die Kirche vertritt das Gedächtnis des Menschseins gegenüber einer Zivilisation des Vergessens, die nur noch sich selbst und ihre eigenen Maßstäbe kennt. Aber wie ein Mensch ohne Gedächtnis seine Identität verloren hat, so verlöre auch eine Menschheit ohne Gedächtnis ihre Identität. Was der Kirche in der Begegnung von Offenbarung und menschlicher Erfahrung gezeigt wurde, reicht zwar über den Bereich der eigenen Vernunft hinaus, ist aber nicht eine Sonderwelt, die den Nichtglaubenden nichts anginge. Im Mitdenken und Mitverstehen des Menschen weitet es den Horizont der Vernunft und geht so auch diejenigen an, die den Glauben der Kirche nicht teilen können. Im Dialog mit dem Staat und mit der Gesellschaft hält die Kirche für die einzelnen Fragen gewiß keine fertigen Lösungen bereit. Sie wird mit den anderen gesellschaftlichen Kräften um die Antworten ringen, die am meisten dem rechten Maß des Menschseins entsprechen. Was sie als konstitutive und nicht verhandelbare Grundwerte des Menschseins erkannt hat, dafür muß sie mit aller Klarheit eintreten. Sie muß alles tun, um Überzeugung zu schaffen, die dann zu politischem Handeln werden kann.
In der heutigen Situation der Menschheit ist der Dialog der Religionen eine notwendige Bedingung für den Frieden in der Welt und darum eine Pflicht für die Christen wie für die anderen Religionsgemeinschaften. Dieser Dialog der Religionen hat verschiedene Dimensionen. Er wird zuallererst einfach ein Dialog des Lebens, ein Dialog des Miteinander sein. Dabei wird man nicht von den großen Themen des Glaubens sprechen – ob Gott trinitarisch ist oder wie Inspiration der Heiligen Schriften zu verstehen sei usw. Es geht um die konkreten Probleme des Miteinander und um die gemeinsame Verantwortung für die Gesellschaft, für den Staat, für die Menschheit. Dabei muß man lernen, den anderen in seinem Anderssein und Andersdenken anzunehmen. Dafür ist es nötig, die gemeinsame Verantwortung für Gerechtigkeit und Frieden zum Maßstab des Gesprächs zu machen. Ein Dialog, in dem es um Friede und Gerechtigkeit geht, wird von selbst über das bloß Pragmatische hinaus zu einem ethischen Ringen um die Wahrheit und um das Menschsein; ein Dialog um die Werte, die allem vorangehen. So wird der zunächst rein praktische Dialog doch auch zu einem Ringen um das rechte Menschsein. Auch wenn die Grundentscheide als solche nicht zur Debatte stehen, wird das Mühen um eine konkrete Frage zu einem Prozeß, in dem durch das Hören auf den anderen beide Seiten Reinigung und Bereicherung empfangen können. So kann dieses Mühen auch gemeinsame Schritte auf die eine Wahrheit hin bedeuten, ohne daß die Grundentscheide geändert werden. Wenn beide Seiten von einer Hermeneutik der Gerechtigkeit und des Friedens ausgehen, so wird die Grunddifferenz nicht verschwinden, aber es wächst doch auch eine tiefere Nähe zueinander.
Für das Wesen des interreligiösen Dialogs werden heute im allgemeinen zwei Regeln als grundlegend angesehen:
1) Der Dialog zielt nicht auf Bekehrung, sondern auf Verstehen. Dadurch unterscheidet er sich von der Evangelisierung, von der Mission.
2) Demgemäß verbleiben bei diesem Dialog beide Seiten bewußt in ihrer Identität, die sie im Dialog für sich und für den anderen nicht in Frage stellen.
Diese Regeln sind richtig, aber ich finde sie doch in dieser Form zu vordergründig formuliert. Ja, der Dialog zielt nicht auf Bekehrung, sondern auf gegenseitiges besseres Verstehen – das ist richtig. Aber die Suche nach Erkennen und Verstehen will doch immer auch Annäherung an die Wahrheit sein. Beide Seiten sind so im stückweisen Zugehen auf Wahrheit auf dem Weg nach vorn und zu größerer Gemeinsamkeit, die von der Einheit der Wahrheit gestiftet wird. Was das Festhalten an der eigenen Identität betrifft: Es wäre zu wenig, wenn der Christ mit seinem Identitätsentscheid sozusagen vom Willen her den Weg zur Wahrheit abbrechen würde. Dann wird sein Christsein etwas Willkürliches, bloß Positives. Er rechnet dann offenbar gar nicht damit, daß man es in der Religion mit Wahrheit zu tun bekommt. Demgegenüber würde ich sagen, der Christ habe das große Grundvertrauen, ja, die große Grundgewißheit, daß er ruhig ins offene Meer der Wahrheit hinausfahren könne, ohne um seine Identität als Christ fürchten zu müssen. Gewiß, wir haben die Wahrheit nicht, aber sie hat uns: Christus, der die Wahrheit ist, hat uns bei der Hand genommen, und wir wissen auf dem Weg unseres Ringens um Erkenntnis, daß seine Hand uns festhält. Das innere Gehaltensein des Menschen von der Hand Christi macht uns frei und zugleich sicher. Frei – wenn wir von ihm gehalten sind, können wir offen und angstlos in jeden Dialog eintreten. Sicher sind wir, weil er uns nicht losläßt, wenn wir nicht selbst uns von ihm lösen. Mit ihm eins stehen wir im Licht der Wahrheit.
Am Schluß soll wenigstens noch ein kurzes Wort über die Verkündigung, die Evangelisierung stehen, über die ja das Postsynodale Dokument im Anschluß an die Vorschläge der Väter ausführlich sprechen wird. Ich finde, daß die wesentlichen Elemente des Vorgangs der Evangelisierung sehr sprechend in der Erzählung des heiligen Johannes von der Berufung zweier Täuferjünger erscheinen, die zu Jüngern Jesu Christi werden (Joh 1, 35 – 39). Da ist zunächst der einfache Akt der Verkündigung. Johannes der Täufer zeigt auf Jesus hin und sagt: „Seht, das Lamm Gottes!“ Der Evangelist erzählt wenig später ein ähnliches Geschehen. Diesmal ist es Andreas, der zu seinem Bruder Simon sagt: „Wir haben den Messias gefunden“ (1, 41). Das erste und grundlegende Element ist die schlichte Verkündigung, das Kerygma, das seine Kraft aus der inneren Überzeugung des Verkündigers schöpft. In der Erzählung von den zwei Jüngern folgt dann das Hören und das hinter Jesus Hergehen, das noch nicht Nachfolge, sondern eher eine heilige Neugier, eine Suchbewegung ist. Beide sind ja Menschen, die Suchende sind, Menschen, die über den Alltag hinaus in der Erwartung Gottes leben – in der Erwartung, daß er da ist und daß er sich zeigen wird. Von der Verkündigung angerührt, wird ihr Suchen konkret. Sie wollen den näher kennenlernen, den der Täufer als Lamm Gottes bezeichnet hatte. Der dritte Akt kommt dadurch in Gang, daß Jesus sich umwendet, sich ihnen zukehrt und sie fragt: „Was sucht ihr?“ Die Antwort der beiden ist wiederum eine Frage, die die Offenheit ihres Wartens anzeigt, die Bereitschaft zu neuen Schritten. Sie fragen: „Rabbi, wo wohnst du?“ Jesu Antwort: „Kommt und seht!“ ist eine Aufforderung mitzugehen und im Mitgehen mit ihm sehend zu werden.
Das Wort der Verkündigung wird da wirksam, wo im Menschen die hörende Bereitschaft für die Nähe Gottes da ist; wo der Mensch innerlich auf der Suche und so unterwegs zum Herrn hin ist. Dann trifft ihn die Zuwendung Jesu ins Herz hinein, und dann wird die Begegnung mit der Verkündigung zur heiligen Neugier, Jesus näher kennenzulernen. Dieses Mitgehen führt dorthin, wo Jesus wohnt, in die Gemeinschaft der Kirche, die sein Leib ist. Es bedeutet Eintreten in die Weggemeinschaft der Katechumenen, die zugleich Lern- und Lebensgemeinschaft ist, in der wir im Mitgehen Sehende werden.
„Kommt und seht!“ Dieses Wort, das Jesus zu den beiden suchenden Jüngern sagt, sagt er auch zu den suchenden Menschen von heute. Am Ende des Jahres wollen wir den Herrn darum bitten, daß die Kirche trotz all ihrer Armseligkeiten immer mehr als seine Wohnstatt erkennbar wird. Wir bitten ihn, daß er auch uns im Hingehen zu seinem Haus immer mehr sehend macht; daß wir immer besser, immer überzeugender sagen können: Wir haben den gefunden, auf den alle Welt wartet, Jesus Christus, wahrer Sohn Gottes und wahrer Mensch. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen von Herzen gesegnete Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr. Danke.<ref> Die deutsche Fassung auf der Vatikanseite aus dem Jahre 2012</ref>
Anmerkungen
<references />
